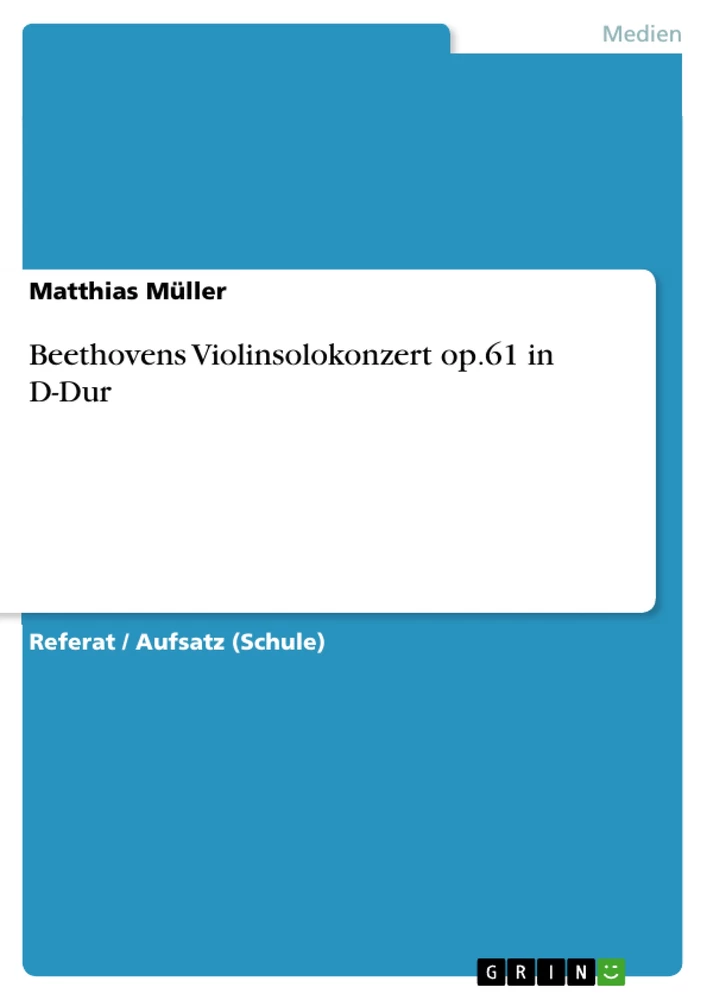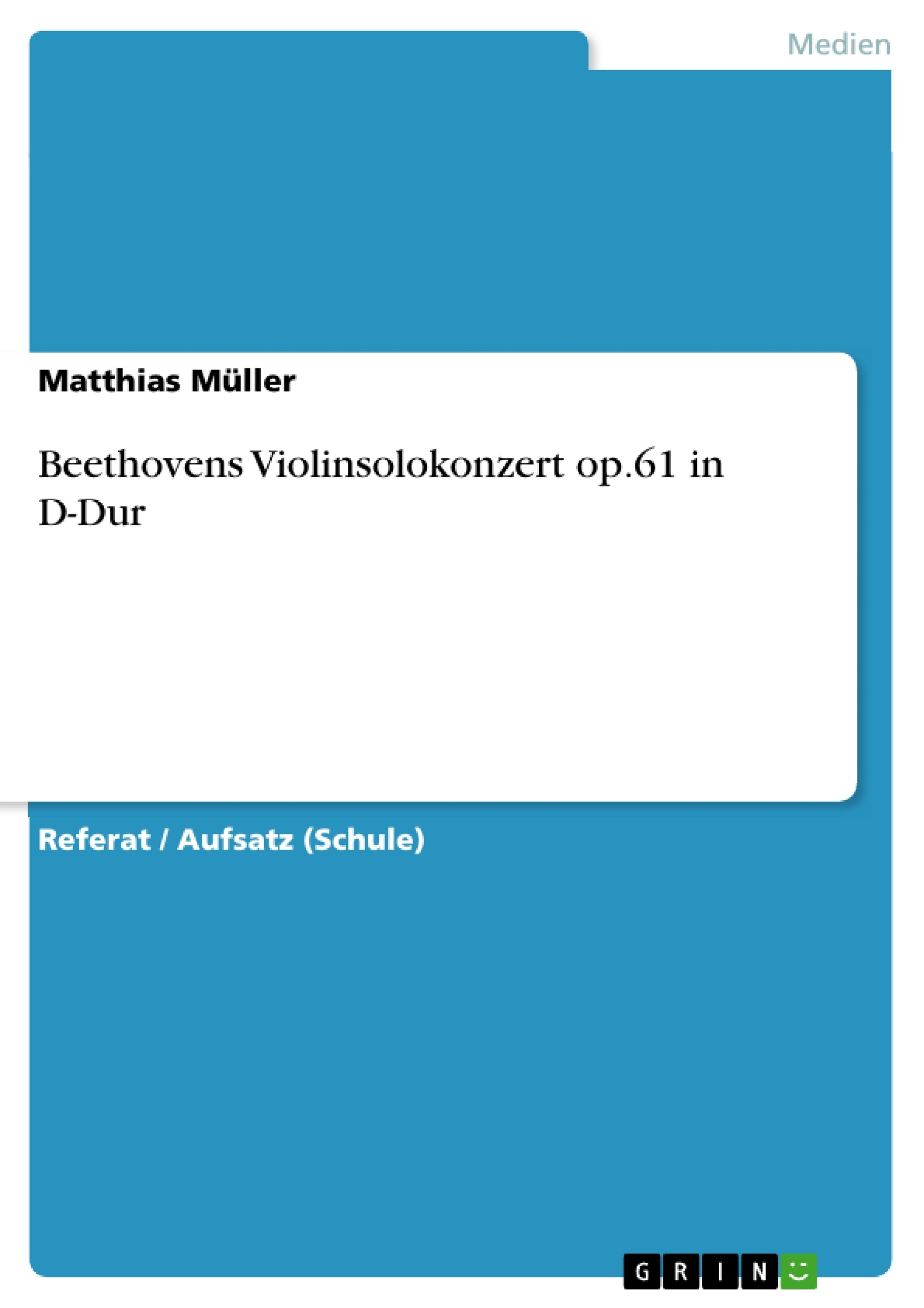Beethovens Violinsolokonzert op.61 in D-Dur
1.Allgemeines
-Beethovens einziges und einzigartiges Violinkonzert
-geschrieben für Orchesterchef und Konzertmeister (1.Violine) Franz Clement des Theaters an der Wien
-Uraufführung 23.Dezember 1806 an Clements eigener Akademie
-durch verspätete Ablieferung des Werkes an Konzertmeister ¿
-unausgereifter Eindruck wegen wenig vorbereiteter Wiedergabe
- schlechte Aufnahme seitens der Kritiker
-trotzdem Prüfstein geigerischen Könnens
2.Charakter
-frühlingshafte, aufbrechende Fülle – glückliche Stimmung
-Konzert enthält die typisch kämpferischen Züge Beethovens, aber heftige Konflikte werden kaum ausgetragen
-Konzert hat durchgehend lyrischen und gefühlsbetonten Charakter ¬ auf typischen Klangcharakter des Solointruments zurückzuschließen
-Man spricht von einem jubelnden, schluchzenden, gefühlbetonten Geigenton
-Violine ist ein reines „Melodieinstrument“ ® muß trotz aller Selbstständigkeit im Ausdruck vom harmonischen Unterbau des Orchesters getragen werden
3.Form und Instrumentation
-Solokonzert – Form der Sonate
-Anlehnung an französichen Konzerttypus der Dreisätzigkeit:
1.Satz (allegro ma non troppo) – D-Dur, 4¤4-Takt
2.Satz (larghetto) – G-Dur, 4/4-Takt
3.Satz Rondo-Finale (allegro) – D-Dur, 6/8-Takt
-Besetzung: Solo-Violine; Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, Streicher
-Aufführungsdauer: ca. 45 Minuten
1.Satz:MODIFIZIERTE SONATENHAUPTSATZFORM DES KLASSISCHEN KONZERTS
Themenanalyse Thema A:
-Themencharakter – halbe und Viertelnoten, Synkophen
-Artikulation – gebunden, legato
-Dynamik – piano
-Themencharakter- glücklich, einfühlsam, frei, trabend
Thema A*
-Themencharakter – halbe an Achtelnote - aufsteigend, durch Dreiklänge fallend, Synkophen
-Artikulation – gebunden mit spiccato-Achteln, schnelle akzentuierte 16-tel (sf)
-Dynamik – p < f < ff > p
-Themencharakter – drängend, strebend, energisch
Thema B:
-Themencharakter – 3 Viertel an 2 Achtel gebunden – aufsteigend, durch 2 halbe Noten wieder fallend
-Artikulation – gebunden, legato
-Dynamik – piano
-Themencharakter – lyrisch, fröhlich – Thema A ergänzend :
Thema B*
-Themencharakter – Variation von Thema B, in Moll, mit Triolen unterlegt
-Artikulation – gebunden, legato
-Dynamik – piano – lauter werdend
-Themencharakter – einfühlsam, leidenschaftlich, nachdenklich (erdrückend)
Thema C:
-Themencharakter – an Vietelaufgang ist halbe Note gebunden
-Artikulation – gebunden, legato
-Dynamik – ff > p
-Themencharakter – hymnische Melodie
Thema D:
-Themencharakter – Umspielung durch Solovioline, pochendes Leitmotiv
-Artikulation – gebunden, legato
-Dynamik – pianissimo
Häufig gestellte Fragen zu Beethovens Violinsolokonzert op.61 in D-Dur
Allgemeines zum Violinkonzert
Was ist Beethovens Violinkonzert op.61? Beethovens Violinkonzert op.61 in D-Dur ist sein einziges Violinkonzert.
Für wen wurde das Violinkonzert geschrieben? Es wurde für Franz Clement geschrieben, der Orchesterchef und Konzertmeister des Theaters an der Wien war.
Wann war die Uraufführung? Die Uraufführung fand am 23. Dezember 1806 an Clements eigener Akademie statt.
Wie wurde die Uraufführung aufgenommen? Aufgrund verspäteter Ablieferung des Werkes und mangelnder Vorbereitung wurde es schlecht aufgenommen.
Was ist die Bedeutung des Konzerts heute? Trotz der anfänglichen Kritik ist es heute ein Prüfstein geigerischen Könnens.
Charakter des Violinkonzerts
Welchen Charakter hat das Violinkonzert? Es hat einen frühlingshaften, aufbrechenden Charakter mit einer glücklichen Stimmung. Typisch kämpferische Züge Beethovens sind vorhanden, aber Konflikte werden kaum ausgetragen. Es hat einen durchgehend lyrischen und gefühlsbetonten Charakter.
Welche Rolle spielt die Violine? Die Violine ist ein reines "Melodieinstrument", das trotz aller Selbstständigkeit vom harmonischen Unterbau des Orchesters getragen werden muss.
Form und Instrumentation des Violinkonzerts
Welche Form hat das Violinkonzert? Es ist ein Solokonzert in Form einer Sonate, angelehnt an den französischen Konzerttypus der Dreisätzigkeit.
Wie sind die Sätze aufgebaut? Der 1. Satz (Allegro ma non troppo) ist in D-Dur im 4/4-Takt, der 2. Satz (Larghetto) in G-Dur im 4/4-Takt und das Rondo-Finale (Allegro) in D-Dur im 6/8-Takt.
Welche Instrumente werden verwendet? Solo-Violine, Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken und Streicher.
Wie lange dauert die Aufführung? Die Aufführungsdauer beträgt ca. 45 Minuten.
Themenanalyse des 1. Satzes
Wie ist der 1. Satz aufgebaut? Der 1. Satz ist in modifizierter Sonatenhauptsatzform des klassischen Konzerts.
Was sind die Merkmale von Thema A? Halbe und Viertelnoten, Synkophen, gebunden (legato), Dynamik piano, glücklich, einfühlsam, frei, trabend.
Was sind die Merkmale von Thema A*? Halbe an Achtelnote, aufsteigend, fallend durch Dreiklänge, Synkophen, gebunden mit Spiccato-Achteln, schnelle akzentuierte 16-tel (sf), Dynamik p < f < ff > p, drängend, strebend, energisch.
Was sind die Merkmale von Thema B? 3 Viertel an 2 Achtel gebunden, aufsteigend, fallend durch 2 halbe Noten, gebunden (legato), Dynamik piano, lyrisch, fröhlich, Thema A ergänzend.
Was sind die Merkmale von Thema B*? Variation von Thema B, in Moll, mit Triolen unterlegt, gebunden (legato), Dynamik piano – lauter werdend, einfühlsam, leidenschaftlich, nachdenklich (erdrückend).
Was sind die Merkmale von Thema C? An Viertelaufgang ist halbe Note gebunden, gebunden (legato), Dynamik ff > p, hymnische Melodie.
Was sind die Merkmale von Thema D? Umspielung durch Solovioline, pochendes Leitmotiv, gebunden (legato), Dynamik pianissimo, zart, lyrisch, traurig.
- Citar trabajo
- Matthias Müller (Autor), 2001, Beethovens Violinsolokonzert op.61 in D-Dur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100794