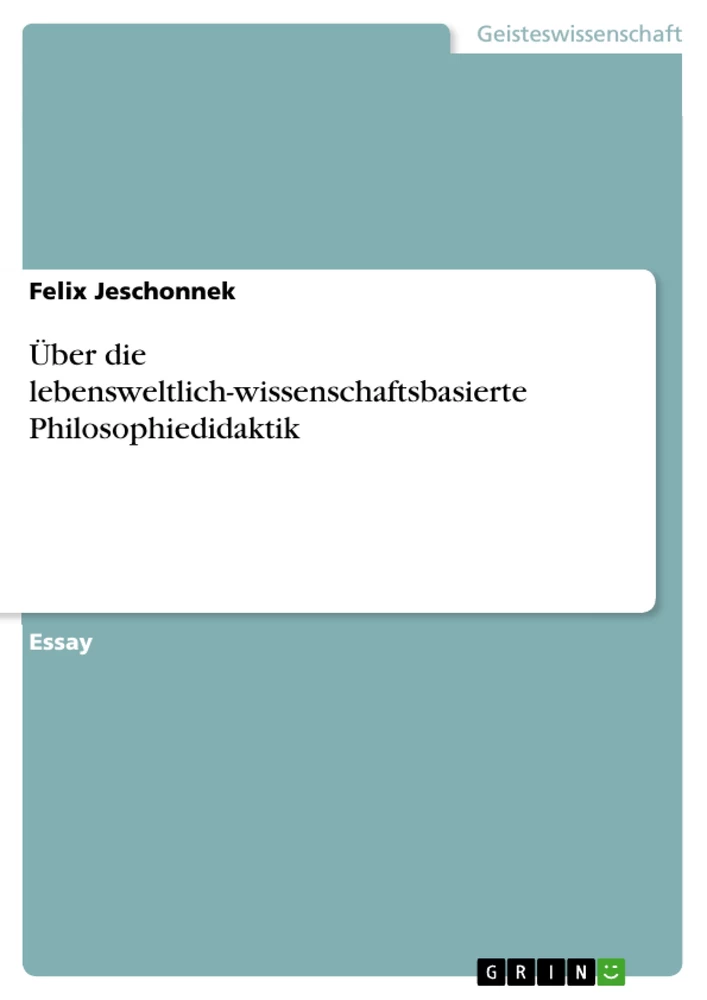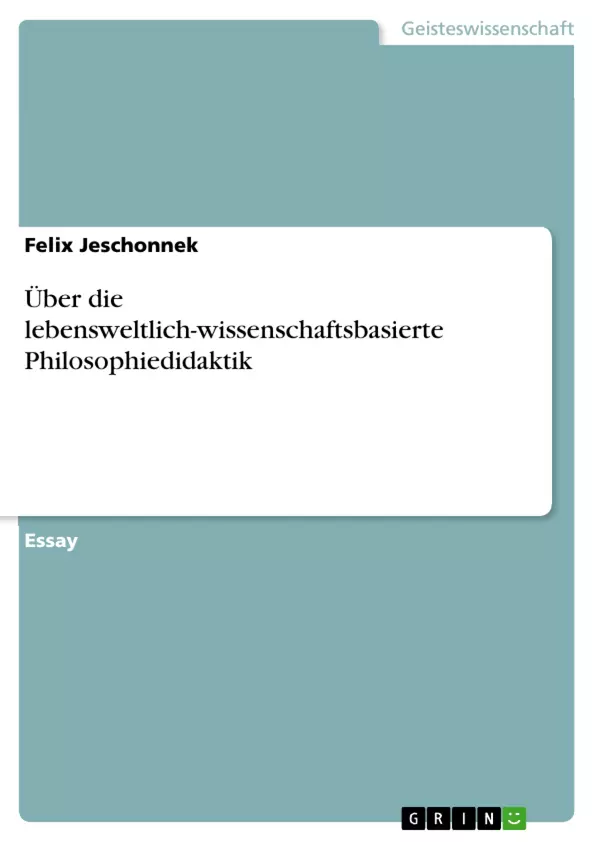Auf der Internetpräsenz der Fakultät Philosophie und Erziehungswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum, die mit Martens und Steenblock zwei sehr prominente Vertreter ihrer Zunft beherbergte, wird der folgende Anspruch für die Lehrtätigkeit an Schulen formuliert: „Lehrerinnen und Lehrer müssen als Anwälte der philosophischen Tradition deren Gehalte für das lebensweltliche Interesse von Jugendlichen anschlussfähig machen können.“ Hierzu benötigen die Lehrenden nicht nur ihr philosophisches Fachwissen, um ihre Advokatenrolle ausfüllen zu können, sondern auch Informationen über und ein Gefühl für die Lebenswelt ihrer Schülerinnen und Schüler. Die didaktische Kompetenz Fachwissen und Lebenswelt organisch zu verbinden findet sich im Prädikat „müssen […] anschlussfähig machen können“ ausgedrückt. Ihm fällt im obigen Zitat beinahe eine bloße Nebenrolle zu. Dieses Verbindungsmoment, welches die Relevanz der aktiven Vermittlung zwischen Fachwissen und Lebenswelt betont, soll hier aber im Vordergrund stehen.
Der moderne Philosophieunterricht bewegt sich, nach Bettina Bussmann, in einem Dreieck aus Problem-, Wissenschafts- und Lebensweltorientierung. Bussmann schreibt wörtlich, dass „[l]lebensweltliches, wissenschaftliches und philosophisches Wissen […] untrennbar miteinander verbunden“ sind. Ein Anlass zur philosophischen Arbeit in der Schule kann durchaus jedem einzelnen dieser Bereiche entspringen. Für gelungenen Unterricht, der seinen SuS sowie seinem Gegenstand gerecht wird, sollten diese drei sich aber gegenseitig befruchten: Alltägliche Fragen können wissenschaftlich durchdacht, wissenschaftliche Fragen philosophisch reflektiert und philosophische Fragen an Alltag und Wissenschaft zurückgebunden werden. Hierzu ist es notwendig ihre real existierenden Berührungspunkte aufzudecken und als Lernanlass nutzbar zu machen. Das Ausgehen von einem konkreten, nachfühlbaren Problem, wie z.B. einem moralischen Dilemma, zeigt bereits auf, inwiefern diese Kategorien sich gegenseitig enthalten: Problemorientierung kann nicht isoliert von Wissenschafts- und Lebensweltorientierung gedacht werden. Es ergeben sich aus den verschiedenen Perspektiven auf die identischen Probleme mehrere mögliche Antworten. Die für das Fach Philosophie oder Werte und Normen ergiebigen Problemsituationen oder Frageanlässe werden sich stets in Wissenschaft und Alltag finden. Schließlich benötigt die philosophische Arbeit einen Gegenstand, der ihr als Anlass dient.
Inhaltsverzeichnis
- Über die lebensweltlich-wissenschaftsbasierte Philosophiedidaktik
- Lebensweltorientierung als Ausgangspunkt für den Philosophieunterricht
- Der Bezug auf Lebenswelt und Wissenschaft im Unterricht
- Lebenswelt und Wissenschaft als komplexe Verbindung
- Die Bedeutung der Lebensweltorientierung in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text beleuchtet die Bedeutung einer lebensweltlich-wissenschaftsbasierten Philosophiedidaktik im Unterricht. Er argumentiert, dass die Verknüpfung von Fachwissen, Lebenswelt und wissenschaftlichen Erkenntnissen essenziell ist für einen gelungenen Philosophie- oder Werte und Normen-Unterricht. Der Text untersucht die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Integration dieser drei Elemente ergeben.
- Die Bedeutung der Lebensweltorientierung im Philosophieunterricht
- Die Verknüpfung von Fachwissen, Lebenswelt und wissenschaftlichen Erkenntnissen
- Die Herausforderungen und Chancen der lebensweltlich-wissenschaftsbasierten Philosophiedidaktik
- Die Rolle des Lehrers als Vermittler zwischen Fachwissen und Lebenswelt
- Die Notwendigkeit der Reflexion von Vorurteilen und Denkweisen in der Lebenswelt
Zusammenfassung der Kapitel
- Über die lebensweltlich-wissenschaftsbasierte Philosophiedidaktik: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und stellt den Anspruch der Philosophiedidaktik an die Lehrtätigkeit an Schulen vor. Es betont die Bedeutung der Verbindung zwischen Fachwissen und Lebensweltorientierung.
- Lebensweltorientierung als Ausgangspunkt für den Philosophieunterricht: Das Kapitel diskutiert die drei Eckpfeiler des Philosophieunterrichts - Problem-, Wissenschafts- und Lebensweltorientierung - und zeigt deren Wechselwirkungen auf. Es werden Beispiele für mögliche Unterrichtsanlässe aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gegeben.
- Der Bezug auf Lebenswelt und Wissenschaft im Unterricht: Dieses Kapitel untersucht die Herausforderungen, die sich aus der Verknüpfung von Lebenswelt und wissenschaftlichen Erkenntnissen im Unterricht ergeben. Es betont die Notwendigkeit, Vorurteile und Denkweisen zu reflektieren und die Relevanz des Themas für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen.
- Lebenswelt und Wissenschaft als komplexe Verbindung: Das Kapitel geht auf die enge Verflechtung von Lebenswelt und Wissenschaft ein und zeigt, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und neue Probleme und Diskurse hervorbringen.
- Die Bedeutung der Lebensweltorientierung in der Praxis: Dieses Kapitel verdeutlicht die Bedeutung der Lebensweltorientierung für die Planung und Durchführung des Unterrichts. Es betont die Notwendigkeit, die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler wirklich zu kennen, um ihren Interessen und Bedürfnissen gerecht zu werden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe des Textes sind Lebensweltorientierung, Wissenschaftsbasierte Philosophiedidaktik, Philosophieunterricht, Werte und Normen, Handlungskompetenz, Reflexionskompetenz, Problemorientierung, wissenschaftliche Erkenntnisse, Vorurteile, Denkweisen, Unterrichtgestaltung, Schülerinnen und Schüler. Der Text legt besonderes Augenmerk auf die Verknüpfung von Fachwissen, Lebenswelt und wissenschaftlichen Erkenntnissen im Unterricht und deren Bedeutung für die Entwicklung der Handlungs- und Reflexionskompetenz der Schülerinnen und Schüler.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Lebensweltorientierung“ im Philosophieunterricht?
Es bedeutet, philosophische Inhalte so aufzubereiten, dass sie an die konkreten Interessen, Erfahrungen und Probleme der Schüler anknüpfen.
Wie hängen Problem-, Wissenschafts- und Lebensweltorientierung zusammen?
Diese drei Bereiche befruchten sich gegenseitig: Alltagsfragen werden wissenschaftlich durchdacht und philosophisch reflektiert, um Vorurteile abzubauen.
Welche Rolle hat die Lehrkraft in diesem Didaktikmodell?
Lehrer agieren als „Anwälte der philosophischen Tradition“, die Fachwissen organisch mit der Lebenswelt der Jugendlichen verbinden müssen.
Warum ist die Reflexion von Vorurteilen im Unterricht wichtig?
Um philosophische Handlungs- und Reflexionskompetenz zu entwickeln, müssen die in der Lebenswelt existierenden Denkmuster kritisch hinterfragt werden.
Kann ein moralisches Dilemma als Ausgangspunkt dienen?
Ja, ein nachfühlbares Problem ist ein idealer Lernanlass, da es gleichzeitig Lebensweltbezug hat und wissenschaftliche Reflexion erfordert.
- Quote paper
- Felix Jeschonnek (Author), 2019, Über die lebensweltlich-wissenschaftsbasierte Philosophiedidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007991