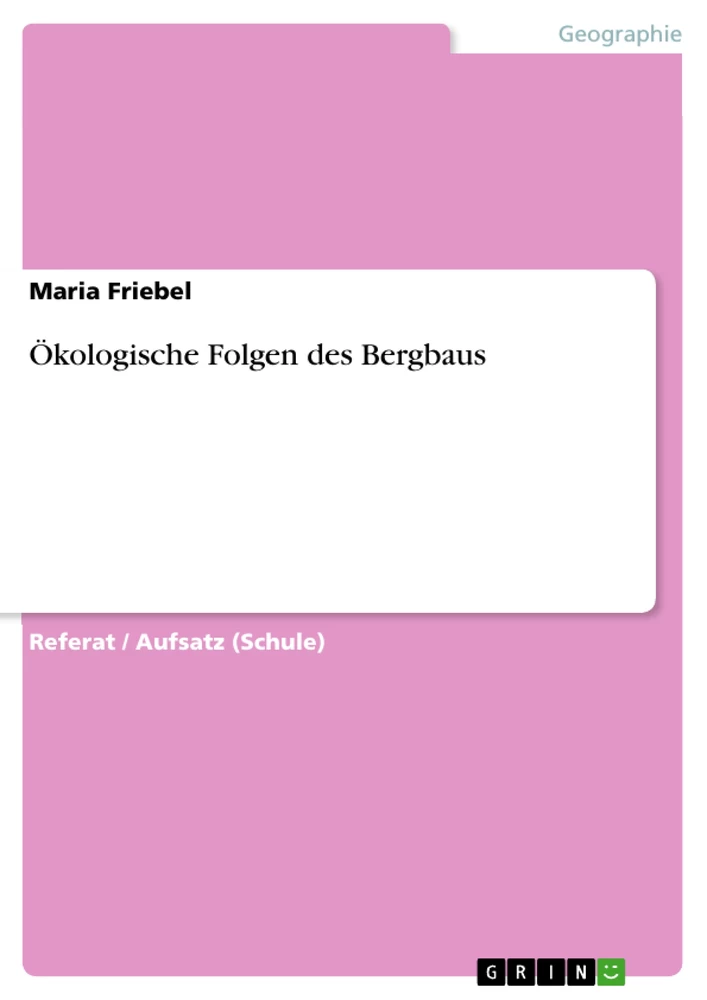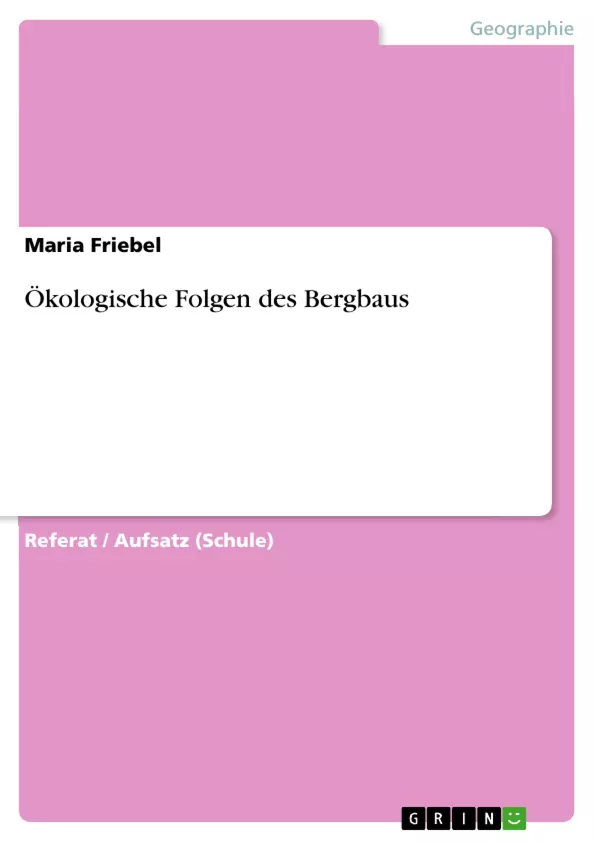*Einführung:
typ. Aufbau eines Tagebaus: → Bsp. für Braunkohletagebaue (Lausitz , Raum Halle-Leipzig-Bitterfeld, Rhein. BKR)
- riesige Schaufelradbagger
- kilometerlange und mehrere hundert Meter tiefe Gruben → wandern Schema Tagebau
- sofortige Auffüllung der ausgekohlten Teile mit Abraum
- Brunnen und Pumpen: Entwässerung der Tieftagebaue → verhindern, daß Gruben mit Grundwasser volllaufen (Entstehung von Tagebauseen) → Senkung des Grundwasserspiegels (ökologische Folgen!!!) Verwendung von Braunkohle:
- Strom- und Wärmequelle
*ökologische Folgen: starke Belastung der Umwelt; landschaftsprägend
→ konvergenz (Absenkung) - und subrosionsbedingte (Subrosion = durch Grundwasser unterirdisch erfolgende Auslaugung) Vorgänge
- Ablagerung des Abraums (Abraum = lockere Deckschichten aus Löß, Sand, Ton u. Kies) in Form v. Halden/ Kippen
- verbesserte Straßen- und Eisenbahninfrastruktur → Betonierung des Bodens
- Verödung der Landschaft, instabile Hänge → Erosion (Bodenverkrustung, Auslaugung)
- Setzung untertägiger Hohlräume (Senkung der Erdoberfläche) →Gefährdungspotential für Folgenutzung (Bebauung) ? zeitliche Unbestimmbarkeit der Schadensabläufe!!!
- Umsiedlung, Umverlegung bzw. Rodung von Flüssen, Wäldern, Dörfern
- Vernässung der bis in den Einflußbereich des Grundwassers abgesenkten Krater + Regenwasser → Entstehung von Tagebauseen mit stark saurem, versalztem Wasser
→ Entstehung durch:
+ natürliche Minerale aus Eisen und Schwefel (vom O2 abgeschlossen im Boden lagernd) = ungefährlich
+ durch Abpumpen des H2O: Kontakt der Eisen - Schwefel -Minerale mit dem O2 → schnelle Oxidation durch Bakterien
+ über verschiedene chemische Reaktionen u.a. auch durch Regen oder Grundwasser Entstehung von Säuren (H2SO4), Sulfaten, Eisen und anderen Spurenelementen
➔ stark saures, versalztes Wasser mit geringem O2-gehalt (keine organischen Organismen lebensfähig)
- oft auch keine geordnete Verkippung (stattdessen Auffüllung des durch den Tagebau entstandenen Loches mit ökonom. nicht nutzbaren Abbauprodukten oder aus Zeitmangel gar keine V.(Wende → abrupte Schließungen v.a. in Ostdtl.))
*Rekultivierung: Ziel: Folgenutzung (finanzierbar!)
+ landwirtschaftlich (Auftrag von Löß (Aufspülung oder Verkippung), Verbesserung des Bodens durch entsprechende landwirtschaftliche Anbaumethoden) →Erosionsschutz
+ forstwirtschaftlich (Abdeckung mit Gemisch aus Sand, Kies und Löß; Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern) → Naherholungsgebiete
- Renaturierung der sauren Seen durch Versumpfung oder Neutralisation:
Flutung der Tagebaulöcher mit neutralem Flußwasser (pH 7)
→ Verdünnung des sauren Wassers + Stabilisierung der steilen
Böschungen durch Anstieg des Wasserspiegels → Verbesserung der Wasserqualität durch Einsatz von eisen- und sulfatreduzierende Bakterien (anaerob): Schwefel, Eisen → Pyrit (ungefährlich)
(=> brauchen organ. Nahrung von z.B. abgestorbenen organ.
Organismen) → Zugabe einer Nährmischung + Umwälzung des H2O
- Verwahrung der Halden
- Verfüllung des Tagebaus
- Flutung der bergbaulichen Hohlräume mit Halbsole bzw. Kalisalzlösungen
- Begrünung von stark geneigten Böschungen → Erosionschutz ? Zu Erzbergwerken bzw. Urantagebauen:
- unterirdische Verunreinigung des Bodens durch die Rückstände beim Bergbau und toxischen Abfälle der bei der Extraktion verwendeten Substanzen (sickert ins Grundwasser) → gefährdetes Gesundheitsrisiko
- Rückstände der Aufbereitung in Absetzanlagen → Entsorgung der Giftschlämme
Häufig gestellte Fragen
Was ist der typische Aufbau eines Tagebaus?
Ein Tagebau besteht typischerweise aus riesigen Schaufelradbaggern und kilometerlangen, mehrere hundert Meter tiefen Gruben. Die ausgekohlten Teile werden sofort mit Abraum aufgefüllt. Brunnen und Pumpen entwässern die Tieftagebaue, um zu verhindern, dass die Gruben mit Grundwasser volllaufen. Diese Entwässerung führt jedoch zur Senkung des Grundwasserspiegels mit ökologischen Folgen.
Welche ökologischen Folgen hat der Braunkohletagebau?
Der Braunkohletagebau führt zu einer starken Belastung der Umwelt und prägt die Landschaft. Dies beinhaltet konvergenz- und subrosionsbedingte Vorgänge, die Ablagerung von Abraum in Form von Halden/Kippen, die Betonierung des Bodens durch verbesserte Infrastruktur, die Verödung der Landschaft, instabile Hänge durch Erosion, Setzung untertägiger Hohlräume, Umsiedlung von Flüssen, Wäldern und Dörfern sowie die Vernässung der Krater.
Wie entstehen Tagebauseen mit saurem, versalztem Wasser?
Tagebauseen entstehen durch die Vernässung der Krater mit Regenwasser und Grundwasser. Natürliche Minerale aus Eisen und Schwefel, die im Boden lagern, werden durch das Abpumpen des Wassers dem Sauerstoff ausgesetzt, was zur Oxidation durch Bakterien führt. Dies führt zur Entstehung von Säuren (H2SO4), Sulfaten, Eisen und anderen Spurenelementen.
Was bedeutet Rekultivierung und welche Ziele verfolgt sie?
Rekultivierung zielt darauf ab, eine Folgenutzung der Tagebauflächen zu ermöglichen, die finanzierbar ist. Dies kann landwirtschaftliche Nutzung (durch Auftrag von Löß und Verbesserung des Bodens), forstwirtschaftliche Nutzung (durch Abdeckung mit Gemisch aus Sand, Kies und Löß und Bepflanzung) oder Renaturierung der sauren Seen beinhalten.
Wie erfolgt die Renaturierung saurer Tagebauseen?
Die Renaturierung erfolgt durch Flutung der Tagebaulöcher mit neutralem Flusswasser, was zur Verdünnung des sauren Wassers und zur Stabilisierung der Böschungen führt. Zusätzlich kann die Wasserqualität durch den Einsatz von eisen- und sulfatreduzierenden Bakterien verbessert werden. Die Zugabe einer Nährmischung und die Umwälzung des Wassers unterstützen diesen Prozess.
Welche Probleme treten bei Erzbergwerken und Urantagebauen auf?
Bei Erzbergwerken und Urantagebauen kommt es zu unterirdischer Verunreinigung des Bodens durch Rückstände des Bergbaus und toxische Abfälle, die ins Grundwasser sickern und ein Gesundheitsrisiko darstellen. Die Rückstände der Aufbereitung in Absetzanlagen erfordern die Entsorgung der Giftschlämme. Radioaktive Gesteinsschichten müssen mit Isolierschichten abgedeckt werden, und giftige Gesteinsschichten müssen vom Grundwasser isoliert werden.
- Citation du texte
- Maria Friebel (Auteur), 2001, Ökologische Folgen des Bergbaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100817