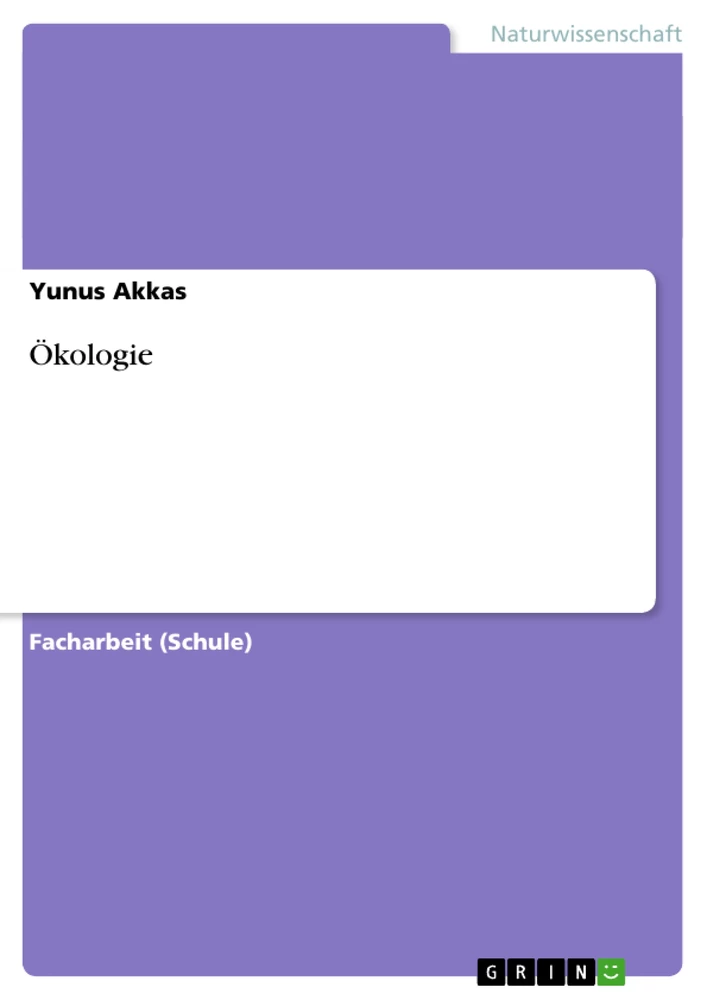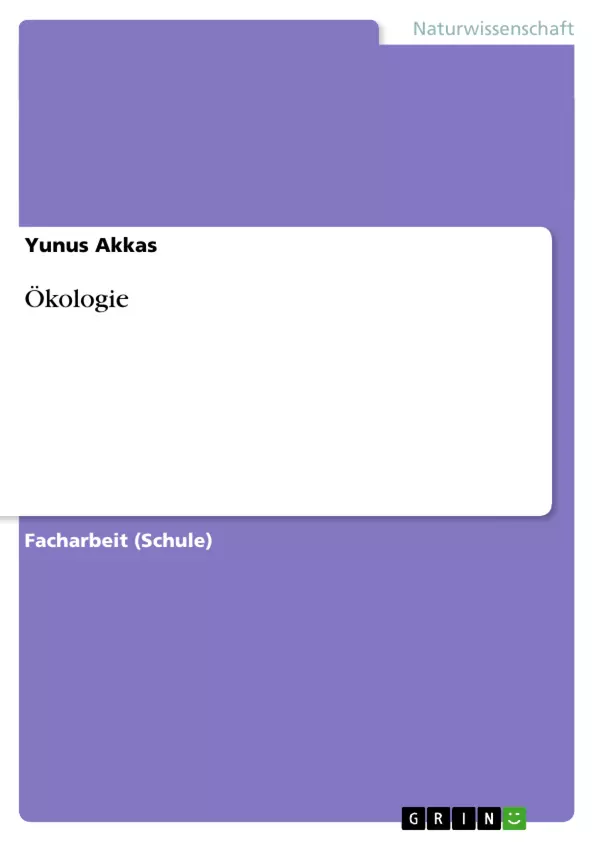Ökologie
1.) Definiere folgende Begriffe und nenne jeweils ein Bsp. !
a) biotische Unweltfaktoren
b) abiotische Umweltfaktoren
c) Biotop
d) Biozönose
e) Ökosystem
f) Ökologie
Zu a) biotische Umweltfaktoren: Abhängigkeit von Nahrung und Fressfeinden, Artgenossen.
Zu b) abiotische Umweltfaktoren: bestimmte Ansprüche an Klima, Boden -, Wasserbeschaffenheit, Oberflächengestalt.
Zu c) Biotop: ist ein natürlicher Lebensraum eines Lebewesens, der durch spezifische Eigenschaften bestimmt wird (Teich).
Zu d) Biozönose: Lebensgemeinschaften in einem Biotop.
Biotop und Biozönose stehen in Wechselwirkung zueinander.
Zu e) Ökosystem: Eine Einheit aus Lebensgemeinschaft und Lebensraum wie Biotop und Biozönose.
Zu f) Ökologie: Wissenschaft von Wechselwirkungen zwischen Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt.
2.) Beschreibe Abb.115.1 mit den unter Verwendung der Fachbegriffe (Vorzugsbereich, Optimum, Maximum, Minimum, Toleranzbereich /- Kurve ökologische Potenz)!
Zu 2)
In Abb.115.1, auf der Seite 115 (Orange Buch), wird eine Kurvendarstellung gezeigt. Auf der X-Achse des K.Systems werden Temperaturen von 37°C bis 45°C aufgezeigt und auf der Y-Achse kann man die Individuenzahl im Bereich von 0 - 60 ablesen. Es sind zwei Kurven vorhanden, die bei einem Experiment mit Käfern entstanden sind. Die Käfer wurden auf eine Fläche gesetzt, die unterschiedliche Temperaturen hatte. Dabei hielten sich die Käfer in einem Bereich auf, der für sie der Vorzugsbereich ist. Hier finden die Tiere Optimale Lebensbedingungen vor. Der Vorzugsbereich, auch Optimum genannt, liegt bei den Weiblichen Käfern bei 41°C und bei den männlichen Käfern bei 43°C. Je mehr die Temperatur vom Optimum abweicht, desto weniger Käfer halten sich in diesem Bereich auf. Das Maximum liegt bei 45°C und das Minimum bei den weiblichen Käfern bei 37° und bei den männlichen Käfern bei 40°. Die Tiere meiden diesen Maximum Bereich. Die Abweichung vom Optimum verschlechtert die Lebensbedingungen der Tiere, sie sind z.B. in ihrer Bewegungsaktivität, im Fortpflanzungserfolg oder in der Entwicklungsgeschwindigkeit eingeschränkt. Man spricht dabei (bei der Reaktionsfähigkeit) von der ökologischen Potenz eines Lebewesens.
3.) Erkläre den Unterschied zwischen stenopotent und eurypotent.
Zu 3)
Es gibt unterschiedlich weite „Toleranzbereiche“ !
- Die Tiere sind stenopotent, wenn sie einen engen Toleranzbereich haben.
- Arten, die große Schwankungen eines Umwelteinflusses ertragen, nennt man eurypotent.
Bsp.: - Der Karpfen verträgt keine hohe Salzkonzentration im Wasser, also ist er stenopotent !
- Die Scholle dagegen verträgt die Salzkonzentration im Wasser, sie ist somit eurypotent !
4.) Was besagen das Minimumgesetz und das Wirkungsgesetz der Umweltfaktoren ?
Zu 4)
- Das Wirkungsgesetz besagt, dass die Häufigkeit einer Art von dem Faktor bestimmt wird, der am weitesten vom Optimum entfernt ist.
- Das Minimumgesetz besagt, dass der Ernteertrag von dem Nährtsoff bestimmt wird, an dem es im Ackerboden am meisten mangelt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wechselwirkungen zwischen Organismen und Umwelt und zwischen Lebewesen untereinander.
Ökosystem
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Volterra Gesetze (aus Buch S.134)
Die Populationsschwankungen bei Luchs und Hase sind als Beleg für die Dynamik einer Räuber-Beute-Beziehung herangezogen worden, die sich aus mathematischen Modellen ergibt.
So hat der Mathematiker VOLTERRA schon um 1920 populationsbiologische
Berechnungen angestellt und als 1. VOLTERRAsches Gesetz formuliert :
Die Individuenzahlen von Räuber und Beute schwanken auch bei sonst konstanten Bedingungen periodisch. Dabei sind die Maxima der Populationsgrößen phasenweise verschoben. Derartige Modellberechnungen über Räuber-Beute-Beziehungen gehen davon aus, dass sich der Räuber nur von einer Beuteart ernährt und die Beute nur einen spezifischen Fressfeind hat.
Die periodischen Populaionsschwankungen ergeben sich dann aufgrund folgender Beziehung:
Vermehrung der Beute → Vermehrung des Räubers → Abnahme der Beute → Abnahme des Räubers → Zunahme der Beute → usw Dieser Rückkopplungsmechanismus führt zu einem regelmäßigen Auf und Ab der Individuenzahlen. Trotz der Schwankungen bleiben aber langfristig die Durschnittsgrößen der Populationen konstant; dies ist Inhalt des so genannten 2.VOLTERRAschen Gesetzes.
1.) Der Mungo wird hier zwischen den Riesenschlangen und den Kleinreptillien eingeordnet. Der Mungo ist ein Säugetier, und er ist ein Fleischfresser, da er sich von Kleinreptillien, Mäusen, Vögeln, Ratten und Kleinnagern ernährt.
2.) Nach dem Populationsanstieg des Mungos, also des fressers, veränderte sich der Populationsbestand der Beute (oben gennant) nach unten, da der Mungo diese Tiere auffraß. Dadurch das die Mungos die Tiere auffraßen die eigentlich die Insekten auffraßen, stieg der Populationsanteil der Insekten sehr stark an.
(Zu Arbeitsblatt 26)
1.) Als Population bezeichnet man die Gesamtheit aller Individuen einer Art oder einer Rasse in einem geographisch begrenzten Vebreitungsgebiet, wobei die Einzelindividuen untereinander unbegrenzt fortpflanzungsfähig sind.
(Zur Grafik)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4a.) Auf der waagerechten Skalla sind die Jahre von 1845 bis 1935 dargestellt und auf der senkrechten kann man die Anzahl der abgelieferten Felle ablesen. Die Schwankungen beider Populationen sind ausgeglichen, bis auf die Jahre 1865, 1935 und 1885, denn dort bekamen die Hasen einen überschuss an Population.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Allelophatie
Allel = Wechselseitig, gegenseitig Pathie= Leiden
Pflanzen schädigen andere Pflanzen durch Stoffwechselprodukte, z.B. ätherische Öle, Chinan -Verbindungen
Vorteil: Konkurrenz ausschließen.
Konkurrenzausschluss prinzip
Zwei Arten, die die selben Ansprüche an ihre Umgebung stellen, können nicht nebeneinander existieren.
Die unterlegene (=schlechter angepasste) Art wird von der anderen Art verdrängt.
→ Aussterben einer Art
→ Verdrängung in andere „Nischen“. (Konkurrenzverminderung→ „Kormorane“) (kurze Information über Kormorane) :
Kormorane, Familie Fisch fressender Wasservogelarten, die an Küsten der gemäßigten und tropischen Regionen der Erde in Kolonien nisten.
Hausaufgaben Buch (Orange) Seite:126
Wie schützen sich Beutetiere (tarnung, warnung, mimik)
- Bsp.: Hase → Erdfarbenes Fell verleiht ihm eine gute Tarnung. (od. Schneehase in Schneelandschaft).
- Unterschiedliche Schutztrachten wie: optische wirkende Eigenschaften: Farbe, Form und Bewegung.
- → Schutztrachten erhöhen die Überlebenschance → erhöhen somit die Fortpflanzung.
- Tarntracht → einfachste Form der Schutztracht
→ äußeres Erscheinungsbild ist der Umgebung angepasst.
→ erhöhtes Tarn vermögen: → Tiere die ihre Farbe wechseln können z.B.: Tintenfisch und Camäleon.
- besonders wirkungsvolle Form der Tarnung → liegt bei den Nachahmungstrachten:
→ Tiere die Gegenstände ihrer Umgebung nachahmen
→ Blätter werden häufig nachgeahmt z.B.: Tropische Heuschreckenart
- Schrecktracht: → aufällige körperzeichnungen, die fressfeinde abschrecken
- Warntracht: → warnt fressfeinde, dass diese Beute wehrhaft ist. (Erfahrung aus früheren Begegnungen).
- Scheinwarntracht: bezeichnet man als mimikry → Nachahmende Beute
→ z.B. zeigen die Schwebfliegen das Wespenfarbmuster zur täuschung der Räuber damit sie die Beute meiden, da sie aus früheren Erfahrungen Wespen meiden, meiden sie auch diese Beute.
- agressiver Mimikry: → nachahmende Tiere die Räuber sind.
→ Sie benutzen die nachahmung zur Täuschung der Beute (z.B.: Seeteufel).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zu Bsp.1):
(Symbiose)
Zu Bsp.2):
(Antibiose)
Zu Bsp.3):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mistel ist ein Halbparasit, da er selber noch Fotosynthese im eingeschränkten Umfang betreibt / durchführt.
Auswertung des Kressetests
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1.) Aktivkohle hemmt die Keimung, Vermutete Ursache: Feuchtigkeitsentzug (auch Schimmel benötigt Feuchtigkeit!)
2.) Nach 7.Tage ist keine Hemmung durch ätherische Öle festzustellen (Versuchsreihe 1).
Allerdings zeigt die Citrus - Probe eine Hemmung der Chlorophyllbildung. Dies könnte durch Citrus - Öle oder aber durch Stoffe, die der Schimmelpilz bildet, Verursacht sein (Phytozid wirkung).
Hausaufgabe (Arbeitsblatt 111 B lösen)
1.) - Bei höheren Temperaturen ist der gang vom Maulwurf tiefer im Boden (weiter von der Erdoberfläche entfernt).
- Bei niedrigen Temperaturen ist der Gang des Maulwurfes näher an der Erdoberfläche.
2.) Wenn der Maulwurf in Bewegung ist gibt er mehr Wärme ab bzw. nimmt er mehr Wärme auf, und Ruhezustand nimmt bzw. gibt er so wenig wärme wie möglich auf / ab.
- Gleichwarme Tiere können ihre Körpertemperatur aktiv regulieren
(=Fähigkeit zur Steuerung der Stoffwechselaktivität)
→ Säuger, Vögel
→ bei Kälte:
a) Wärmedämmung (=Verhinderungen der Auskühlung) → Fettschicht, Aufplustern, Fell
b) Bewegung (nur Sinnvoll bei energiereiche Nahrung)
c) Überwinterung in wärmeren Gebieten (Zugvögel)
d) Winterschlaf, Winterruhe (Stoffwechselreduktion, um Enrgie zu sparen).
→ Maßnahmen bei Hitze :
a) wenig Bewegung (wenig Stoffwechselwärme produzieren)
b) aufsuchen kühler Stellen (Schatten)
c) Schwitzen, Hecheln (Verdunstungskälte erzeugen)
außerdem: Änderung der Durchblutung prephirer Körperbereiche/ Haut
- bei Hitze: Erweiterung der Kapillaren (Haargefäße → dünnsten Blutgefäße)
- bei Kälte: Verengung der Kapillaren
- Wechselwarme Tiere, können ihre Körepertemperatur nicht aktiv regulieren,
d.h. sie wird allein durch die Umgebungstemperatur bestimmt.
→ Insekten, Fische, Amphibien, Reptilien ( alle Wirbellosen)
→ Überlebensstrategie : Aufenthalt in günstigen Temperaturbereichen ( Felsspalten, Eingraben in Schlamm)
„ Sonnen“, um den Stoffwechsel zu mobilisieren
- dunkle Körperoberfläche (Verbesserung der Absorption)
Energie
aufnahme
- helle, reflektierende Körperoberfläche (höhere Abstrahlung oder Reflektion)
Kälte- oder Wärmestarre
(Zusätzliche Informationen Über Ökologie aus Encarta)
ab hier Quelle: Encarta Enzyclopädie 98 !
Ökologie, Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen den Organismen untereinander und mit ihrer unbelebten und belebten Umgebung. Die unbelebte oder physikalisch-chemische Umgebung umfasst die Faktoren Licht und Wärme bzw. Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Wind, Zusammensetzung der Luft, vor allem den Gehalt an Sauerstoff und Kohlendioxid, sowie die vorhandenen Nährstoffe im Boden, im Wasser und in der Atmosphäre. Zur belebten oder biologischen Umgebung von einem Organismus gehören sowohl die Lebewesen der gleichen Art als auch diejenigen anderer Arten. Die Beziehungen beschränken sich nicht nur auf Pflanzen und Tiere, sondern umfassen auch Pilze, Bakterien, Viren und andere Einzeller.
Aufgrund der verschiedenen wissenschaftlichen Ansätze, mit denen man die Organismen in ihrer Umwelt studieren kann, bezieht die Ökologie ihre Informationen außer aus der Biologie auch aus Wissenschaftszweigen wie Klimatologie (siehe Klima), Hydrologie (Wasserkunde, siehe Wasser), Ozeanographie, Physik, Chemie, Geologie und der Bodenkunde (siehe Boden). Um die Wechselwirkungen zwischen Organismen zu studieren, nutzt die Ökologie außerdem Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung (siehe Verhalten von Tieren), Vegetationskunde (Lehre von der Zusammensetzung und Verteilung der Vegetation), Taxonomie, Physiologie, Biochemie und Statistik.
Je nach Ausgangspunkt der Betrachtung kann die Ökologie als Wissenschaft in mehrere Teilbereiche gegliedert werden. Gegenstand der Autökologie (Grundeinheit ist der Einzelorganismus) sind die Ansprüche des einzelnen Organismus an seine Umwelt; außerdem stehen die Beziehungen einer einzelnen Art zu den verschiedenen Umweltfaktoren im Mittelpunkt des Interesses. Im Gegensatz dazu untersucht die Synökologie (Grundeinheit ist die Lebensgemeinschaft) den gesamten Lebensraum, in dem die Bewohner auf vielfältige Art direkt oder indirekt miteinander verknüpft sind. Schwerpunkt der Populationsökologie (auch Demökologie genannt; Grundeinheit ist die Population) sind die Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Individuen der gleichen Art. Die früher gebräuchliche Trennung in Tierökologie und Pflanzenökologie ist aufgrund der Kenntnis der wechselseitigen Beziehungen zwischen beiden heute bedeutungslos geworden.
Immer wieder wurde die Öffentlichkeit vor allem in den letzten Jahren mit der weltweit zunehmenden Umweltzerstörung konfrontiert, die durch das Aussterben von Arten, die Abholzung der Regenwälder oder Phänomenen wie dem Waldsterben bemerkbar wird. Das daraus resultierende wachsende Umweltbewusstsein führte dazu, dass der Begriff Ökologie zwar bekannt ist, aber oft falsch verwendet wird. Häufig wird Ökologie etwa gleichgesetzt mit Umweltschutz (siehe Umwelt und Umweltschutz) oder Naturschutz. Beide Gebiete sind eng mit der Ökologie verbunden, die eine eigene wissenschaftliche Disziplin darstellt und deren Erkenntnisse die Grundlagen zur Klärung und zum Verständnis von Umweltproblemen liefern.
Der Begriff Ökologie wurde von dem deutschen Biologen Ernst Heinrich Haeckel erstmals 1866 verwendet; er ist abgeleitet von dem griechischen Wort oikos (Haus, Haushalt), hat also dieselbe Wurzel wie das Wort Ökonomie (im Sinne von Wirtschaftlichkeit). Der Begriff beinhaltet damit die Lehre vom Haushalt(en) der Natur. Die moderne Ökologie fußt zum Teil auf den Erkenntnissen von Charles Darwin, der Haeckel stark beeinflusste. Bei der Entwicklung seiner Evolutionstheorie betonte Darwin den Aspekt der Anpassung von Organismen an ihre Umwelt durch natürliche Selektion (natürliche Auslese). Einen wichtigen Beitrag lieferten auch Pflanzen- und Tiergeographen wie etwa Alexander von Humboldt, die das „Wie“ und „Warum“ der Pflanzen- bzw. Tierverteilung auf der ganzen Erde erforschten (siehe Pflanzenverbreitung; Verbreitungsgebiete von Tieren).1
Ökosysteme
Um die Ökologie eines bestimmten Lebensraumes zu verstehen, ist es sinnvoll, ihn als Ökosystem zu betrachten. Diesen abstrakten Begriff prägte 1935 der britische Pflanzenökologe Sir Arthur George Tansley. Gemeint ist damit die Vorstellung eines jeden Lebensraumes als zusammengehöriges, mehr oder weniger geschlossenes Ganzes. Ein System ist eine Zusammenfassung voneinander abhängiger Teile, die als Einheit funktionieren und sich in wechselseitigem Austausch befinden. Ein Ökosystem besteht aus mehreren Bestandteilen, den Produzenten (Grünen Pflanzen), den Konsumenten (Pflanzenfressern und Fleischfressern), den Destruenten (Reduzenten) bzw. Zersetzern (abbauenden Organismen wie Pilzen und Bakterien) sowie den nichtlebenden oder abiotischen Bestandteilen, also im Wesentlichen der toten organischen und anorganischen Materie, wie z. B. den im Boden und im Wasser vorhandenen Nährstoffen. Ein Ökosystem umfasst damit alle in einem bestimmten Lebensraum befindlichen Lebewesen und die sie umgebende, unbelebte Materie. Der Begriff Lebensraum kann dabei ganz unterschiedliche Dimensionen besitzen. Man kann einen bestimmten Wald damit meinen oder einen Abschnitt eines Flusslaufes, aber beispielsweise auch die Gesamtheit aller Wälder eines bestimmten Typs, etwa der borealen Nadelwälder, die gesamte Erde oder auch nur die nähere Umgebung der Wurzel eines bestimmten Baumes. In das Ökosystem gelangen von außen Sonnenenergie, Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid, Stickstoff sowie andere Elemente und Verbindungen (siehe Moleküle). Das Ökosystem bzw. die darin befindlichen Lebewesen wiederum entnehmen der Umwelt Nährstoffe, verändern die Zusammensetzung von Luft und Wasser und produzieren durch den Stoffwechsel Wärme, Wasser, Sauerstoff, Kohlendioxid und andere Ausscheidungsprodukte, die wiederum miteinander reagieren können.2
Energie und Nährstoffe
Ökosysteme benötigen zur Existenz Energie. Als Hauptenergiequelle fungiert meist die eingestrahlte Sonnenenergie. Weiterhin sind dazu Nährstoffe nötig, je nach Art des Ökosystems in sehr unterschiedlich großer Menge. Beide Faktoren, Energie und Nährstoffe, bewegen sich innerhalb eines Ökosystems in verschiedenen Kreisläufen. Durch die Aufklärung dieser Kreisläufe und ihrer Größenordnungen gewinnt man wichtige Erkenntnisse über die Funktion eines Ökosystems und kann dadurch außerdem verschiedene Ökosysteme unter unterschiedlichen Blickwinkeln miteinander vergleichen.
Die Pflanzen können die Sonnenenergie mit Hilfe der Photosynthese, bei der aus anorganischen Verbindungen organische geschaffen werden, in Form bestimmter chemischer, energiereicher Moleküle binden. Erst dadurch wird überhaupt Energie für die Lebewesen eines Ökosystems verfügbar. Pflanzen können im Durchschnitt nur etwa ein bis fünf Prozent der eingestrahlten Sonnenenergie in chemische Energie umsetzen. Diese chemische Energie wird von den Pflanzen genutzt, um Kohlenhydrate herzustellen, die sie zum Aufbau ihrer Zellen und als weitere Energielieferanten benötigen. Im Ökosystem wird die Energie von den Pflanzen über eine Reihe von Zwischenschritten an andere Organismen weitergegeben. Dies beinhaltet das Fressen und Gefressenwerden sowie die Tätigkeit von Parasiten und Zersetzern, die schließlich den abgestorbenen Pflanzenkörper wieder dem Boden zuführen. Insgesamt bezeichnet man dies als Nahrungsnetz, ein System untereinander verknüpfter Nahrungsketten. Die Lebewesen eines Ökosystems sind in ihrer Ernährung voneinander abhängig und bilden dabei diese Nahrungsketten.
Als pflanzliche Nahrungskette bezeichnet man diejenige, die bei den Pflanzen beginnt und über die Pflanzenfresser (Herbivoren) bis hin zu zwei oder drei verschiedenen Ebenen von Fleischfressern (Carnivoren) verläuft. Die Nahrungskette der abbauenden Organismen (Destruenten) beginnt dagegen mit der abgestorbenen pflanzlichen, tierischen oder sonstigen organischen Substanz. Beispiele dafür sind herabgefallene Blätter und Zweige, tote Wurzeln, Baumstümpfe, abgestoßene Tierhäute und Kadaver von Tieren. Von diesen Stoffen ernährt sich eine Vielzahl an Bakterien, Pilzen, Strahlenpilzen (siehe Prokaryonten) und Kleintieren, die wiederum von anderen Lebewesen gefressen werden. Beide Nahrungsketten sind auf komplexe Weise miteinander verbunden, denn durch die Tätigkeit der Destruenten entsteht letztlich Humus. Dieses von toten Tieren oder Pflanzen stammende organische Material benötigen wiederum die Pflanzen zum Wachstum. Geradlinige Nahrungsketten, wie sie eben dargestellt wurden, existieren nur selten, etwa in artenarmen Ökosystemen. Die tatsächlichen Verhältnisse werden z. B. durch das Vorhandensein von Parasiten oder so genannten Saprophagen (Tiere, die sich von toten oder verwesenden Tieren oder ihren Ausscheidungen ernähren) komplexer und weiter verfeinert, so dass die Vorstellung eines Nahrungsnetzes der Wirklichkeit deutlich näherkommt. In einer anderen Betrachtungsweise spricht man von einer so genannten Nahrungspyramide, die aus mehreren Ernährungs- oder trophischen Ebenen aufgebaut ist (siehe Nahrungsnetz). An der Basis dieser Pyramide stehen die Pflanzen, an der Spitze ein Fleischfresser wie der Tiger oder der Schwertwal, der selbst keine Feinde besitzt und daher ausschließlich eines natürlichen Todes - oder durch Krankheiten - stirbt. Insgesamt nutzt die Natur durch den Aufbau vielfältiger Nahrungsnetze in größtmöglichem Umfang die Energie, die ursprünglich von den Pflanzen gebunden wird.
Die Zahl der trophischen Ebenen ist in beiden Nahrungsketten begrenzt, weil bei jedem Übergang von einer Ebene zur nächsten der größte Teil der Energie verloren geht, vorwiegend durch die Atmung und andere Stoffwechselvorgänge, aber auch durch Wärmeverluste und verschiedene Ausscheidungsprodukte. Im Durchschnitt beträgt der Energieverlust bei jeder Stufe meist über 90 Prozent. Bezieht man sich auf die Vorstellung der Nahrungspyramide, enthält daher jede trophische Ebene stets weniger Energie als die jeweils vorhergehende, und der Energiegehalt nimmt von unten nach oben stark ab. Aus diesem Grund gibt es etwa mehr Hirsche und Karibus (Pflanzenfresser) als Wölfe oder Luchse (Fleischfresser).
Der Energiefluss treibt die verschiedenen biogeochemischen Kreisläufe oder Nährstoffkreisläufe an. Der Kreislauf der Nährstoffe beginnt mit ihrer Freisetzung aus organischer Materie durch die Zersetzung und ihrer Umwandlung in eine Form, die von den Pflanzen aufgenommen werden kann. Pflanzen nehmen die Nährstoffe auf, die im Boden und im Wasser (teilweise auch in der Luft) vorhanden sind und speichern diese in ihrem Gewebe. Von einer trophischen Ebene zur nächsten gelangen die Nährstoffe über das Nahrungsnetz zu verschiedenen Organismen und werden beim Absterben schließlich wieder freigesetzt. Pilze, Bakterien und andere Destruenten spalten die komplexen, organischen Verbindungen und wandeln sie in einfache, anorganische Verbindungen um, die den Pflanzen erneut zur Verfügung stehen.
Ungleichgewichte
Innerhalb eines Ökosystems durchlaufen Nährstoffe einen internen Kreislauf. Doch es gibt immer auch Verluste, die durch Neuaufnahmen ausgeglichen werden müssen, sonst funktioniert das Ökosystem nicht mehr. Nährstoffaufnahmen ins System erfolgen im Wesentlichen über die Verwitterung von Gesteinen, durch Staub, der vom Wind angeweht wird und durch Niederschläge, die darin gelöste Stoffe über große Strecken transportieren können. Verschiedene Mengen an Nährstoffen werden von Landökosystemen durch die Bewegung des Wassers ausgewaschen und in Wasserökosystemen oder tiefer liegenden Gebieten abgelagert. Erosion sowie das Fällen von Bäumen und die Ernte auf Äckern entziehen dem Ökosystem beträchtliche Mengen an Nährstoffen, die ersetzt werden müssen. Geschieht dies nicht, kommt es allmählich zu einer Verarmung, die auch Änderungen in der Artenzusammensetzung zur Folge hat. Aus diesem Grund müssen z. B. landwirtschaftlich genutzte Flächen immer wieder gedüngt werden, um einen gleich bleibenden Ertrag zu sichern (Dünger).
Die Umweltverschmutzung, die Verunreinigung von Luft, Wasser oder Boden, kann als einseitige Nährstoffzufuhr betrachtet werden. Häufig übersteigt diese nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit eines Ökosystems, sie zu verarbeiten, wobei die Schwellen je nach Art des Ökosystems und der betreffenden Nährstoffe sehr unterschiedlich sind. Überdüngung führt beispielsweise dazu, dass Nährstoffe ausgewaschen werden und ins Grundwasser sickern oder zusammen mit Abwässern und Industrieabfällen aus städtischen Gebieten in die Bäche, Flüsse und Seen und schließlich ins Meer gelangen. Die eingetragenen oder zugeführten Nähr- oder Schadstoffe können die Lebewesen eines Ökosystems direkt schädigen oder aber das Wachstum mancher Arten so stark anregen, dass sie schließlich andere Arten verdrängen. Dadurch werden insgesamt diejenigen Organismen begünstigt, die toleranter oder aber auch resistenter gegenüber den veränderten Bedingungen sind. Meist handelt es sich dabei um Arten, deren Individuenzahl ohnehin schon sehr hoch ist. Viele heutzutage seltene Arten sind dagegen stark spezialisiert auf bestimmte Bedingungen, daher anfälliger für Veränderungen und vermehrt vom Aussterben bedroht. Beispiele für direkt schädliche Stoffe sind die mit Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden angereicherten Abgase aus Industriegebieten (siehe Luftverschmutzung), die sich mit dem Wasser der Niederschläge in Schwefel- und Salpetersäuren umwandeln und den sauren Regen bilden. Dieser verändert das Verhältnis von Säuren und Basen in Land- und Meeresökosystemen. Fische und im Wasser lebende wirbellose Tiere können dadurch absterben; der Säuregehalt des Bodens kann ansteigen, insbesondere in Gebieten mit kalkfreiem Gestein (Kalk kann die Säure neutralisieren), und es kommt zu starken Veränderungen in der Zusammensetzung der Pflanzen- und Tierwelt. Siehe Kohlenstoffkreislauf; Stickstoffkreislauf.
Populationen und Lebensgemeinschaften
Die Funktionseinheiten eines Ökosystems sind die Populationen von Organismen. Eine Population ist eine Gruppe sich untereinander fortpflanzender Organismen derselben Art, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort leben (siehe Art). Die Angehörigen einer Population zeigen über mehrere Generationen hinweg genetisch ein hohes Maß an Kontinuität. Innerhalb eines Ökosystems reagieren Populationen und Gruppen von Populationen untereinander auf verschiedene Weise. Zusammen bilden sie die Lebensgemeinschaft, die den biotischen (belebten) Teil des Ökosystems ausmacht.
Artenvielfalt (Diversität)
Die gesamte Lebensgemeinschaft eines Ökosystems oder auch eine Gruppe verwandter Arten, die darin vorkommt - etwa alle Vögel oder alle Blütenpflanzen - haben Eigenschaften, die für das jeweilige Ökosystem charakteristisch sind. Zu diesen zählt vor allem die Dominanz und die Diversität (Artenvielfalt). Unter Diversität versteht man die Artenzahl der Gemeinschaft oder der betrachteten Gruppe. Weltweit gesehen nimmt die Diversität vom Äquator zu den Polen hin ab. Der Begriff Dominanz bezeichnet die relative Menge einer Art in einer bestimmten räumlichen Einheit im Vergleich zu den anderen dort lebenden Arten. Dominanz entsteht, wenn eine oder mehrere Arten die Umgebungsbedingungen kontrollieren und andere Arten stark beeinflussen. Sie kann sich z. B. aus längerer Lebensdauer, größerer Vermehrungsrate oder aggressiverem Verhalten ergeben. In einem Wald kann die dominante Art etwa aus einer oder mehreren Baumarten bestehen, beispielsweise Buche oder Fichte; in einer Meeresgemeinschaft sind die dominanten Organismen häufig Tiere wie bestimmte Muscheln oder Korallen. Abhängig von der Dominanz ist die Verteilung der Arten oder Äquitabilität. Diese ist ein Maß dafür, ob alle Arten etwa gleich häufig vorkommen (hohe Äquitabilität) oder nur einige wenige sehr häufig, während alle anderen Arten sehr selten auftreten (niedrige Äquitabilität).
Die physikalische Natur einer Gemeinschaft lässt sich durch die Schichtung oder Stratifikation beschreiben. In Landgemeinschaften wird die Schichtung durch die jeweilige Wuchsform der Pflanzen geprägt. Einfache Gemeinschaften wie Grasländer weisen in der Regel nur zwei Schichten auf, die Bodenschicht (in der sich z. B. die Moose befinden) und die Krautschicht. Ein Wald hat bis zu sechs Schichten: Boden, Krautschicht, erste und zweite Strauchschicht (niedrige und hohe Sträucher), untere Baumschicht und obere Baumschicht. Diese Schichtung beeinflusst die physikalische Umgebung (Schattenwurf, Luftfeuchte, Zusammensetzung des Lichtes usw.) und die Vielfalt des Lebensraumes für die Tierwelt. Je höher die Anzahl an Schichten, desto größer auch die Zahl an verschiedenen Lebensräumen, die den Tieren zur Verfügung stehen. Am vielfältigsten ist die Stratifikation in tropischen Regenwäldern. Dies führt dazu, dass in den äquatornahen Regionen die Artenvielfalt sehr hoch ist. Die vertikale Schichtung in Lebensgemeinschaften des Wassers ist im Gegensatz zu Landökosystemen größtenteils durch rein physikalische Bedingungen beeinflusst, etwa Lichteinfall, Temperatur, Druck, Salz-, Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt.
Lebensraum (Biotop) und ökologische Nische
Die Lebensgemeinschaft eines Ökosystems besiedelt einen bestimmten Lebensraum, den man als ihren Biotop bezeichnet. Damit ist nicht nur der tatsächliche Ort an sich gemeint, sondern auch die damit verbundenen, ganz spezifischen Umweltverhältnisse, die an ihm herrschen. Eng damit verbunden ist der abstrakte Begriff der ökologischen Nische. Darunter versteht man die Rolle, die eine Art innerhalb der Gemeinschaft spielt. Dies bezieht sich auf alle Lebensfunktionen, etwa auf die Art der Nahrung, wie diese Nahrung erworben wird, auf die Art und Weise, wie sich die Art fortpflanzt und welche Verhaltensweisen sie dabei ausübt, usw. So lebt beispielsweise der Baumläufer im Lebensraum Laubwald. Seine Nische besteht zum Teil darin, Insekten aus der Rinde von Bäumen zu fangen. Er verwendet dazu eine bestimmte Jagdmethode und besitzt ein spezielles Balzverhalten, das ihn von anderen Arten, die ebenfalls von Insekten aus Baumrinden leben, unterscheidet. Innerhalb eines Ökosystems gibt es zahlreiche ökologische Nischen, die von verschiedenen Organismen besetzt sind. Keine zwei Nischen sind jedoch exakt identisch, denn sonst müssten zwei verschiedene Arten dieselbe Lebenweise führen - dies widerspricht jedoch dem Begriff der Art. Je stärker eine Gemeinschaft geschichtet ist, desto feiner ist der Lebensraum in Nischen unterteilt.
Wachstum von Populationen
Populationen haben eine bestimmte Größe, die Populationsgröße (Anzahl der Individuen), die durch die Geburtenrate (die Anzahl an Nachkommen, die pro Populationseinheit innerhalb eines bestimmten Zeitraumes produziert wird), die Sterberate (die Anzahl der Sterbefälle innerhalb eines bestimmten Zeitraumes) sowie die Wachstumsrate (Zunahme der Population innerhalb eines bestimmten Zeitraumes) beeinflusst wird (siehe Bevölkerung). Die Bestimmung der jeweiligen Größen ist nicht immer einfach, vor allem wenn vegetative Vermehrung auftritt. Häufig sind etwa bei Pflanzen oder niederen Tieren die Tochterindividuen noch über bestimmte Organe mit dem Mutterorganismus verbunden, so dass allein die Abgrenzung eines Individuums Schwierigkeiten bereitet (siehe Populationsbiologie).
Bringt man eine kleine Population in eine günstige Umgebung mit einem Überfluss an Nahrung, so hat dies oft ein exponentielles Wachstum zur Folge. Dies ist häufig bei Populationen in frühen Stadien der Besiedlung eines Lebensraumes der Fall, entweder weil sie eine nichtgenutzte Nische übernehmen oder weil sie andere Populationen aus einer günstigen Nische vertreiben. Exponentiell wachsende Populationen erreichen jedoch rasch die Grenze der Nahrungsverfügbarkeit. Dann hört das Wachstum bald auf, und sie gehen in eine statische Phase über, in der die Populationsgröße gleich bleibt. Nach Ende dieser Phase nimmt sie schließlich wieder ab, sei es durch eine Katastrophe wie eine Hungersnot oder Krankheit, sei es durch Konkurrenz mit einer anderen Art, die sich um die gleiche Nahrung bemüht. Allgemein betrachtet sind exponentiell wachsende Populationen oft kurzlebig. Sie breiten sich schnell aus und sind besonders in der Lage, in Lebensräumen mit sich mehr oder weniger regelmäßig und stark verändernden Bedingungen zu gedeihen, etwa auf Ackerflächen, Kahlschlägen oder Schuttplätzen. Bei den Tieren sind dies häufig Arten, die zahlreiche Junge bekommen und nur wenig Brutpflege betreiben, bei den Pflanzen solche, die eine große Zahl an Samen mit geringen Nahrungsreserven produzieren. Solche Organismen nennt man opportunistische Arten.
Andere Populationen streben nach anfänglichem exponentiellem Wachstum ein Gleichgewicht zwischen ihrer Zahl und den verfügbaren Ressourcen an, das durch verschiedene Regulationsmechanismen erhalten bleibt. Tiere, die ein solches Populationswachstum zeigen, haben in der Regel weniger Junge und betreiben eine intensive Brutpflege, entsprechende Pflanzen bilden größere Samen mit beträchtlichen Nahrungsreserven. Diese Organismen sind langlebig, haben eine geringe Ausbreitungstendenz und können einen gestörten Lebensraum nur schwer besiedeln. Sie reagieren im Allgemeinen auf Veränderungen in der Populationsdichte (der Anzahl von Organismen pro betrachteter Fläche) mit Veränderungen der Geburten- und Sterberate und nicht durch vermehrte Ausbreitungstendenz (der Besiedlung neuer Lebensräume). Erreicht die Population die Grenzen der Nahrungsressourcen, sinkt die Geburtenrate, und die Sterblichkeit nimmt bei Jungen und Erwachsenen zu.
Wechselbeziehungen in der Gemeinschaft
Großen Einfluss auf das Populationswachstum haben verschiedene gegenseitige Beeinflussungen und Wechselbeziehungen (Interaktionen), die die Mitglieder der Gemeinschaft aufeinander ausüben bzw. eingehen. Dazu gehören der Wettbewerb, sowohl innerhalb einer Art als auch zwischen den Arten; Räuber-Beute-Beziehungen einschließlich des Parasitismus sowie die Symbiose.
Konkurrenz
Wenn eine gemeinsam genutzte Nahrungsgrundlage knapp wird, konkurrieren Organismen miteinander und die jeweils erfolgreicheren überleben. Innerhalb einiger Pflanzen- und Tierpopulationen teilen sich alle Individuen die Ressourcen derart, dass keines ausreichende Mengen erhält, um als ausgewachsenes Lebewesen wesentlich länger zu leben als die meisten anderen. In anderen Gemeinschaften beanspruchen dominante Individuen den Zugang zu den knappen Vorräten und schließen andere aus. Ausgewachsene Einzelpflanzen beanspruchen im Allgemeinen einen bestimmten Standort und behalten ihn so lange, bis sie an Lebenskraft verlieren oder von Krankheiten oder Schädlingen befallen werden und schließlich absterben. Bis dahin ist ihr Einfluss auf die unmittelbare Umgebung jedoch häufig so stark, dass andere Individuen nicht keimen oder überleben können, weil sie zu große Mengen an Licht, Feuchtigkeit und Nährstoffen entziehen. Auch ausgeschiedene, chemische Stoffe spielen dabei eine Rolle, die etwa die Keimung vermeiden können oder das Wurzelwachstum von Nachbarpflanzen hemmen.
Viele Tiergemeinschaften zeigen eine hoch entwickelte soziale Struktur, durch die die verfügbaren Ressourcen wie Raum, Nahrung und Geschlechtspartner unter den dominanten Mitgliedern der Population - also innerhalb der gleichen Art - aufgeteilt werden. Solche konkurrierenden Wechselbeziehungen können zu sozialer Dominanz führen, wodurch die dominanten Individuen die jeweils untergeordneten von der betreffenden Ressource ausschließen. Die Wechselbeziehungen können aber auch zu Revierverhalten führen, so dass dominante Individuen den Lebensraum in bestimmte Gebiete aufteilen, die nur sie bewohnen und die sie auch verteidigen. Untergeordnete oder ausgeschlossene Tiere sind dann gezwungen, in ärmeren oder weniger günstigen Bereichen des Ökosystems zu leben, teilweise auch ohne die jeweilige Ressource auszukommen oder das Gebiet ganz zu verlassen. Viele solcher Tiere sterben daher an Hunger oder Krankheiten oder fallen anderen Tieren zum Opfer.
Der Wettbewerb zwischen Mitgliedern verschiedener Arten führt zur Aufteilung der Ressourcen innerhalb einer Gemeinschaft. Verschiedene Pflanzenarten haben beispielsweise Wurzeln, die unterschiedlich tief in den Boden hineinreichen. Es bilden sich verschiedene Wurzelhorizonte heraus, was besonders in Wüsten und Steppengebieten auffällig ist. Gräser wurzeln z. B. recht flach, Sträucher und Bäume oder auch Kakteen dagegen tief, so dass beide Pflanzengruppen eine direkte Konkurrenz vermeiden und miteinander leben (koexistieren) können.
Räuber-Beute-Verhältnis
Eine der grundlegenden Beziehungen innerhalb von Lebensgemeinschaften sind die so genannten Räuber-Beute-Verhältnisse. Die räuberisch lebenden Organismen transportieren Energie und Nährstoffe von einer Nahrungsebene des Ökosystems zur nächsten, sie regulieren aber auch die Populationsgröße der Beutetiere und fördern die natürliche Auslese, indem schwache oder kranke Individuen aus der Population verdrängt werden. Die Anzahl der Beuteorganismen und der von ihnen abhängigen Räuber steht dabei in einem bestimmten Verhältnis, das um einen bestimmten Mittelwert schwankt - zumindest wenn es sich um eine einfache, direkte Abhängigkeit handelt. Räuber- und Beutepopulationen regulieren sich im Bestand gegenseitig und mit zeitlicher Verzögerung. So ist ein Hase ein Räuber, der Gras erbeutet, genauso wie der Fuchs ein Räuber ist, der Hasen erbeutet. Ein Übermaß an Pflanzenfressern beeinflusst direkt das Wachstum, die Überlebens- und Fortpflanzungschancen der Fleischfresser. Die Wechselwirkungen zwischen Räuber und Beute innerhalb einer Ebene der Nahrungspyramide hat somit unmittelbare Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen Räuber und Beute auf der nächsthöheren Ebene. In einigen Gemeinschaften können räuberische Tiere die Populationsgröße von Beutetieren so stark reduzieren, dass mehrere, eigentlich konkurrierende Arten nun nebeneinander koexistieren können, weil keine in so großer Zahl vorhanden ist, dass sie dominant wäre. Nehmen die Räuber jedoch stark ab oder werden entfernt, können nun dominante Arten die mit ihnen konkurrierenden verdrängen, wodurch die Artenvielfalt vermindert wird.
Parasitismus (Schmarotzertum)
Eng verbunden mit der Räuber-Beute-Beziehung ist das Schmarotzertum, bei dem zwei Organismen zusammenleben, wobei einer seine Nahrung auf Kosten des anderen bezieht.
Schmarotzer (Parasiten) sind überwiegend kleiner als ihr Wirt. Zu ihnen gehören viele Viren und Bakterien. Normalerweise töten Schmarotzer ihren Wirt nicht, wie es Raubtiere tun, denn sonst würden sie ihre Nahrungsquelle vernichten. Wirte und Parasiten entwickeln dagegen im Allgemeinen eine gewisse, gegenseitige Toleranz. Dennoch regulieren manche Parasiten die Größe ihrer Wirtspopulation, senken deren Fortpflanzungsrate und können ihre Verhaltensweisen ändern. Siehe Parasit; Parasitismus.
Symbiose
Eine weitere Beziehung zwischen Organismen einer Lebensgemeinschaft ist die Symbiose (Mutualismus), bei der zwei oder mehr Arten mehr oder weniger vollständig voneinander abhängen und nicht ohne einander leben können. Sind zwei Lebewesen völlig aufeinander angewiesen, so spricht man von obligatorischer Symbiose. Ein Beispiel dafür ist die Mykorrhiza (siehe Pilze: Ökologie), eine Beziehung zwischen Pilzen und den Wurzeln bestimmter Pflanzen. Bei einer bestimmten Form, der Ektomykorrhiza, bilden die Pilze eine Kappe oder einen Mantel über den Wurzelspitzen. Die Pilzfäden (Hyphen) dringen in die Wurzelspitze ein, wachsen zwischen den Zellwänden, erstrecken sich aber auch nach außen in den Boden. Sehr häufig findet man diese Form etwa bei Waldbäumen. Die Pilze hängen vom Baum als Energiequelle ab, denn sie erhalten von ihm lebenswichtige Kohlenhydrate und andere Stoffe. Im Gegenzug verhelfen die Pilze dem Baum zu einer deutlich besseren Aufnahme von Nährstoffen und Wasser aus dem Boden und schützen außerdem die Baumwurzeln vor bestimmten Krankheiten. Ohne die Mykorrhiza können einige Baumgruppen, wie z. B. Nadelbäume und Eichen, nicht überleben und wachsen. Umgekehrt können die Pilze nicht ohne die Bäume existieren. Im Unterschied zum Parasitismus profitieren beide Arten von der Beziehung.
(Zu Biotop)
Biotop, der und das, abgeleitet von griechisch bios (das Leben) und topos (der Ort), Lebensraum einer Lebensgemeinschaft (Biozönose) mit relativ einheitlichen Lebensbedingungen, der daher durch eine charakteristische Pflanzen- und Tierwelt - allgemein durch eine bestimmte Organismenzusammensetzung - gekennzeichnet ist.
Die räumliche Umgrenzung eines Biotops kann, je nach dem Zusammenhang und dem Blickwinkel, unter dem ein Biotop betrachtet wird, sehr unterschiedlich sein. So kann etwa ein bestimmtes Waldgebiet ein Biotop darstellen, das von Wiesen oder Ackerflächen umgeben und daher von diesen gut abgegrenzt ist. Dieser Wald zeichnet sich im Unterschied zur Umgebung durch eine charakteristische Tier- und Pflanzenwelt aus. Man kann den betrachteten Bereich aber auch auf einen einzelnen Baum dieses Waldstücks beschränken. Dieser spezielle Baum wird sich innerhalb des Waldstückes von den Nachbarbäumen etwa durch die auf seiner Rinde lebenden Moose, Flechten und Algen unterscheiden, sowie auch durch die spezielle Insektenfauna, die dort vorkommt.
Ebenso gut kann der Maßstab aber auch viel weiter gefasst sein und z. B. alle Wälder dieses Typs, etwa alle bodensauren Eichenwälder Mitteleuropas, oder alle Laub werfenden Wälder der gemäßigten Klimazone der Nordhalbkugel zusammenfassen und als einen bestimmten Biotop bezeichnen. Auch dieser, sehr umfassende Biotop hat dann eine spezifische Flora und Fauna, die ihn z. B. von Nadelwäldern der gleichen Region bzw. auf ebenfalls sauren Böden unterscheidet und abgrenzt.
Der Biotop ist also ein abstrakter Begriff, der für die Untersuchung von Ökosystemen eingeführt wurde und sich noch immer als sinnvoll erweist. Er umfasst als Lebensraum sowohl alle darin lebenden Organismen als auch seine gesamte abiotische Umwelt, vom spezifischen Boden dieses Gebietes bis hin zu seinem charakteristischen Klima und dessen für diesen „Ort“ typischen täglichen und jahreszeitlichen Schwankungen.
(Zu Biozönose)
Biozönose, Lebensgemeinschaft von Pflanzen und Tieren, die durch gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussung in Wechselwirkung zueinander stehen. Die Biozönose ist der biotische Anteil an einem Ökosystem, während der Lebensraum (Biotop) seinen abiotischen Teil darstellt (manchmal bezieht man in letzterem Begriff allerdings auch die Pflanzenwelt ein). Eine Biozönose ist z. B. die Gesamtheit aller Tiere und Pflanzen in einem Moor, See oder Wald. Tiergesellschaften und Pflanzengesellschaften ergeben die Biozönose, die ein selbstregulierendes System darstellt. Gekennzeichnet ist sie durch die Anzahl, die Abundanz und die räumliche Verteilung der vertretenen Arten. Von Thienemann wurden folgende Grundprinzipien einer Biozönose formuliert:
(1) Je vielfältiger die Lebensbedingungen des Biotops sind, umso größer ist die Artenzahl der Organismen.
(2) Eine Biozönose wird artenärmer und typischer, je weiter sie sich vom optimalen Bereich entfernt, die einzelnen Arten werden aber individuenreicher.
Häufig gestellte Fragen zur Ökologie
Was sind biotische und abiotische Umweltfaktoren?
Biotische Umweltfaktoren sind Einflüsse, die von anderen Lebewesen ausgehen, wie z.B. Abhängigkeit von Nahrung und Fressfeinden oder Artgenossen. Abiotische Umweltfaktoren sind nicht-lebende Einflüsse, wie z.B. Klima, Boden-, Wasserbeschaffenheit und Oberflächengestalt.
Was sind Biotop, Biozönose, Ökosystem und Ökologie?
Ein Biotop ist der natürliche Lebensraum eines Lebewesens, bestimmt durch spezifische Eigenschaften (z.B. ein Teich). Eine Biozönose ist die Lebensgemeinschaft in einem Biotop. Ein Ökosystem ist die Einheit aus Lebensgemeinschaft und Lebensraum, also Biotop und Biozönose zusammen. Ökologie ist die Wissenschaft von den Wechselwirkungen zwischen Lebewesen untereinander und zu ihrer Umwelt.
Was bedeuten Vorzugsbereich, Optimum, Maximum, Minimum, Toleranzbereich und ökologische Potenz?
Der Vorzugsbereich oder das Optimum ist der Bereich, in dem ein Lebewesen optimale Lebensbedingungen vorfindet. Maximum und Minimum sind die Grenzen des Toleranzbereichs, außerhalb derer das Lebewesen nicht überleben kann. Der Toleranzbereich ist der Bereich, in dem ein Lebewesen überleben kann. Die ökologische Potenz beschreibt die Reaktionsfähigkeit eines Lebewesens auf Umweltfaktoren.
Was ist der Unterschied zwischen stenopotent und eurypotent?
Stenopotente Lebewesen haben einen engen Toleranzbereich gegenüber einem bestimmten Umweltfaktor. Eurypotente Lebewesen haben einen breiten Toleranzbereich gegenüber einem bestimmten Umweltfaktor.
Was besagen das Minimumgesetz und das Wirkungsgesetz der Umweltfaktoren?
Das Wirkungsgesetz besagt, dass die Häufigkeit einer Art von dem Faktor bestimmt wird, der am weitesten vom Optimum entfernt ist. Das Minimumgesetz besagt, dass der Ernteertrag von dem Nährstoff bestimmt wird, an dem es im Ackerboden am meisten mangelt.
Was sind die Volterra-Gesetze?
Das 1. Volterra-Gesetz besagt, dass die Individuenzahlen von Räuber und Beute auch bei sonst konstanten Bedingungen periodisch schwanken, wobei die Maxima der Populationsgrößen phasenweise verschoben sind. Das 2. Volterra-Gesetz besagt, dass langfristig die Durchschnittsgrößen der Populationen konstant bleiben.
Was ist Allelopathie?
Allelopathie ist die Schädigung anderer Pflanzen durch Stoffwechselprodukte einer Pflanze (z.B. ätherische Öle oder Chinan-Verbindungen), um Konkurrenz auszuschließen.
Was besagt das Konkurrenzausschlussprinzip?
Das Konkurrenzausschlussprinzip besagt, dass zwei Arten, die die selben Ansprüche an ihre Umgebung stellen, nicht nebeneinander existieren können. Die unterlegene Art wird verdrängt oder muss in andere Nischen ausweichen.
Wie schützen sich Beutetiere?
Beutetiere schützen sich durch Tarnung (z.B. erdfarbenes Fell), Schutztrachten (Farbe, Form, Bewegung), Nachahmungstrachten (Mimikry), Schrecktracht, Warntracht oder Scheinwarntracht.
Was ist Mimikry?
Mimikry ist die Nachahmung von wehrhaften Tieren durch harmlose Arten (Scheinwarntracht) oder das Nachahmen von Beute durch Räuber (aggressiver Mimikry).
Was ist Symbiose?
Symbiose ist eine Form des Zusammenlebens verschiedener Arten, bei der beide Partner Vorteile haben.
Was ist ein Halbparasit (am Beispiel der Mistel)?
Ein Halbparasit ist ein Lebewesen, dass Photosynthese betreibt aber seine Nährstoffe aus dem Wirt nimmt. Die Mistel ist ein Halbparasit, da sie selbst Fotosynthese betreibt, aber Wasser und Mineralstoffe aus dem Baum bezieht, auf dem sie wächst.
Wie regulieren gleichwarme und wechselwarme Tiere ihre Körpertemperatur?
Gleichwarme Tiere können ihre Körpertemperatur aktiv regulieren (Säuger, Vögel) durch Wärmedämmung, Bewegung, Überwinterung in wärmeren Gebieten, Winterschlaf oder Winterruhe. Wechselwarme Tiere können ihre Körpertemperatur nicht aktiv regulieren (Insekten, Fische, Amphibien, Reptilien) und sind auf günstige Temperaturbereiche in ihrer Umgebung angewiesen.
Was sind Ökosysteme?
Ökosysteme sind zusammengehörige, mehr oder weniger geschlossene Einheiten, die aus Produzenten (Grüne Pflanzen), Konsumenten (Pflanzenfresser und Fleischfresser), Destruenten (Zersetzern) und abiotischen Bestandteilen (tote organische und anorganische Materie) bestehen.
Wie funktionieren Energie- und Nährstoffkreisläufe in einem Ökosystem?
Pflanzen wandeln Sonnenenergie durch Photosynthese in chemische Energie um. Diese Energie wird über die Nahrungskette an andere Organismen weitergegeben. Nährstoffe werden aus organischer Materie freigesetzt und von Pflanzen aufgenommen, gelangen über das Nahrungsnetz zu verschiedenen Organismen und werden beim Absterben wieder freigesetzt.
Was sind die Folgen von Umweltverschmutzung?
Umweltverschmutzung kann die Fähigkeit eines Ökosystems übersteigen, Nährstoffe zu verarbeiten, was zu Überdüngung, Auswaschung von Nährstoffen ins Grundwasser, Schädigung von Lebewesen, Verdrängung von Arten und Veränderungen in der Artenzusammensetzung führen kann.
Was sind Populationen und Lebensgemeinschaften?
Eine Population ist eine Gruppe sich untereinander fortpflanzender Organismen derselben Art, die zur gleichen Zeit am gleichen Ort leben. Eine Lebensgemeinschaft ist die Gesamtheit aller Populationen, die in einem Ökosystem interagieren.
Was sind Dominanz und Diversität?
Diversität ist die Artenzahl einer Gemeinschaft. Dominanz bezeichnet die relative Menge einer Art in einer bestimmten räumlichen Einheit im Vergleich zu den anderen dort lebenden Arten.
Was sind Lebensraum (Biotop) und ökologische Nische?
Der Lebensraum (Biotop) ist der Ort mit seinen spezifischen Umweltverhältnissen, an dem eine Art lebt. Die ökologische Nische ist die Rolle, die eine Art innerhalb der Gemeinschaft spielt, also ihre Lebensweise, Ernährung, Fortpflanzung und Verhalten.
Welche Wechselbeziehungen gibt es in einer Gemeinschaft?
Zu den Wechselbeziehungen gehören Konkurrenz, Räuber-Beute-Beziehungen, Parasitismus und Symbiose.
- Quote paper
- Yunus Akkas (Author), 2001, Ökologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/100819