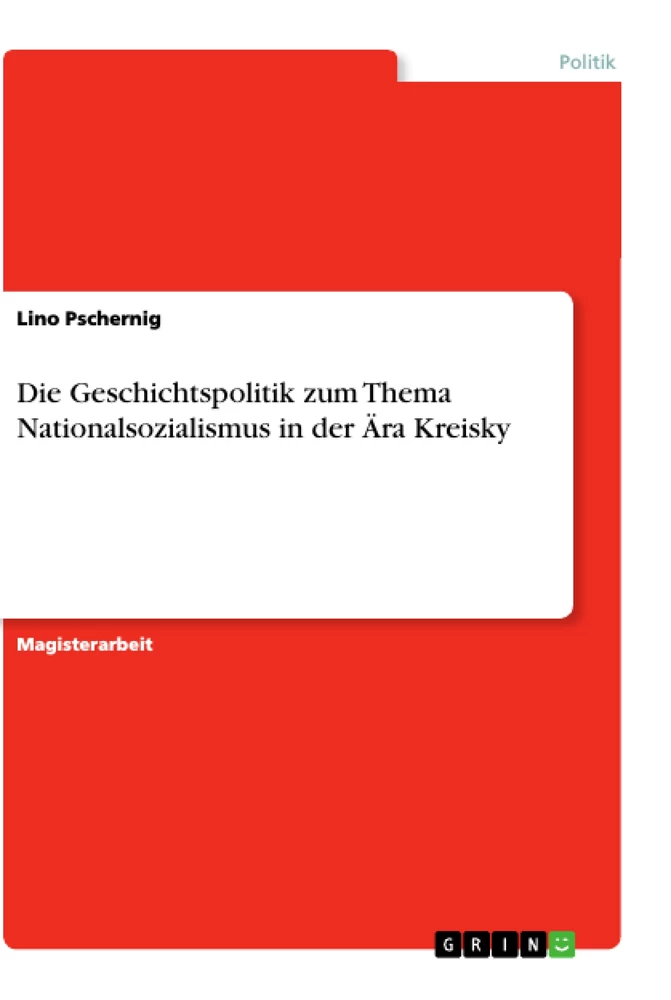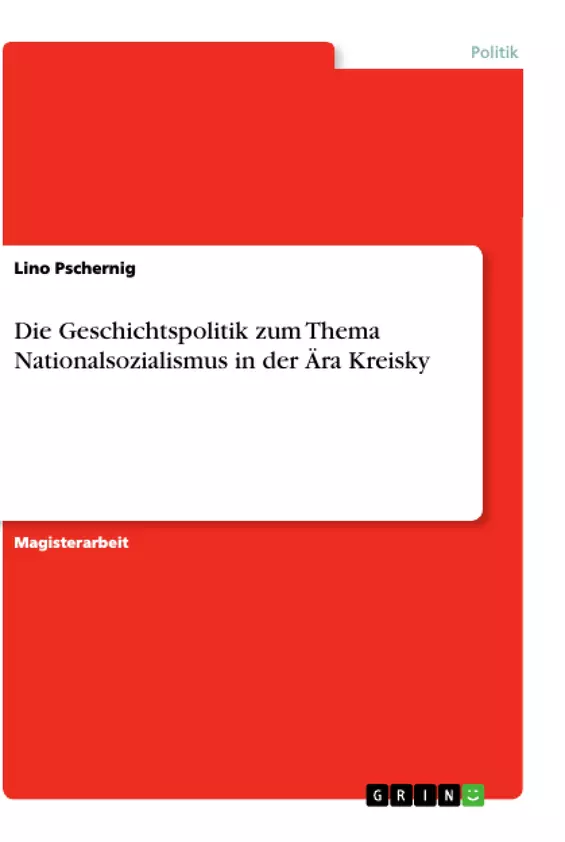In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, wie Geschichtspolitik vor allem von politischen Eliten samt ihren Institutionen ausgeht, die sich aufgrund ihrer privilegierten Stellung dazu im Stande sehen, in dubio abseits der Berücksichtigung wissenschaftlicher Korrektheit, historische Tatbestände nach opportunistischen Motiven auszulegen, sie gegebenenfalls zu instrumentalisieren sowie geschichtliche Ereignisse bewusst zu platzieren und identitätsstiftende Narrative zu erzeugen. Infolgedessen wird die Verhandlung der wechselseitigen Auslegungsvarianten von geschichtlichen Ereignissen innerhalb der österreichischen Erinnerungskultur umfassend diskutiert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt Österreich "als erstes Opfer" das "Sonderprivileg", die Jahre 1939-45 weitgehend hinter sich zu lassen und die "Stunde null" einzuläuten. Sie ebnete ein freies Feld zur Neuverhandlung identitätsstiftender Staatsnarrative. In der vorliegenden Arbeit geht es zu Beginn darum, die Rahmenbedingungen und Hintergründe dieser Neuauslegung der österreichischen Historie zu deuten und zu beleuchten. Dabei liegt der Fokus vor allem auf den vorangestellten geschichtspolitisch spezifischen Fragestellungen, nach Instrumentalisierung historischer Ereignisse, selektiver Geschichtsbetrachtung, sowie der Konstruktion konstitutiver und identitätsbekundender Narrative. Ebenso gilt es, mögliche Veränderungsprozesse und Aufweichungstendenzen geschichtspolitischer Mythen, mit Fokus auf das verzerrte Opferselbstbild, im Laufe der untersuchten Perioden zu erkunden.
Dabei wird versucht die spezifischen Ereignisse aus dem gegenwärtigen Blickwinkel auszuheben, und sie daraufhin im Bezugsrahmen ihres jeweiligen Entstehungskontexts zu verorten. Dahingehend bieten die vielschichtigen thematischen Exkurse eine breite Basis an Referenzen, um den historischen Zeitgeist des untersuchten Zeitraums qualifiziert zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition von Geschichtspolitik und Klärung alternativer Begriffe
- Vorhaben und Fragestellung
- Opfermythos als Staatsräson
- Die Rückkehr zur Selbstbestimmung
- Vom ,,Mythos der Lagerstraße“ zur Konsensdemokratie
- Nachkriegsjustiz und Reintegration der Nationalsozialisten
- Narrative
- Der Generationenwechsel und die frühen Anfänge der Zeitgeschichtsforschung in den 1960er Jahren
- Das Einsetzen eines Generationenkonflikts
- Die Suche nach dem „,anderen Österreich“
- Jedlicka, Steiner und Stadler. Die österreichische Zeitgeschichte und ihre zentralen Akteure
- Gerhard Botz und Erika Weinzierl als Wegbereiter einer kritischen Zeitgeschichtsforschung
- Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky. Zwei jüdische Persönlichkeiten im politischen Spannungsverhältnis. Ein biographischer Vergleich
- Simon Wiesenthal
- Bruno Kreisky
- Kreiskys geschichtspolitischer Zugang
- Die,,Wiesenthal-Affären“
- Die Regierungsangelobung 1970
- Die,,Kreisky-Wiesenthal-Peter-Affäre“
- Von der „Affäre Peter“ zur „Affäre Wiesenthal“
- Was verblieb?
- Österreichs diplomatische Beziehungen zu Israel vor dem Hintergrund von Kreiskys jüdischer Vergangenheit
- Die Außenpolitik als Kernstück der Kreisky-Politik
- Die geschichtspolitische Agenda im Bezug zur Nahostpolitik
- Abschlussbemerkungen
- Die justizielle (Nicht-)Verfolgung von NS-Straftätern
- Die Ära Broda
- Die Verjährungsfrist
- Eichmann und die innenpolitischen Folgen
- Das Ende der NS-Prozesse in den 1970er Jahren
- 1978 als markanter Wendepunkt?
- Bilanz
- Die Holocaustserie als „popularkulturelle[s] Schlüsselereignis“
- Reaktionen aus den Reihen der Politik
- Meinungsspiegel aus Umfrageerhebungen
- Pressespiegel
- Bildungspolitische Maßnahmen
- Bilanz und Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Geschichtspolitik zum Thema Nationalsozialismus in der Ära Kreisky. Sie untersucht die politischen und gesellschaftlichen Prozesse, die zur Auseinandersetzung mit der österreichischen NS-Vergangenheit geführt haben, und beleuchtet dabei die Rolle von Bruno Kreisky als politischer Akteur.
- Der Opfermythos als Staatsräson und die Bemühungen um die Rückkehr zur Selbstbestimmung
- Die Herausforderungen der Nachkriegsjustiz und die Reintegration von NS-Tätern
- Der Generationenwechsel und die Entwicklung der Zeitgeschichtsforschung in den 1960er Jahren
- Die Beziehung zwischen Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky und die „Wiesenthal-Affären“
- Österreichs diplomatische Beziehungen zu Israel im Kontext von Kreiskys jüdischer Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung definiert den Begriff der Geschichtspolitik und stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor.
- Kapitel 2 beleuchtet den „Opfermythos“ als Staatsräson und die damit einhergehende Rechtfertigung der österreichischen NS-Vergangenheit.
- Kapitel 3 untersucht die Bemühungen um die Rückkehr zur Selbstbestimmung und die damit verbundenen Debatten.
- Kapitel 4 analysiert den Übergang vom „Mythos der Lagerstraße“ zur Konsensdemokratie in Österreich.
- Kapitel 5 beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Nachkriegsjustiz und der Reintegration von NS-Tätern.
- Kapitel 6 betrachtet die Narrative, die im Kontext der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verwendet wurden.
- Kapitel 7 untersucht den Generationenwechsel und die frühen Anfänge der Zeitgeschichtsforschung in den 1960er Jahren.
- Kapitel 8 beleuchtet den biographischen Vergleich zwischen Simon Wiesenthal und Bruno Kreisky und ihre unterschiedlichen Positionen im Kontext der NS-Vergangenheit.
- Kapitel 9 analysiert Kreiskys geschichtspolitischen Zugang und die damit verbundenen Herausforderungen.
- Kapitel 10 untersucht die „Wiesenthal-Affären“ und ihre Auswirkungen auf die österreichische Politik.
- Kapitel 11 beleuchtet Österreichs diplomatische Beziehungen zu Israel vor dem Hintergrund von Kreiskys jüdischer Vergangenheit.
- Kapitel 12 analysiert die justizielle (Nicht-)Verfolgung von NS-Straftätern in Österreich.
- Kapitel 13 betrachtet das Jahr 1978 als markanten Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
- Kapitel 14 untersucht die Holocaustserie als „popularkulturelles Schlüsselereignis“ und die damit verbundenen Reaktionen in Politik, Gesellschaft und Medien.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der Geschichtspolitik, wie z.B. Opfermythos, Selbstbestimmung, Nachkriegsjustiz, Zeitgeschichtsforschung, Generationenkonflikt, Geschichtsbewusstsein, diplomatische Beziehungen, Nahostpolitik und NS-Vergangenheit. Dabei werden die komplexen Zusammenhänge zwischen Politik, Geschichte und Erinnerung sowie die Rolle von prominenten Persönlichkeiten wie Bruno Kreisky und Simon Wiesenthal beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Opfermythos“ in Österreich?
Es ist das Staatsnarrativ, nach dem Österreich das „erste Opfer“ des Nationalsozialismus war, was dazu diente, die eigene Mitverantwortung nach 1945 auszublenden.
Welche Rolle spielte Bruno Kreisky in der österreichischen Geschichtspolitik?
Als Bundeskanzler mit jüdischer Herkunft prägte er eine Politik der Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten und geriet darüber oft in Konflikt mit Simon Wiesenthal.
Worüber stritten Bruno Kreisky und Simon Wiesenthal?
Der Konflikt entzündete sich primär an Kreiskys Umgang mit Ministern mit NS-Vergangenheit (z. B. die Peter-Affäre) und Wiesenthals unermüdlicher Suche nach NS-Tätern.
Welche Bedeutung hatte die TV-Serie „Holocaust“ im Jahr 1978?
Die Serie wirkte als „popularkulturelles Schlüsselereignis“, das eine breite gesellschaftliche Debatte über die NS-Vergangenheit auslöste und den Opfermythos ins Wanken brachte.
Wie veränderte sich die Zeitgeschichtsforschung in den 1960er Jahren?
Ein Generationenwechsel und Akteure wie Erika Weinzierl und Gerhard Botz leiteten eine kritischere Auseinandersetzung mit der österreichischen NS-Geschichte ein.
- Citation du texte
- Lino Pschernig (Auteur), 2021, Die Geschichtspolitik zum Thema Nationalsozialismus in der Ära Kreisky, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1008654