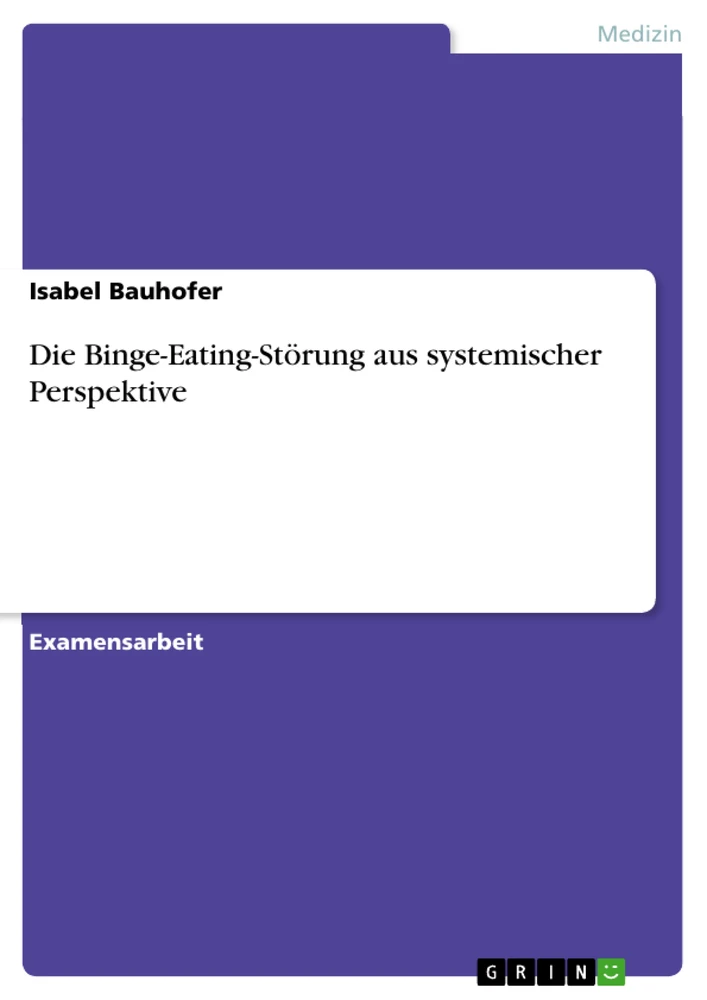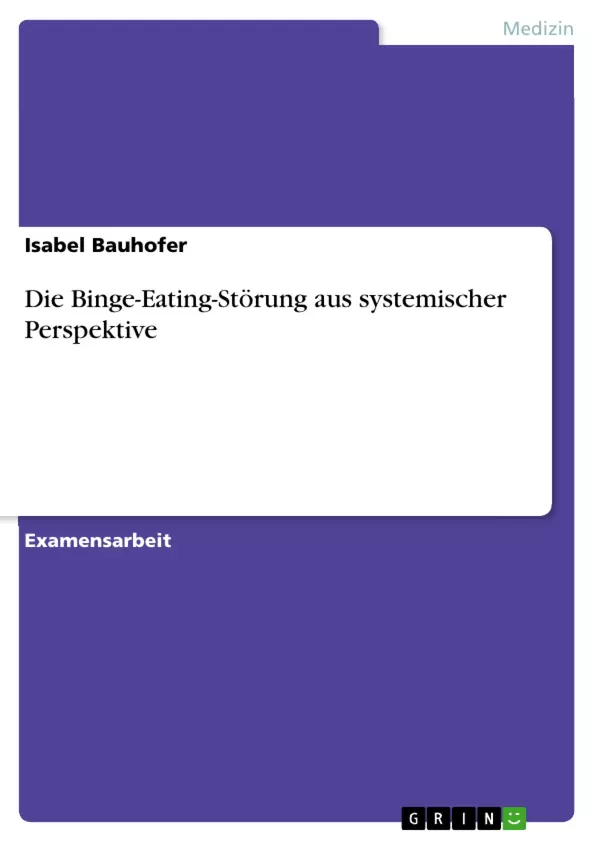Die systemische Therapie beschäftigt sich schon länger mit der Frage, ob sich bei Essstörungen um einen „Austragungsort“ für Schwierigkeiten in der Familie handeln könnte. Handelt es sich bei der Binge Eating Störung um Sehnsucht nach mehr Liebe und Anerkennung? Was sind weitere Risikofaktoren für die BES aus systemischer Sicht und wie ist die Verteilung dieser Risikofaktoren in der Bevölkerung? Neben der Magersucht und der Ess-Brech-Sucht wird immer mehr die Binge Eating Störung (BES) diagnostiziert. Während Magersüchtige nur noch wenig essen und bei der Ess-Brech-Sucht die Betroffenen unter Essanfällen und anschließendem Erbrechen oder Abführen leiden, werden von der Binge Eating Störung betroffene Personen von akuten „Fressanfällen“ gequält. Das englische Verb „binge“ bedeutet unter anderem „sich vollstopfen“. Korreliert diese Übersetzung stärker mit der Ursache der Störung als viele annehmen? Möchten Betroffene mit den „Essanfällen“ nur ein „inneres Loch“ stopfen?
Entweder zu dick oder zu dünn – noch nie gab es so viel Probleme mit dem Gewicht wie heutzutage, obwohl wir ein Überangebot an Nahrungsmitteln haben und über ein erforderliches Grundwissen gesunder Ernährung verfügen. Dass Essstörungen mit einem übertriebenen Schönheitsideal zusammenhängen würden, hören und sehen wir oft. Doch liegt das Problem eventuell tiefer?
Essstörungen zählen zu den häufigsten chronischen psychischen Störungen im Erwachsenenalter und die Zahl der daran leidenden Menschen wächst stetig. Mädchen beziehungsweise Frauen sind dabei über alle Essstörungen hinweg häufiger betroffen als Jungen beziehungsweise Männer. Meist erkranken junge Menschen an Essstörungen. Aber auch Menschen im mittleren oder höheren Lebensalter können an einer Essstörung erkranken. Oftmals tritt eine Essstörung nicht allein, sondern vielmehr als Mischform auf. Die Einflüsse, die zur Entstehung beitragen und auch die daraus resultierenden Folgen sind vielfältig. Überdies kann beobachtet werden, dass Essstörungen kulturabhängig sind. Ein Lebensmittelüberschuss und eine intensive Auseinandersetzung mit Essen scheinen eine Voraussetzung zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Hinführung zur Thematik und Forschungsfrage
- 1.2 Aufbau und Ziel der Arbeit
- 2. Grundlagen und Definitionen
- 2.1 Binge Eating Störung
- 2.2 Störungsbild und Klassifikation
- 2.3 Epidemiologie
- 2.3.1 Prävalenz
- 2.3.2 Verlauf
- 2.4 Ätiologie der Binge Eating Störung aus systemischer Sicht
- 2.4.1 Systemische Therapie
- 2.4.2 Beziehungsmuster
- 3. Methodischer Teil
- 3.1 Strukturbaum
- 3.1.1 Dimension Eins: Familie
- 3.1.2 Dimension Zwei: andere soziale Systeme
- 3.2 Halbstrukturiertes Interview
- 3.3 Untersuchung in der Praxis
- 3.3.1 Vorbereitung
- 3.3.2 Kontaktaufnahme
- 3.3.3 Durchführung
- 3.3.4 Analyse
- 3.3.5 Auswertung
- 4. Diskussion
- 4.1 Herausforderungen wissenschaftlicher Erhebungen
- 4.1.1 Objektivität
- 4.1.2 Reliabilität
- 4.1.3 Validität
- 4.2 Systemische Konzepte in Bezug auf die BES
- 4.2.1 Problemsystem
- 4.2.2 Lebensproblem
- 4.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Binge Eating Störung (BES) aus einer systemischen Perspektive, indem sie die Störung im Kontext sozialer Systeme wie Familie und andere Beziehungen betrachtet. Sie beleuchtet die Ursachen der BES, insbesondere die Rolle von Beziehungsmustern, die Einfluss auf die Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung haben können. Darüber hinaus untersucht die Arbeit, wie diese systemischen Konzepte in der Praxis genutzt werden können, um effektive Präventionsmaßnahmen zu entwickeln.
- Systemische Perspektive auf die Binge Eating Störung
- Einfluss von Beziehungsmustern in Familien und sozialen Systemen
- Prävalenz und Verlauf der Binge Eating Störung
- Entwicklung eines Strukturbaums zur Analyse von Risikofaktoren
- Potentielle Präventionsmaßnahmen für verschiedene soziale Systeme
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik und Forschungsfrage einführt und den Aufbau sowie das Ziel der Arbeit darlegt. Anschließend werden in Kapitel 2 die Grundlagen und Definitionen der Binge Eating Störung, ihre Klassifikation sowie die epidemiologischen Aspekte beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung der Ätiologie der BES aus systemischer Sicht und der Analyse von Beziehungsmustern. Kapitel 3 behandelt den methodischen Teil der Arbeit und beschreibt die Entwicklung eines Strukturbaums, der als Grundlage für ein halbstrukturiertes Interview dient. Die Interviewmethode wird erläutert und anhand eines konkreten Beispiels gezeigt, wie die Untersuchung in der Praxis durchgeführt werden kann. Schließlich wird in der Diskussion die Arbeit reflektiert und die Herausforderungen bei der Durchführung von wissenschaftlichen Erhebungen, wie die Objektivität, Reliabilität und Validität, betrachtet. In diesem Zusammenhang werden auch die systemischen Konzepte „Problemsystem“ und „Lebensproblem“ in Bezug auf die Binge Eating Störung diskutiert. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick, der mögliche Präventionsmaßnahmen aufzeigt, die auf den Ergebnissen der Untersuchung basieren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Binge Eating Störung, systemische Perspektive, Beziehungsmuster, Familie, soziale Systeme, Präventionsmaßnahmen, Problemsystem und Lebensproblem.
Häufig gestellte Fragen
Was charakterisiert die Binge-Eating-Störung (BES)?
Die BES äußert sich durch wiederkehrende Essanfälle ohne anschließende kompensatorische Maßnahmen wie Erbrechen, was sie von Bulimie unterscheidet.
Was bedeutet die systemische Perspektive auf Essstörungen?
Sie betrachtet die Störung nicht nur als individuelles Problem, sondern als Symptom für Schwierigkeiten oder gestörte Beziehungsmuster innerhalb der Familie.
Welche Rolle spielen soziale Systeme bei der Entstehung von BES?
Neben der Familie können auch Leistungsdruck in der Schule oder Schönheitsideale in anderen sozialen Gruppen als Risikofaktoren fungieren.
Was ist ein „Problemsystem“ in der systemischen Therapie?
Es bezeichnet die Gruppe von Personen, die um das Problem (die BES) herum kommunizieren und es ungewollt aufrechterhalten können.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der BES?
Frauen sind über alle Essstörungen hinweg häufiger betroffen, jedoch tritt die BES im Vergleich zu Magersucht auch vermehrt bei Männern auf.
- Quote paper
- Isabel Bauhofer (Author), 2021, Die Binge-Eating-Störung aus systemischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1009495