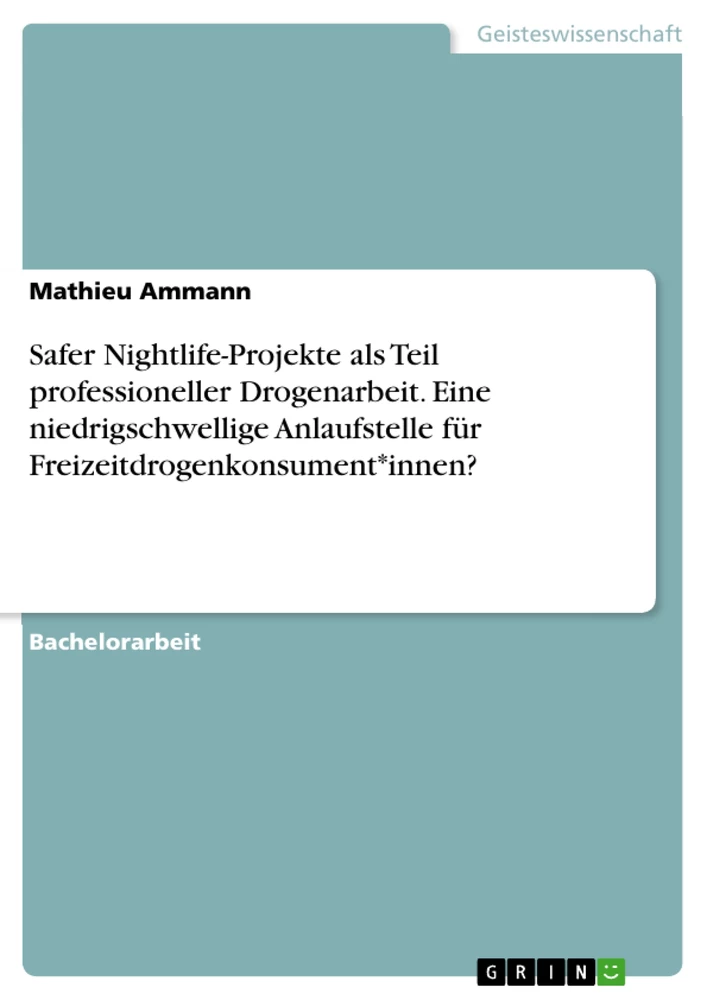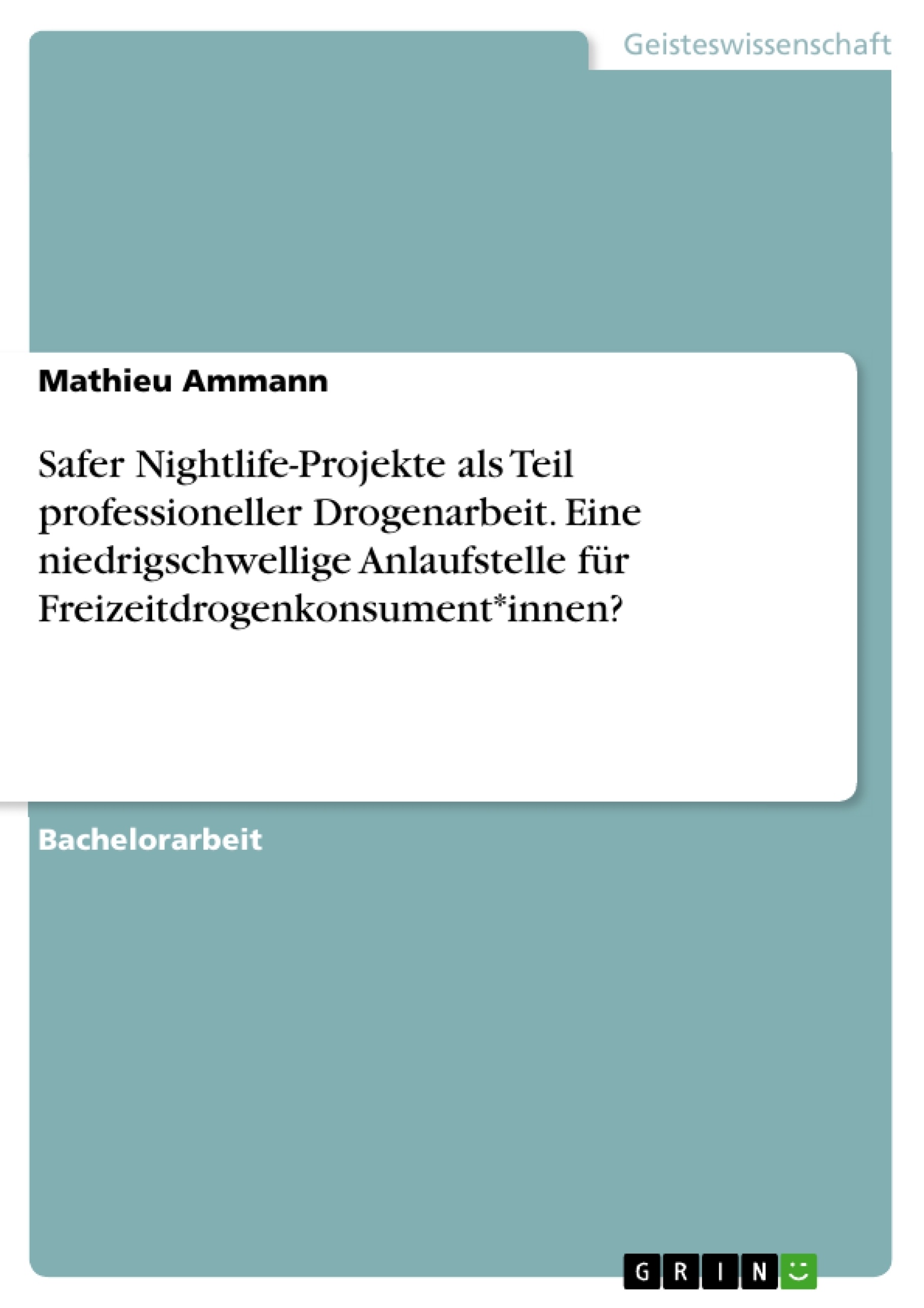Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Sozialarbeiter*innen für das Arbeitsfeld der akzeptierenden Drogenarbeit zu sensibilisieren und Chancen zu entdecken. Der Verfasser dieser Arbeit möchte die Möglichkeit darbieten, die Leser*innen über den Tellerrand dieses kontroversen Arbeitsfeldes schauen zu lassen, und möchte Interesse wecken, neue Wege zu gehen. Die Zielgruppe der Freizeitdrogenkonsument*innen soll in das Bewusstsein der Sozialarbeiter*innen hervorgehoben werden, um auf ihre Relevanz hinzuweisen und somit einen Schritt in die Richtung der Entwicklung der Präventionsarbeit für diese Zielgruppe zu tätigen. Des Weiteren sollen Sozialarbeiter*innen motiviert werden, sich mit den Thematiken Drogen, Rausch und Abhängigkeit kritisch auseinanderzusetzen. Ziel der Bachelorarbeit ist es, Sozialarbeitenden Wissen im Bereich der akzeptierenden Drogenarbeit zu vermitteln.
Dies soll dazu beitragen, die sozialarbeiterische Haltung zu fördern. Diese Abschlussarbeit möchte Sozialarbeiter*innen einen Einblick in die Methoden und Vorgangsstrategie eines Konzeptes akzeptierender Drogenarbeit gewähren, um das Verständnis und den Einstieg in dieses Arbeitsfeld zu erleichtern. Es soll verdeutlicht werden, dass eine Alternative zur abstinenzorientierten Drogenberatung notwendig ist, damit die Gesamtheit aller Drogenkonsument*innen erreicht werden kann. Dabei bietet die inhaltliche Vorstellung des Arbeitsfeldes akzeptierender Drogenarbeit die Grundlage für die Beantwortung der zweiten Fragestellung. Den primären Gegenstand der Arbeit bildet die Herausarbeitung von Möglichkeiten der Erstkontaktaufnahme für und zu Konsument*innen. Außerdem soll mit dieser Arbeit der Stigmatisierung von Drogenkonsument*innen in unserer Gesellschaft entgegengewirkt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Auswahl des Themas und persönliche Motivation
- 1.2 Fragestellungen
- 1.3 Ziele der Bachelorarbeit
- 1.4 Aufbau der Bachelorarbeit
- 2 Allgemeine und fachspezifische Definitionen
- 2.1 Drogen
- 2.2 Drogen in unserer Gesellschaft
- 2.2.1 Pharmazie
- 2.2.2 Justiz
- 2.2.3 Psychiatrie
- 2.2.4 Therapie
- 2.2.5 Medizin
- 2.2.6 Sicht der allgemeinen Bevölkerung
- 3 Drogenmündigkeit, Abhängigkeit und Sucht
- 3.1 Rausch
- 3.2 Das Verständnis von Sucht und Abhängigkeit
- 3.3 Drogenmündigkeit
- 3.4 Freizeitdrogenkonsum/ Recreational Drug-Use
- 4 Überblick über die professionelle Suchthilfe
- 5 Theoretische Grundlagen akzeptierender Drogenarbeit
- 5.1 Ausgangslage und Hintergründe des Arbeitsansatzes
- 5.2 Grundannahmen und Prämissen akzeptierender Drogenarbeit
- 5.3 Ziele akzeptierender Drogenarbeit
- 5.4 Formen akzeptierender Drogenarbeit
- 5.5 Grenzen akzeptierender Drogenarbeit
- 5.5.1 Persönliche und fachliche Grenzen
- 5.5.2 Institutionelle Grenzen
- 5.5.3 Gesetzliche Grenzen
- 6 Safer Nightlife-Projekte als Konzept akzeptierender Drogenarbeit
- 6.1 Der Peer-to-Peer-Ansatz
- 6.2 Aufgaben und Ziele
- 6.3 Gestaltung des Angebots im Partysetting
- 6.3.1 Besonderheiten des Angebots auf Festivals
- 6.3.2 Drug-Checking
- 7 Aufgaben für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht Safer Nightlife-Projekte als niederschwelliges Angebot akzeptierender Drogenarbeit für Freizeitdrogenkonsument*innen. Ziel ist es, Sozialarbeiter*innen für dieses Arbeitsfeld zu sensibilisieren und neue Wege aufzuzeigen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der hohen Dunkelziffer an Freizeitkonsum ergeben und wie akzeptierende Drogenarbeit dazu beitragen kann, diese Zielgruppe zu erreichen.
- Akzeptierende Drogenarbeit als Ansatz im Umgang mit Freizeitdrogenkonsum
- Herausforderungen bei der Erreichung von Freizeitdrogenkonsument*innen
- Safer Nightlife-Projekte als niederschwelliges Angebot
- Der Peer-to-Peer-Ansatz in der Drogenarbeit
- Rollen und Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext akzeptierender Drogenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation des Verfassers, sich mit dem Thema Safer Nightlife-Projekte auseinanderzusetzen, ausgehend von seiner Erfahrung in der Suchtberatung und ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie verdeutlicht die Diskrepanz zwischen der hohen Anzahl von Freizeitdrogenkonsument*innen und der geringen Inanspruchnahme von professioneller Suchthilfe. Die zentrale These der Arbeit, dass Safer Nightlife-Projekte einen niederschwelligen Zugang für diese Zielgruppe ermöglichen, wird formuliert, sowie die Forschungsfragen und Ziele der Arbeit dargelegt.
2 Allgemeine und fachspezifische Definitionen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Definitionen zu Drogen, ihrem gesellschaftlichen Kontext und den verschiedenen Perspektiven (Pharmazie, Justiz, Psychiatrie, Therapie, Medizin und öffentliche Meinung). Es schafft ein gemeinsames Verständnis der relevanten Begriffe und legt den theoretischen Rahmen für die spätere Auseinandersetzung mit akzeptierender Drogenarbeit fest.
3 Drogenmündigkeit, Abhängigkeit und Sucht: Dieses Kapitel befasst sich mit zentralen Konzepten wie Rausch, Sucht, Abhängigkeit und Drogenmündigkeit. Es differenziert zwischen experimentellem und problematischem Drogenkonsum und hebt die Bedeutung der Eigenverantwortung und der Prävention hervor. Der Fokus liegt auf dem Verständnis von Freizeitdrogenkonsum und den damit verbundenen Risiken.
4 Überblick über die professionelle Suchthilfe: Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über das bestehende System der professionellen Suchthilfe, seine Strukturen, Methoden und Ansätze. Es wird die abstinenzorientierte Sichtweise der traditionellen Suchthilfe beleuchtet und die Notwendigkeit von alternativen Ansätzen, wie der akzeptierenden Drogenarbeit, hervorgehoben.
5 Theoretische Grundlagen akzeptierender Drogenarbeit: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der akzeptierenden Drogenarbeit, inklusive ihrer Grundannahmen, Ziele, Formen und Grenzen (persönliche, institutionelle und gesetzliche). Es stellt die philosophischen und praktischen Überlegungen dar, die dieser Arbeitsweise zugrunde liegen und unterscheidet sie von anderen Ansätzen in der Drogenarbeit.
6 Safer Nightlife-Projekte als Konzept akzeptierender Drogenarbeit: Dieses Kapitel beschreibt Safer Nightlife-Projekte als ein Beispiel für akzeptierende Drogenarbeit. Es erklärt den Peer-to-Peer-Ansatz, die Aufgaben und Ziele dieser Projekte, sowie die Gestaltung des Angebots in Partysettings und auf Festivals. Der besondere Fokus liegt hier auf Drug-Checking und der niederschwelligen Beratung.
7 Aufgaben für die Soziale Arbeit: Dieses Kapitel skizziert die Rolle und die Aufgaben der Sozialen Arbeit im Kontext von Safer Nightlife-Projekten und akzeptierender Drogenarbeit. Es wird die Bedeutung der Sozialen Arbeit bei der Prävention, Beratung und Begleitung von Freizeitdrogenkonsument*innen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Safer Nightlife-Projekte, akzeptierende Drogenarbeit, Freizeitdrogenkonsum, niederschwellige Angebote, Peer-to-Peer-Ansatz, Drogenprävention, Suchthilfe, Soziale Arbeit, Drogenmündigkeit, Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Safer Nightlife-Projekte als akzeptierende Drogenarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht Safer Nightlife-Projekte als niederschwelliges Angebot akzeptierender Drogenarbeit für Freizeitdrogenkonsument*innen. Sie zielt darauf ab, Sozialarbeiter*innen für dieses Arbeitsfeld zu sensibilisieren und neue Wege aufzuzeigen, insbesondere im Umgang mit der hohen Dunkelziffer an Freizeitkonsum.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie akzeptierende Drogenarbeit, die Herausforderungen bei der Erreichung von Freizeitdrogenkonsument*innen, Safer Nightlife-Projekte als niederschwelliges Angebot, den Peer-to-Peer-Ansatz, und die Rollen und Aufgaben Sozialer Arbeit im Kontext akzeptierender Drogenarbeit. Sie umfasst auch allgemeine und fachspezifische Definitionen von Drogen und Sucht, sowie einen Überblick über die professionelle Suchthilfe.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, allgemeine und fachspezifische Definitionen, Drogenmündigkeit, Abhängigkeit und Sucht, Überblick über die professionelle Suchthilfe, theoretische Grundlagen akzeptierender Drogenarbeit, Safer Nightlife-Projekte als Konzept akzeptierender Drogenarbeit und Aufgaben für die Soziale Arbeit. Jedes Kapitel widmet sich einem spezifischen Aspekt des Themas.
Was sind die zentralen Ziele der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Sensibilisierung von Sozialarbeiter*innen für Safer Nightlife-Projekte als Ansatz der akzeptierenden Drogenarbeit. Die Arbeit soll neue Wege aufzeigen, um die Zielgruppe der Freizeitdrogenkonsument*innen besser zu erreichen und zu unterstützen. Ein weiterer Fokus liegt auf der Beleuchtung der Herausforderungen, die sich aus der hohen Dunkelziffer an Freizeitkonsum ergeben.
Was ist unter „akzeptierender Drogenarbeit“ zu verstehen?
Die Arbeit erläutert die theoretischen Grundlagen der akzeptierenden Drogenarbeit, ihre Grundannahmen, Ziele, Formen und Grenzen. Sie beschreibt sie als einen alternativen Ansatz zur traditionellen, abstinenzorientierten Suchthilfe.
Welche Rolle spielen Safer Nightlife-Projekte?
Safer Nightlife-Projekte werden als Beispiel für akzeptierende Drogenarbeit dargestellt. Die Arbeit beschreibt den Peer-to-Peer-Ansatz, die Aufgaben und Ziele dieser Projekte, sowie die Gestaltung des Angebots in Partysettings und auf Festivals, mit besonderem Fokus auf Drug-Checking und niederschwellige Beratung.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in diesem Kontext?
Die Arbeit skizziert die Rolle und Aufgaben der Sozialen Arbeit im Kontext von Safer Nightlife-Projekten und akzeptierender Drogenarbeit, mit Betonung der Bedeutung der Sozialen Arbeit bei Prävention, Beratung und Begleitung von Freizeitdrogenkonsument*innen.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Safer Nightlife-Projekte, akzeptierende Drogenarbeit, Freizeitdrogenkonsum, niederschwellige Angebote, Peer-to-Peer-Ansatz, Drogenprävention, Suchthilfe, Soziale Arbeit, Drogenmündigkeit und Abhängigkeit.
- Citar trabajo
- Mathieu Ammann (Autor), 2020, Safer Nightlife-Projekte als Teil professioneller Drogenarbeit. Eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Freizeitdrogenkonsument*innen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1010220