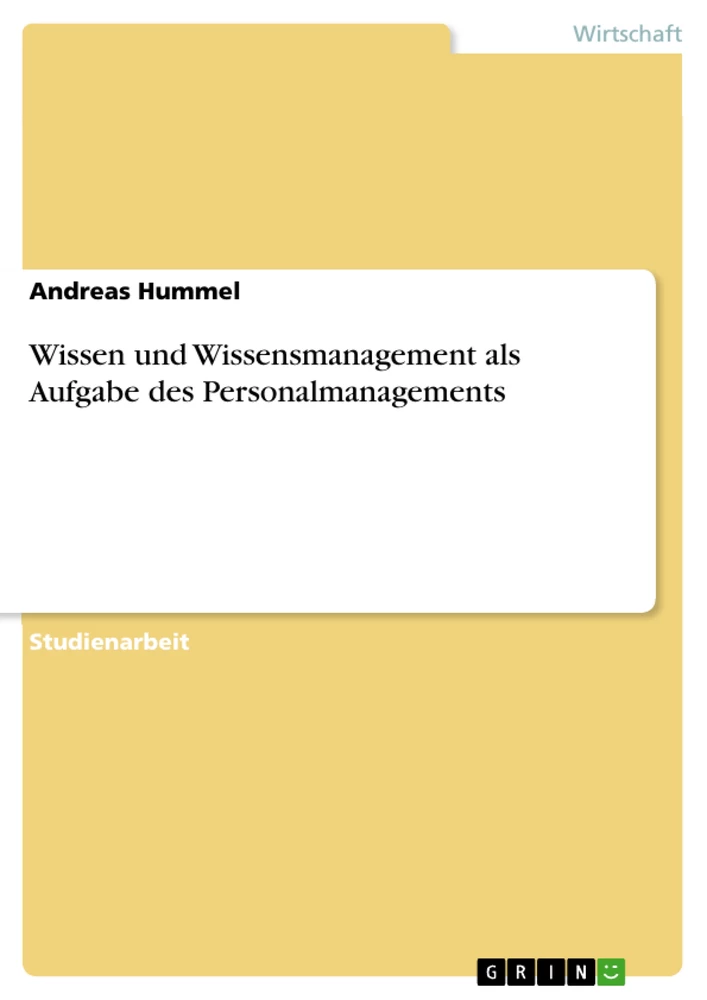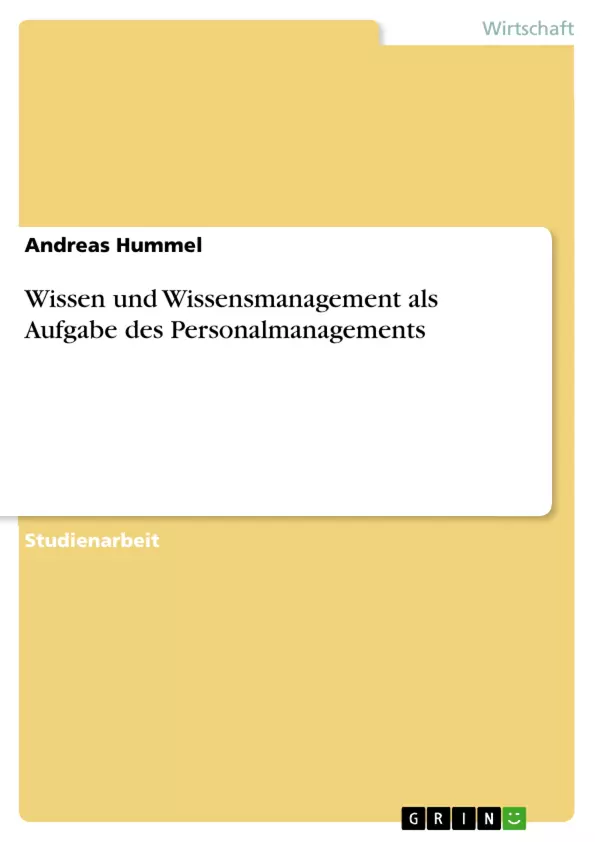Ziel dieser Arbeit ist es, die Begriffe Wissen und Wissensmanagement zu definieren und die Bedeutung des Personalmanagements in diesem Zusammenhang darzustellen. Hierzu werden im ersten Schritt zwei beispielhafte Modelle zum Thema Wissensmanagement vorgestellt. Diese Modelle werden in Folge aufgegriffen und analysiert, um die Bedeutung des Personalmanagements im Hinblick auf ein Wissensmanagement einer Organisation zu bestimmen.
In den letzten Jahren ist ein ganz klarer Trend des Wandels unserer Gesellschaft zur Wissensgesellschaft erkennbar. Wissensintensive Güter und Dienstleistungen gewinnen an Bedeutung und mit Ihnen das Management dieses Wissens. Das Wissensmanagement ist oder wird für jedes Unternehmen unverzichtbar. Denn je besser die Ressource Wissen verwaltet wird, umso besser kann die Organisation auf Veränderungen im Umfeld reagieren und global wettbewerbsfähig bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Zielsetzung
- Konzepte und Methoden des Wissensmanagements
- Das Münchner Modell nach Rheinmann-Rothmeier
- Wissen im Münchner Modell
- Wissensmanagement im Münchner Modell
- Bausteine des Wissensmanagements nach Probst/Raub/Romhardt
- Rolle und Bedeutung des Personalmanagement im Wissensmanagement
- Ergebnis und kritische Betrachtung
- Literatur- und Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Wissensmanagement und untersucht die Rolle des Personalmanagements in diesem Kontext. Sie definiert die Begriffe "Wissen" und "Wissensmanagement" und analysiert die Bedeutung des Personalmanagements für ein effektives Wissensmanagement in Unternehmen.
- Definition von Wissen und Wissensmanagement
- Analyse von Modellen des Wissensmanagements
- Bedeutung des Personalmanagements für das Wissensmanagement
- Die Bedeutung des Wissensmanagements für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
- Die Bedeutung des Wissens als Ressource in der modernen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort und Zielsetzung: Dieses Kapitel legt die Grundsteine der Arbeit, indem es die Relevanz von Wissen in der heutigen Wirtschaft beschreibt und die Ziele der Arbeit darlegt.
- Konzepte und Methoden des Wissensmanagements: Hier werden zwei Modelle zum Thema Wissensmanagement vorgestellt, das Münchner Modell von Rheinmann-Rothmeier und die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst/Raub/Romhardt. Diese Modelle dienen als Grundlage für die Analyse der Rolle des Personalmanagements.
- Rolle und Bedeutung des Personalmanagements im Wissensmanagement: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Personalmanagements für das Wissensmanagement und stellt die Verbindung zwischen den beiden Bereichen her.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Personalmanagement, Wissensgesellschaft, Münchner Modell, Rheinmann-Rothmeier, Probst/Raub/Romhardt, Handlungswissen, Informationswissen, Lernende Organisation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit zum Wissensmanagement?
Ziel ist es, die Begriffe Wissen und Wissensmanagement zu definieren und die spezifische Bedeutung des Personalmanagements für den Erfolg von Wissensmanagement-Systemen in Organisationen aufzuzeigen.
Welche Modelle des Wissensmanagements werden analysiert?
Die Arbeit untersucht zwei wesentliche Modelle: das Münchner Modell nach Rheinmann-Rothmeier und die Bausteine des Wissensmanagements nach Probst, Raub und Romhardt.
Warum ist Wissensmanagement für moderne Unternehmen unverzichtbar?
Wissensmanagement sichert die globale Wettbewerbsfähigkeit, da Unternehmen durch eine bessere Verwaltung der Ressource Wissen schneller auf Veränderungen im Umfeld reagieren können.
Welche Rolle spielt das Personalmanagement im Wissensmanagement?
Das Personalmanagement ist zentral für die Förderung einer lernenden Organisation und stellt die Verbindung zwischen individuellen Kompetenzen und dem organisatorischen Wissenserhalt her.
Was wird unter dem Begriff "Wissensgesellschaft" verstanden?
Es beschreibt den gesellschaftlichen Wandel, bei dem wissensintensive Güter und Dienstleistungen sowie das Management dieses Wissens zur primären wirtschaftlichen Grundlage werden.
- Quote paper
- Andreas Hummel (Author), 2021, Wissen und Wissensmanagement als Aufgabe des Personalmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1010564