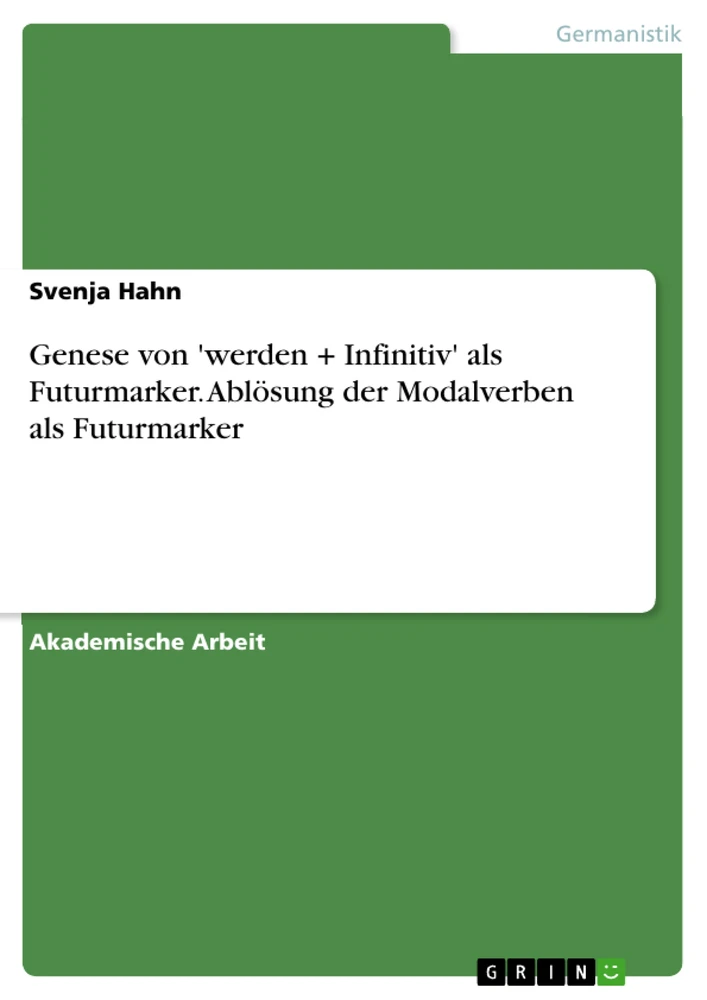Die Verbkategorie 'werden' erweist sich als Chamäleon des deutschen Verbsystems und ist Anlass zahlreicher Theorien um seine Entstehung als Futurgrammem. Diese Arbeit thematisiert Theorien um seine Entstehungsgeschichte und skizziert die historische Abfolge. Im Anschluss folgt eine Korpusanalyse, die die konstruktionelle Variabilität von 'werden' genauer untersucht. Aus synchroner Sicht übernimmt 'werden' nicht nur die Funktion als Auxiliar in verschiedenen Hilfsverbkonstruktionen wie beispielsweise Passiv, Konjunktiv oder Futur, sondern kann auch als inchoatives Kopulaverb, epistemisches Modalverb oder selten auch als Vollverb auftreten.
Dieser Funktionsreichtum von 'werden' ist zugleich auf einen wichtigen Prozess des Sprachwandels zurückführbar, die sogenannte Grammatikalisierung. Darunter versteht man den Prozess der Entstehung und Weiterentwicklung grammatischer Morpheme bis hin zu ihrem Untergang. Das Verb 'werden' war gleich bei mehreren Grammatikalisierungsvorgängen beteiligt. Betrachtet man die grammatischen Funktionen von 'werden', wird schnell ersichtlich, dass das polyfunktionale und polysemantische Verb ein Produkt der Polygrammatikalisierung ist.
So diente das althochdeutsche 'werdan' als Spenderlexem für zahlreiche unterschiedliche grammatikalische Kategorien, Klassen und Konstruktionen, die über Sprachperioden hinweg gewachsen und entstanden sind. Besonders die Genese von 'werden + Infinitiv' als analytische Tempuskategorie stellt dabei einen wichtigen und zugleich undurchsichtigen Abschnitt in der Geschichte der Grammatikalisierung als Futurgrammem dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung: werden + Infinitiv als „Streitpunkt“ der Linguistik
- 2. Forschungsüberblick zur Entstehung von werden + Infinitiv als Futurmarker
- 3. Zur Geschichte des Futurs im Deutschen
- 4. Korpusgestützte Untersuchung zur Ablösung der Modalverben als Futurmarker
- 4.1. Die Fragestellung
- 4.2. Methodik und Korpora
- 4.3. Korpusuntersuchung
- 5. Zur Subjektivierung in der Grammatikalisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Genese von „werden + Infinitiv“ als Futurmarker im Deutschen. Sie beleuchtet die Entstehung dieser Konstruktion im Kontext der Grammatikalisierung des Verbs „werden“ und analysiert die Ablösung der Modalverben als Futurmarker durch die „werden + Infinitiv“-Konstruktion. Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Theorien zur Entstehung des periphrastischen Futurs und evaluiert diese anhand von korpuslinguistischen Daten.
- Grammatikalisierung des Verbs „werden“
- Entwicklung des Futurs im Deutschen
- Ablösung der Modalverben durch „werden + Infinitiv“
- Korpuslinguistische Analyse der Konstruktion
- Analogiebildungen in der Sprachentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: werden + Infinitiv als „Streitpunkt“ der Linguistik: Die Einführung stellt das Verb „werden“ als vielschichtiges Element des deutschen Verbalsystems vor und betont seine Rolle in verschiedenen grammatischen Funktionen. Sie hebt die Bedeutung der Grammatikalisierung hervor und bezeichnet die Genese von „werden + Infinitiv“ als Futurmarker als einen wichtigen und komplexen Forschungsgegenstand, der von Linguisten unterschiedlich bewertet wird. Die Arbeit fokussiert auf die Analogietheorie als vielversprechenden Erklärungsansatz, der althochdeutsche Infinitivkonstruktionen als Grundlage für die Entstehung des neuhochdeutschen Futurs sieht. Die bestehenden Theorien zur Entstehung des „werden + Infinitiv“ Futurs werden als linguistisches Potpourri an Erklärungsansätzen dargestellt, die zwar theoretisch überzeugen mögen, aber oft im Abgleich mit den historischen Entwicklungen scheitern.
2. Forschungsüberblick zur Entstehung von werden + Infinitiv als Futurmarker: Dieses Kapitel präsentiert einen Überblick über verschiedene Theorien zur Entstehung des „werden + Infinitiv“-Futurs. Die „Abschleifungstheorie“, die eine lautliche Entwicklung von Partizip Präsens zum Infinitiv postuliert, wird kritisch betrachtet und anhand sprachgeographischer und sprachhistorischer Argumente widerlegt. Die „Autonomiethese“ von Laurits Saltveit, die eine unabhängige Entstehung des „werden + Infinitiv“ annimmt, wird ebenfalls diskutiert, ebenso wie die „Modalitätsthese“, welche die ursprüngliche Bedeutung der Konstruktion als modal statt temporal betont. Die unterschiedlichen Theorien werden gegeneinander abgewogen, um die Herausforderungen bei der Klärung der historischen Entstehung aufzuzeigen.
Schlüsselwörter
werden + Infinitiv, Futurmarker, Grammatikalisierung, Modalverben, Korpuslinguistik, Sprachwandel, Analogie, Diachronie, Sprachgeschichte, Althochdeutsch, Neuhochdeutsch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Genese von „werden + Infinitiv“ als Futurmarker im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Konstruktion „werden + Infinitiv“ als Futurmarker im Deutschen. Sie beleuchtet die Grammatikalisierung des Verbs „werden“ und analysiert, wie diese Konstruktion die Modalverben als Futurmarker abgelöst hat. Die Arbeit evaluiert verschiedene Theorien zur Entstehung des periphrastischen Futurs anhand korpuslinguistischer Daten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einführung, die das Thema einführt und die bestehenden Diskussionspunkte in der Linguistik beleuchtet; ein Forschungsüberblick über verschiedene Theorien zur Entstehung des „werden + Infinitiv“-Futurs; ein Kapitel zur Geschichte des Futurs im Deutschen; eine korpusgestützte Untersuchung zur Ablösung der Modalverben; und abschließend ein Kapitel zur Subjektivierung in der Grammatikalisierung.
Welche Theorien zur Entstehung des „werden + Infinitiv“-Futurs werden behandelt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien, darunter die „Abschleifungstheorie“ (lautliche Entwicklung), die „Autonomiethese“ (unabhängige Entstehung) von Laurits Saltveit und die „Modalitätsthese“ (ursprünglich modale Bedeutung). Die Arbeit bewertet die Stärken und Schwächen dieser Theorien kritisch.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Ein zentraler Aspekt der Arbeit ist die korpuslinguistische Analyse. Die Arbeit nutzt Korpusdaten, um die Ablösung der Modalverben durch „werden + Infinitiv“ zu untersuchen und die verschiedenen Theorien zu evaluieren. Die Methodik und die verwendeten Korpora werden detailliert im entsprechenden Kapitel beschrieben.
Welche Rolle spielt die Grammatikalisierung?
Die Grammatikalisierung des Verbs „werden“ ist ein zentrales Thema der Arbeit. Die Arbeit untersucht, wie sich die Bedeutung und Funktion des Verbs „werden“ im Laufe der Zeit verändert hat und wie dies zur Entstehung des „werden + Infinitiv“-Futurs beigetragen hat. Die Subjektivierung in diesem Grammatikalisierungsprozess wird ebenfalls analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: werden + Infinitiv, Futurmarker, Grammatikalisierung, Modalverben, Korpuslinguistik, Sprachwandel, Analogie, Diachronie, Sprachgeschichte, Althochdeutsch, Neuhochdeutsch.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Analogietheorie als vielversprechender Erklärungsansatz für die Entstehung des neuhochdeutschen Futurs gilt, da sie althochdeutsche Infinitivkonstruktionen als Grundlage berücksichtigt. Die Arbeit zeigt die Komplexität der Thematik und die Schwierigkeiten auf, die sich bei der Klärung der historischen Entstehung ergeben. Die korpuslinguistische Analyse liefert empirische Daten zur Unterstützung der Argumentation.
- Citar trabajo
- Svenja Hahn (Autor), 2020, Genese von 'werden + Infinitiv' als Futurmarker. Ablösung der Modalverben als Futurmarker, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011151