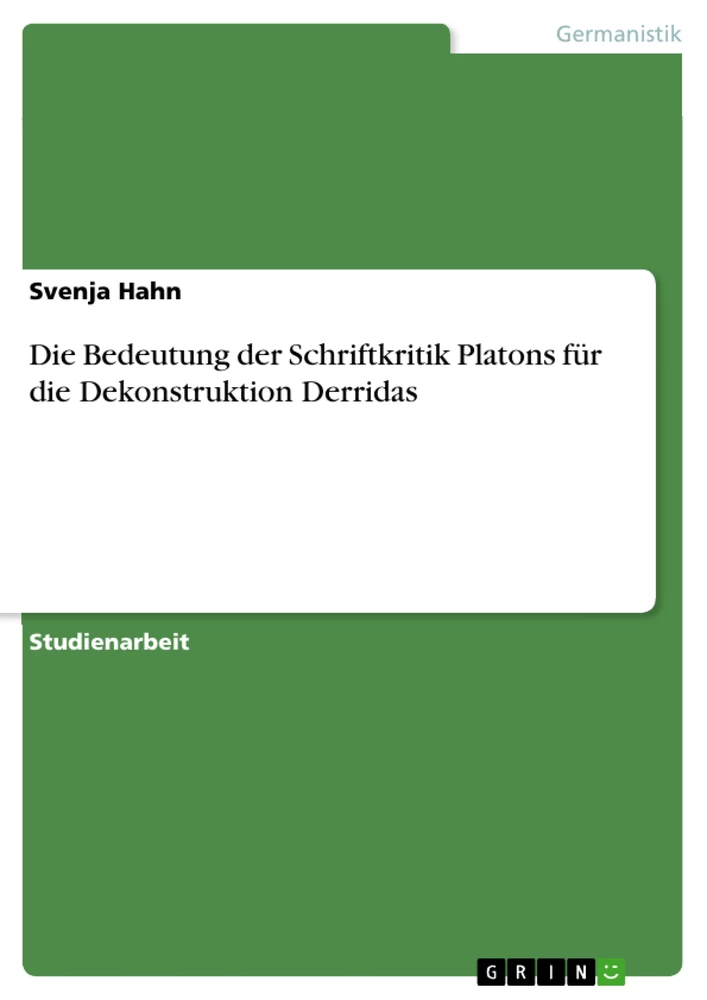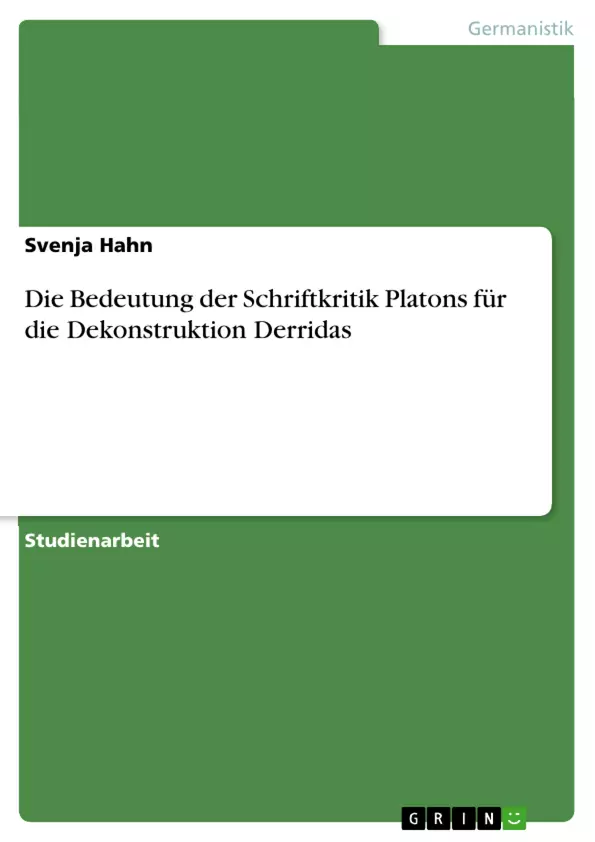Die Arbeit handelt von der Auseinandersetzung Derridas mit den abendländischen Phänomenen des Phono- und Logozentrismus und der Metaphysik der Präsenz, welche sich beispielhaft in Platons "Phaidros" und dem darin enthaltenen Teuth-Mythos widerspiegeln.
Während die Einleitung insbesondere die gegenwärtigen Ursprünge Derridas Kritik veranschaulicht, soll im Folgenden der Antike-Bezug zu Platons Schriftverständnis im Fokus stehen. Dieses ist durch die Idee der Sprache als Abbild stark im Logo- und Phonozentrismus verhaftet. Die Arbeit untersucht daher den Einfluss der im Phaidros vorkommenden Schriftkritik auf die Dekonstruktion Derridas. Dazu werden vor allem die Werke „Grammatologie“ und „Dissemination“ näher betrachtet, aus denen sich zugleich der Aufbau der Arbeit ableiten lässt. Während die „Grammatologie“ vor allem eine Problematisierung der Verschmelzung der Metaphysik der Präsenz mit dem Logo- und Phonozentrismus ist, kann die „Dissemination“ einerseits als Neuinterpretation der Mimesis und andererseits als Analyse des von Platon verwendeten Begriffs „pharmakon“ verstanden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Strukturalismus und das abendländische Schriftverständnis
- Platons Schriftkritik im literaturtheoretischen Diskurs der Dekonstruktion Derridas
- Platons Schriftverständnis im Phaidros: Der Teuth-Mythos
- Logo- und Phonozentrismus vor dem Hintergrund der Grammatologie Derridas
- Derridas Definition von Schrift als Supplement
- Der platonische Mimesis-Begriff vor dem Hintergrund der Dissemination Derridas
- Pharmakon, Mimesis und Schrift
- Schluss
- Die Ironie der platonischen Dialoge
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kritik Platons an der Schrift und deren Bedeutung für die Dekonstruktion Derridas. Die Analyse konzentriert sich auf den Einfluss des Strukturalismus und die Überwindung des abendländischen Schriftverständnisses, das von Platons Schriften geprägt ist.
- Der Einfluss des Strukturalismus auf Derridas Dekonstruktion
- Platons Schriftverständnis im Kontext des Teuth-Mythos
- Die Dekonstruktion von Logo- und Phonozentrismus
- Derridas Definition von Schrift als Supplement
- Der platonische Mimesis-Begriff und seine Relevanz für die Dissemination
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet den Wandel im Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit im 20. Jahrhundert, den sogenannten linguistic turn, und zeigt die Abkehr vom antiken Sprachverständnis als Abbild der Wirklichkeit auf.
- Das zweite Kapitel behandelt Platons Schriftkritik im Kontext der Dekonstruktion Derridas und analysiert den Teuth-Mythos im Phaidros sowie die Konzepte von Logo- und Phonozentrismus. Derridas Definition von Schrift als Supplement wird ebenfalls diskutiert.
- Das dritte Kapitel beleuchtet den platonischen Mimesis-Begriff vor dem Hintergrund der Dissemination Derridas und die Verbindung zwischen Pharmakon, Mimesis und Schrift.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Dekonstruktion, Schriftkritik, Platon, Derrida, Strukturalismus, Phonozentrismus, Logozentrismus, Mimesis, Dissemination, Grammatologie, Supplement und Pharmakon.
- Citar trabajo
- Svenja Hahn (Autor), 2019, Die Bedeutung der Schriftkritik Platons für die Dekonstruktion Derridas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011152