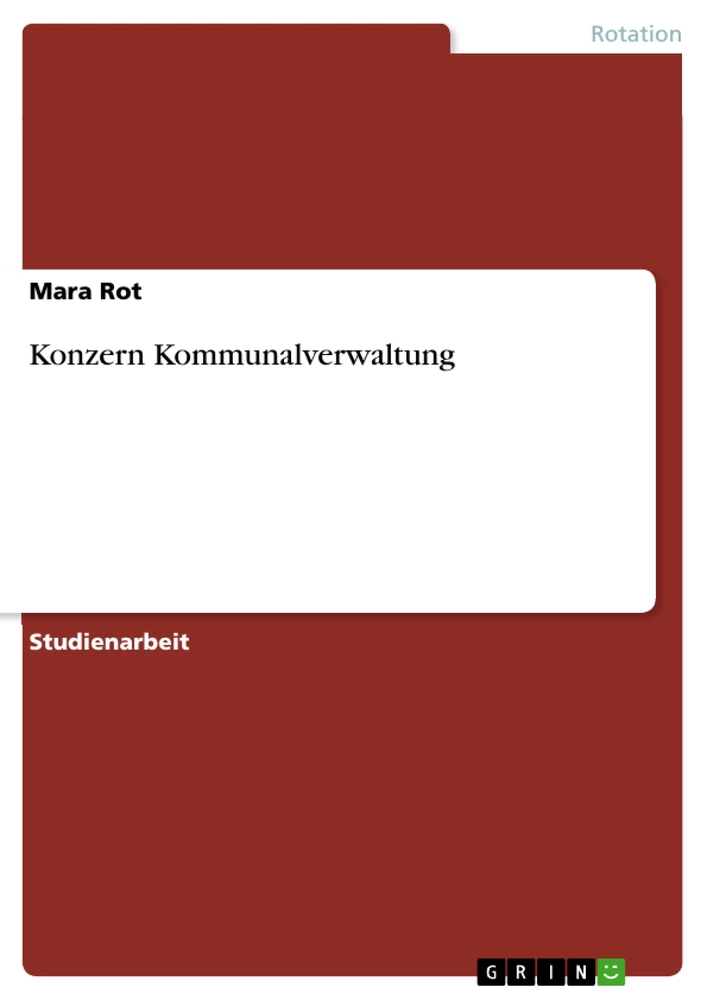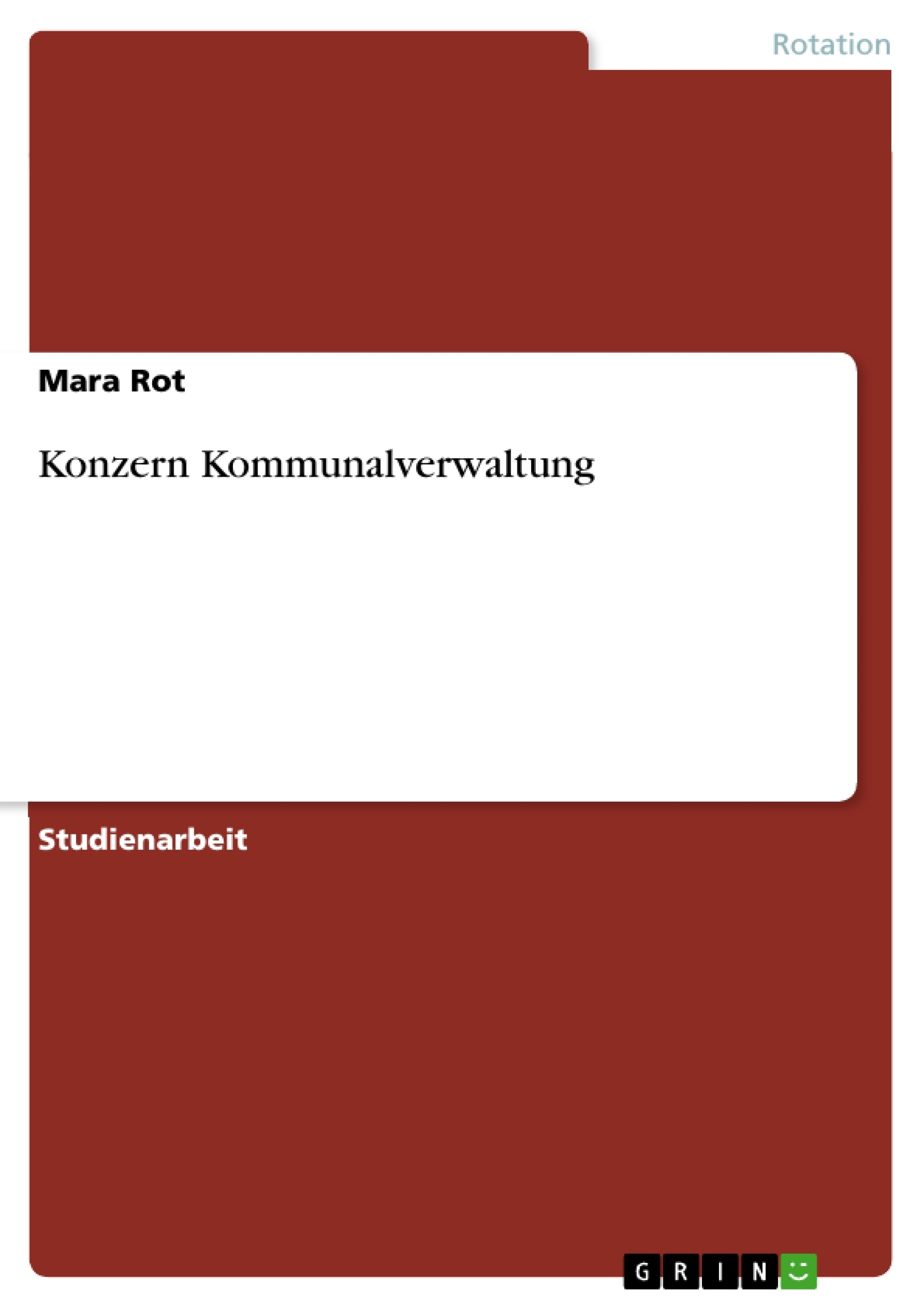Konzern Kommunalverwaltung
1. Einleitung
Die Modernisierung der kommunalen Verwaltung ist in den letzten Jahren zu einem der zentralen gesellschaftlichen Themen geworden. Die nicht enden wollende Finanzkrise war wohl der entscheidende Anstoß für einen umfassen- den Reformprozess. Aber auch steigende Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an die Qualität und den Preis kommunaler Dienstleistungen, der gesell- schaftspolitische Wandlungsprozess sowie der Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Selbstverwirklichung haben Reorganisationsprozesse eingeleitet. Das Schlagwort vom „Konzern/Dienstleistungsunternehmen Stadt“ skizziert, dass mit einer stärkeren betriebswirtschaftlichen Orientierung mehr Effizienz, Flexi- bilität, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung erreicht werden soll.1
Die Folge ist, dass sich die Kommunalverwaltung von einem obrigkeits- staatlichen Instrument, dass vorwiegend nur behördentypisches Output er- zeugte, in ein Dienstleistungsunternehmen entwickelt hat. Der Bürger ist nun nicht mehr „Untertan“, sondern vielmehr ein „Kunde“. Sogar in der Eingriffsverwaltung sind Dienstleistungselemente mit eingeflossen: Die Mitarbeiter werden z.B. geschult Mitarbeiter, die Beratungsqualität und die Verständlichkeit der Bescheide sind verbessert worden.2 Zudem sind Faktoren, welche die Wirtschaftlichkeit einer Verwaltung bemessen sollen, in die kommunale Leistungserstellung mit eingeflossen.
2. Betrieb
Betriebe der freien Marktwirtschaft sind primär markt-, kunden- und produktorientiert. Die Selbstregulation findet durch die Faktoren Gewinnmaximierung und Nachfrage statt. Sachgüter oder Dienstleistungen werden also durch Kombinierung mehrerer Produktionsfaktoren unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit produziert und abgesetzt.
3. Verwaltungsbetrieb
Ein Verwaltungsbetrieb erzeugt, als eine kommunale Leistungseinheit, Kollektivgüter, zur Deckung des Fremdbedarfs.
3.1 Die besondere Situation der öffentlichen Verwaltung
Anders als auf Gewinn ausgerichtete Unternehmen wird die Kommunalver- waltung nicht durch die Profitorientierung reguliert. Sie ist nicht markt- und produktionsorientiert, sondern primär input- und verfahrensorientiert. Bedrohen Marktveränderungen oder andere Faktoren die Organisationseffi- zienz, so ergreift die Geschäftsleitung konsequent neue Maßnahmen oder es geht Konkurs. Dieser Anreiz besteht für die öffentliche Verwaltung nicht. Viele der staatlichen Aufgaben entziehen sich völlig dem marktwirtschaft- lichen Wettbewerb (Monopolstellung der Verwaltung). Ein Verwaltungsbetrieb hat zwar auch die primäre Aufgabe, den (kollektiven oder individuellen) Fremdbedarf zu decken, jedoch werden diese nicht nur von der Nachfrage, sondern vor allem durch die Maßgabe der Notwendigkeit reguliert.3 Sinkt die Nachfrage nach einem Produkt, so kann die Verwaltung es nicht einfach ab- setzen, da sie gesetzlich verpflichtet ist bestimmte Produkte bereitzustellen. Weiterhin werden die kommunalen Dienstleistungen hauptsächlich unentgelt- lich abgesetzt. Der „Kunde“ (Bürger) zahlt mittelbar durch Steuer- und Ge- bührenabgaben oder Beiträge. Die Regulierung durch den Markt erfolgt also nicht.
Eine realistische Kostentransparenz ist nur möglich, wenn die Kommunen untereinander ihre Leistungen vergleichen, da keine Vergleichsmöglichkeiten auf dem freien Markt bestehen.
3.2 Beachtung politischer Verpflichtungen
Die Mutter des "Konzerns Stadt" sieht sich in der Durchsetzung von Steu- erungs- und Kontrollmaßnahmen behindert, die Unternehmen beklagen, dass ihre Interessen in der Stadtverwaltung nicht ausreichend gewürdigt werden. Aus ihrer Gesamtverantwortung für die kommunale Politik heraus und wegen der erheblichen Wirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt sind die Kom- munen zur Steuerung und Kontrolle ihrer Tochtergesellschaften verpflichtet. Hierzu ist die Vorgabe steuerungs- und kontrollgeeigneter Ziele erforderlich. Aufgabe des Beteiligungscontrolling ist sodann die Informationsbeschaffung, die qualifizierte Analyse der Informationen und die Bereitstellung relevanter Informationen für die Entscheidungsträger.
4. Konzern Kommunalverwaltung (Anlage 4)
Eine konzernähnlich strukturierte Verwaltung meint, dass sie stärker Markt- und Wettbewerbsorientiert ist und daher auch Managementkonzepte von privatwirtschaftlichen Unternehmen übernimmt. Der hierarchischer Aufbau der „Kommunalkonzerns“ trennt die strategische Verantwortung (Rat mit Aus- schüssen) von der operativen Verantwortung (Verwaltungseinheiten/ Dienste). Außerdem wird eine Vermittlungsinstanz (Konzernstab) zur Koordinierung eingeschaltet.4 Viele Kommunen haben Unternehmen in Organisationsformen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts gegründet und ihnen an- schließend kommunale Aufgaben und Dienstleistungen übertragen.5
Die Steuerungsebene ist zuständig für Führung, Planung, Organisation und Kontrolle, sie gibt die politischen Rahmenbedingungen und die Zielsetzungen vor. Durch die klare Formulierung von Leistungszielen und Übertragung von integralen Managementfunktionen werden die Fachbereiche zu selbstständigen Betrieben innerhalb der Verwaltungsorganisation. Die Delegation von Verant- wortung nach unten ermöglicht dem Rat seine primären politischen Aufgaben zu verfolgen. Die zuständigen Fachbereiche/Dienste können erhalten Res- sourcen und Ergebnisverantwortungen für ihre „Produkterstellung“. Erst so wird eine bessere Kunden- und Marktbetreuung realisierbar.6 Jedoch haben sie über ihre Leistungen und Methoden der Steuerungsebene stetig Rechenschaft abzulegen.
Eine weiterhin einheitliche Verwaltung wird durch zwischengeschaltete Orga- nisationseinheiten (OE) gewährleistet. Die Dezentralisierung soll weitest- gehend verhindert werden. Organisationseinheiten sind für allgemeine Steue- rungs- und Controllingaufgaben verantwortlich. Dieses in Konzernen übliche Kontraktmanagement ermöglicht eine einheitliche Führung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften.
Bisher reagierte die Verwaltung auf Nachfrageveränderungen nicht mit Anpassung und Umschichtung der Aufgabenbereiche, sondern mit Größenwachstum. Dadurch verringerte sich klar die Effizienz und die Wirtschaftlichkeit und die Kommune wurde stärker abhängig von staatlichen Zuschüssen.
Eine konzernähnliche Steuerung der Verwaltung, soll erreichen, dass sie flexibler auf veränderte Marktanforderungen reagieren kann und weiterhin attraktive Arbeitsplätze für qualifizierte Arbeitskräfte bietet.
5. zukünftiger Handlungsbedarf
5.1 Weiterer Reformbedarf
Die stärkere betriebswirtschaftliche Orientierung erfordert die Konzeption eines zielorientierten Informationssystems, welches im Haushalts- und Rechnungswesen verankert wird. Damit ermittelt werden kann, was die Er- bringung einer bestimmten Leistung durch die Kommune kostet, ob die Lei- stung effizient und wirtschaftlich erstellt wird, wo Schwachstellen in der Leistungserbringung liegen oder ob Dritte (andere Städte oder private An- bieter) die Leistung wirtschaftlicher produzieren können, ist ein leistungs- fähiges Rechnungswesen einzusetzen.7 Die Kameralistik vermag die dabei gestellten Anforderungen nur begrenzt zu erfüllen. Mit dem Wechsel von der Kameralistik zur Doppik kann sichergestellt werden, dass neben der finanz- wirtschaftlichen Haushaltsfunktion auch die kosten- und leitungsmäßige Pla- nungs-, Steuerungs- und Kontrollfunktion erfüllt wird. Damit ist denen Kom- munen auch die Grundlage bereitet, jährlich Bilanzen aufzustellen, die unter anderem Informationen über das vorhandene Vermögen, den Verbrauch von Ressourcen, getätigte Investitionen und deren Finanzierung bereitstellen.
5.2 Voraussetzungen
In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass in der kommunalen Verwaltung die für die Umsetzung der Reorganisationsmaßnahmen erforderlichen qualitativen und quantitativen Ressourcen nicht verfügbar sind. Neue Anforderungen sind zu bewältigen, für die es meist keinen "Königsweg" gibt. Erfahrung mit privatwirtschaftlichen Managementprozessen, effizienten und verlässlichen Rechnungs- und Kostenrechnungssystemen, betriebswirtschaftlichen Untersuchungen, Beteiligungscontrolling in Konzernen und Wissen über die Probleme und Entwicklungstrends in kommunalen Gesellschaften (Branchen-Know-how) sind unerlässlich, sollen die Maßnahmen zum Erfolg führen.
Erläuterung zu Anlage 4:
Das Leitbild:
Die Kommunalverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen, dessen Mitarbeiter die Bürger als ihre Kunden verstehen, die einen selbstverständlichen Anspruch darauf haben, für das von ihnen zur Verfügung gestellte Geld effektive und effiziente Leistungen zu erhalten
Die Konzernstruktur:
Kommunalverwaltung (Konzernmutter) und Kommunalgesellschaften bilden den "Konzern Stadt".
Die Fachämter werden selbständige Geschäftsbereiche mit eigener Kosten-, Erlös- und Investitionsverantwortung
Das Controlling-System:
Die politische und administrative Planung und Entscheidung im "Konzern" erfolgt durch Vereinbarung von Zielen, Budgets und Kompetenzen.
Die Feinsteuerung und Kontrolle während der Umsetzung erfolgt durch ein differenziertes Berichtswesen. (Konzernstab/Querschnittseinheiten)
Aus: http://www.wtk.de/kommunen.htm
[...]
1 Holzer, Anton „GIS-Einsatz“ in der Stadtverwaltung am Beispiel Hallein aus: http:www.corp.at/html/holzner96.html
2 Banner, S.1 1.
3 Wöhe, S.41
4 Banner, S. 7
5 in den einigen Großstädten werden mehr als 50 Prozent des Gesamtinvestitionsvo lumens an Beteiligungen geleistet.
6 Vgl. Friese/Funk/Lührs/Schulz, S.16; http://www.wtk.de/kommunen.htm 2.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Konzern Kommunalverwaltung"?
Der Text befasst sich mit der Modernisierung der kommunalen Verwaltung, insbesondere im Hinblick auf betriebswirtschaftliche Prinzipien und die Umwandlung von Behörden in Dienstleistungsunternehmen.
Warum ist die Modernisierung der kommunalen Verwaltung wichtig?
Die Modernisierung wird durch Faktoren wie die Finanzkrise, steigende Bürgeransprüche, gesellschaftspolitische Veränderungen und den Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Selbstverwirklichung vorangetrieben. Ziel ist es, Effizienz, Flexibilität, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterorientierung zu verbessern.
Wie unterscheidet sich ein Verwaltungsbetrieb von einem Betrieb der freien Marktwirtschaft?
Im Gegensatz zu gewinnorientierten Unternehmen wird die Kommunalverwaltung nicht durch Profit reguliert. Sie ist stärker input- und verfahrensorientiert und unterliegt politischen Verpflichtungen.
Was bedeutet "Konzern Kommunalverwaltung"?
Es bedeutet, dass die Verwaltung stärker markt- und wettbewerbsorientiert ist und Managementkonzepte aus der Privatwirtschaft übernimmt. Dies beinhaltet eine Trennung von strategischer und operativer Verantwortung sowie die Einrichtung von Vermittlungsinstanzen.
Welche Rolle spielt die Steuerungsebene im "Konzern Kommunalverwaltung"?
Die Steuerungsebene ist für Führung, Planung, Organisation und Kontrolle zuständig. Sie gibt die politischen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen vor.
Was ist das Ziel der Dezentralisierung in der kommunalen Verwaltung?
Die Dezentralisierung soll Fachbereiche zu selbstständigen Betrieben machen und eine bessere Kunden- und Marktbetreuung ermöglichen. Gleichzeitig soll durch zwischengeschaltete Organisationseinheiten eine einheitliche Verwaltung gewährleistet werden.
Welchen Handlungsbedarf gibt es in Bezug auf die Reform der kommunalen Verwaltung?
Es besteht Bedarf an einem zielorientierten Informationssystem im Haushalts- und Rechnungswesen, um die Kosten und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung zu ermitteln. Der Wechsel von der Kameralistik zur Doppik wird als notwendig erachtet.
Welche Voraussetzungen sind für die erfolgreiche Umsetzung von Reorganisationsmaßnahmen erforderlich?
Es werden qualitative und quantitative Ressourcen benötigt, darunter Erfahrung mit privatwirtschaftlichen Managementprozessen, Rechnungs- und Kostenrechnungssystemen, betriebswirtschaftlichen Untersuchungen, Beteiligungscontrolling und Branchen-Know-how.
Was ist das Leitbild der Kommunalverwaltung im Kontext des "Konzern Stadt"?
Die Kommunalverwaltung versteht sich als Dienstleistungsunternehmen, dessen Mitarbeiter die Bürger als Kunden betrachten, die Anspruch auf effektive und effiziente Leistungen haben.
Wie funktioniert das Controlling-System im "Konzern Stadt"?
Die Planung und Entscheidung erfolgt durch Vereinbarung von Zielen, Budgets und Kompetenzen. Die Feinsteuerung und Kontrolle während der Umsetzung erfolgt durch ein differenziertes Berichtswesen (Konzernstab/Querschnittseinheiten).
- Quote paper
- Mara Rot (Author), 2000, Konzern Kommunalverwaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101130