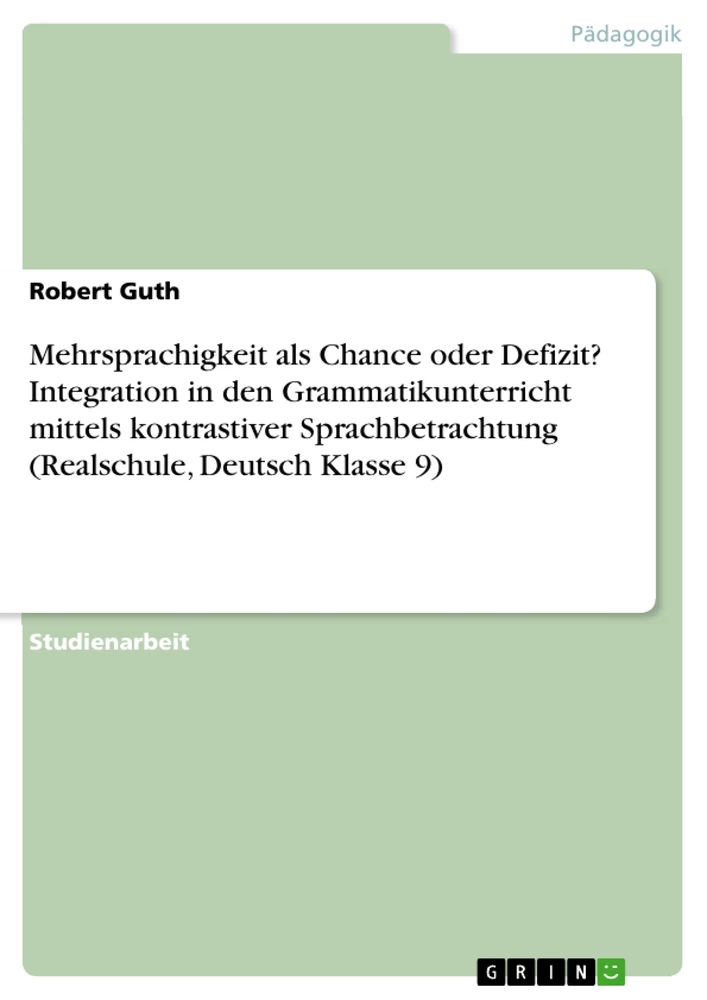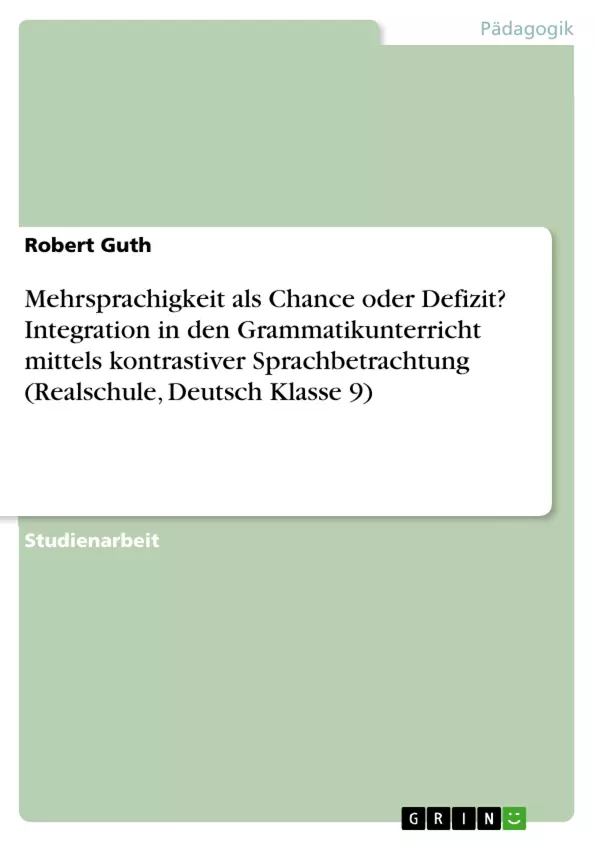Im Rahmen dieser Hausarbeit werden nun Rahmenbedingungen und einschlägige Konzepte vorgestellt, die geeignet sind, den Aspekt der Mehrsprachigkeit in den Grammatikunterricht aufzunehmen. Zunächst wird betrachtet, welche gängigen Konzepte in den allgemeinen Grammatikmethodik vertreten sind (→ Kapitel 2). Anschließend werden Konzepte und Prinzipien vorgestellt, deren Ziel darin besteht, den Aspekt der Mehrsprachigkeit im Zuge des Grammatikunterrichts in heterogenen Lernumgebungen einzubinden (→ Kapitel 3). Zuletzt wird eine exemplarische Unterrichtseinheit skizziert, die die zuvor thematisierten didaktischen und methodischen Grundlagen, sozusagen in die Praxis überführen soll (→ Kapitel 4). Es soll demnach erörtert werden, welche Werkzeuge und Prinzipien pädagogischen Arbeitens hierbei zur Verfügung stehen und wie diese sich in die unterrichtliche Praxis integrieren lassen.
In den Integrationsplänen der Bundesregierung wird bereits seit Jahren gefordert, Mehrsprachigkeit als Bildungschance und nicht als Defizit zu betrachten (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2007: 39ff.). Mehrsprachigkeit soll demnach aktiv im Schultag als Lernmöglichkeit genutzt und verankert werden (ebd.). Bildungseinrichtungen dienen hier auch als Orte, an denen ein harmonisches mehrsprachiges-multikulturelles Zusammenleben angebahnt und gestärkt werden soll (ebd.).
Die Beherrschung der Sprache ist eine unabdingbare Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Bildungsteilhabe. Bildung ist der Grundpfeiler für die berufliche Qualifikation. Sie ist die Basis, um ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. Den Bildungseinrichtungen obliegt als Bildungsträger die Transformation, junge Menschen mit Migrationshintergrund und gegebenenfalls auch Fluchterfahrung erfolgreich in unsere Gesellschaft zu integrieren.
Um dies zu gewährleisten, bedarf es sprachpädagogischer und fächerübergreifender Konzepte, die den Aspekt der Mehrsprachigkeitserziehung in den Mittelpunkt stellen. Die Arbeitsbereiche Deutsch als Zweitsprache sowie Deutsch als Fremdsprache, die diesen o.g. Aspekt aufgreifen, gewinnen immer mehr an Bedeutung und sollten entsprechend auch von EU, Bund, Ländern und Kommunen gefördert werden, um das Miteinander zu fördern und das Entstehen von Parallelgesellschaften zu verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Allgemeine Grammatikmethodik
- 2.1. Formaler versus funktionaler Grammatikunterricht
- 2.2. Systematischer versus situationsorientierter Grammatikunterrichts
- 2.3. Deduktiver versus induktiver Grammatikunterricht
- 2.4. Die Grammatik-Werkstatt
- 2.5. Integrativer Grammatikunterricht
- 3. Ansätze des Deutschunterrichts bei sprachheterogener Schülerschaft
- 3.1. Kontrastiver Sprachunterricht
- 3.2. Der Language-Awareness-Ansatz
- 3.3. Herausforderungen des kontrastiven Sprachunterrichts
- 3.4. Exemplarische Sachanalyse
- 4. Umsetzungsmöglichkeit in der Unterrichtspraxis
- 4.1. Klassenspezifische Lernvoraussetzungen
- 4.2. Lernziele
- 4.3. Stellung der Stunde im Rahmen der Unterrichtsreihe
- 4.4. Didaktische Analyse
- 4.5. Didaktisch-methodische Begründung
- 4.6. Geplanter Unterrichtsverlauf
- 4.7. Differenzierung
- 4.8. Sozial- und Aktionsformen
- 5. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration der Mehrsprachigkeit in den Grammatikunterricht. Sie analysiert gängige Konzepte der Grammatikmethodik und erörtert Ansätze, die sprachheterogene Schülerschaft im Deutschunterricht berücksichtigen. Ziel ist es, die Mehrsprachigkeit als Chance zu begreifen und in den Unterricht zu integrieren, um die Bildungsteilhabe aller Lernenden zu fördern.
- Formaler versus funktionaler Grammatikunterricht
- Kontrastiver Sprachunterricht und Language-Awareness
- Herausforderungen der Mehrsprachigkeit im Unterricht
- Didaktische und methodische Grundlagen für eine inklusive Unterrichtsgestaltung
- Exemplarische Unterrichtsplanung zur Umsetzung der Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Konzepte der Grammatikmethodik, wie den formalen und funktionalen Grammatikunterricht, und stellt diese gegenüber. Kapitel 3 widmet sich dem Deutschunterricht bei sprachheterogener Schülerschaft, wobei der kontrastive Sprachunterricht und der Language-Awareness-Ansatz im Fokus stehen. Die Herausforderungen des kontrastiven Sprachunterrichts werden ebenfalls beleuchtet. Kapitel 4 skizziert eine exemplarische Unterrichtseinheit, die die zuvor behandelten didaktischen und methodischen Grundlagen in die Praxis überträgt.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Grammatikmethodik, kontrastiver Sprachunterricht, Language-Awareness, Inklusion, Unterrichtsplanung, heterogene Schülerschaft, Bildungsteilhabe.
- Citar trabajo
- Robert Guth (Autor), 2021, Mehrsprachigkeit als Chance oder Defizit? Integration in den Grammatikunterricht mittels kontrastiver Sprachbetrachtung (Realschule, Deutsch Klasse 9), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011542