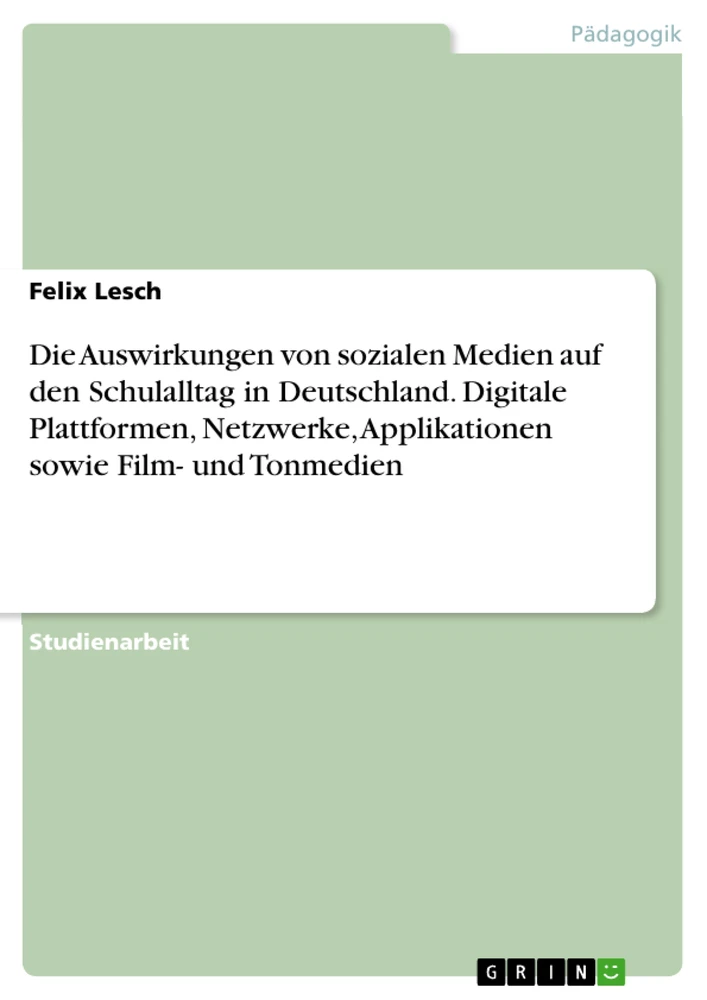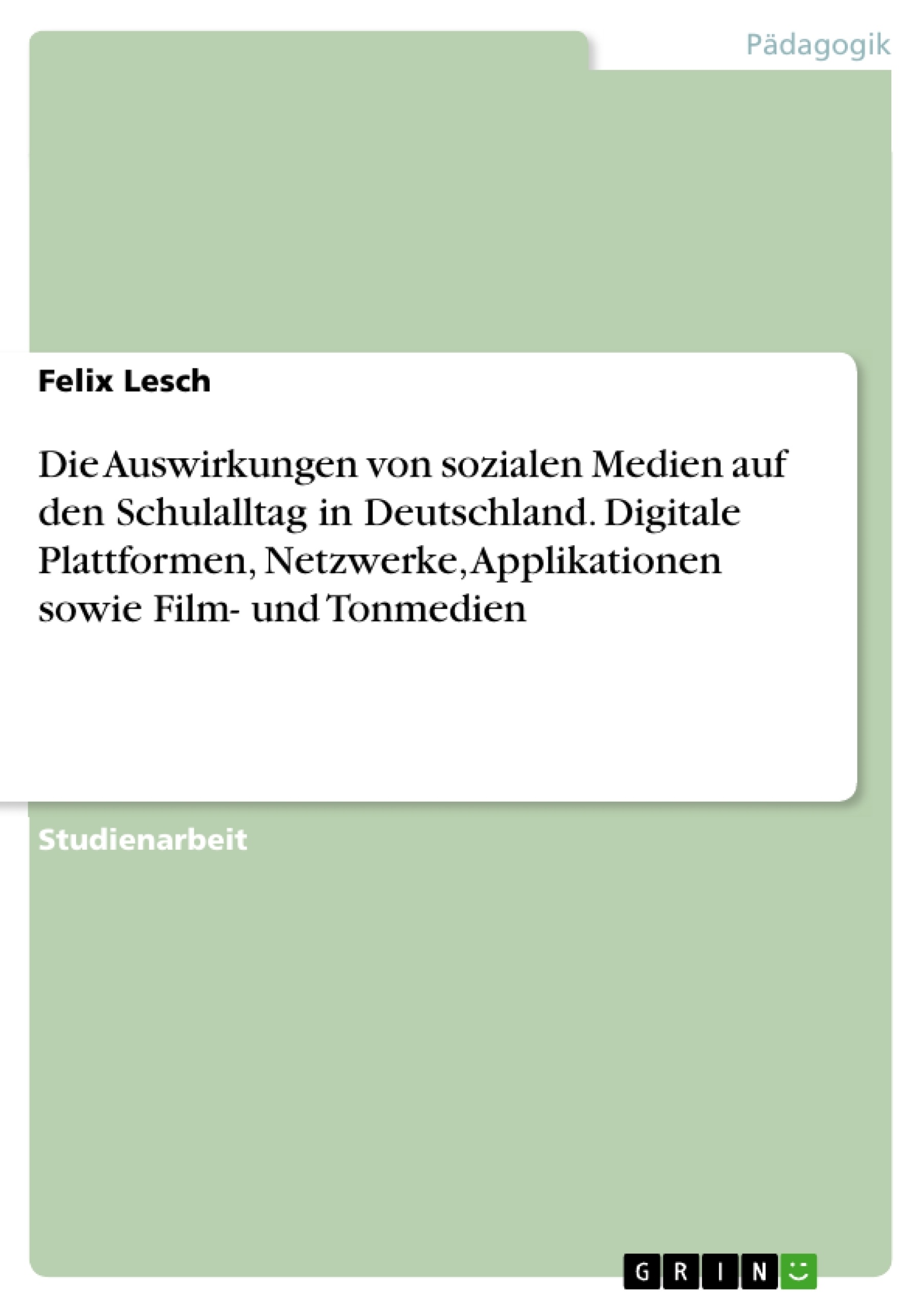Diese Forschungsarbeit beabsichtigt die Auswirkungen von sozialen Medien auf den Schulalltag in Deutschland zu erörtern.
Der Ausdruck Soziale Medien wird hierbei als Oberbegriff für digitale Plattformen, Netzwerke, Applikationen, sowie Film- und Tonmedien verstanden, schließt aber auch die zur Benutzung notwendigen Geräte wie Handys, Tablets oder Computer mit ein.
Im Folgenden werden theoretische Grundlagen und ausgewählte Forschungen zu dem Thema vorgestellt. Anschließend wird die angewandte Methodik erläutert. Hierbei wird auf das Untersuchungsdesign, die Auswahl der Stichprobe, die Leitfadenkonstruktion, die Art der Durchführung sowie die Auswertungsmethode eingegangen. Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse dargestellt und abschließend diskutiert.
„Eigentlich darf es keinen Lehrer geben, der noch nie von Instagram, Twitter oder Snapchat gehört hat und nicht grob weiß, wie diese Netzwerke funktionieren“ forderte der Medienpädagoge Florian Schultz-Pernice von der Münchner LMU im Interview mit der Süddeutschen Zeitung im Jahr 2017. Für die heutigen Schüler und Schülerinnen, die als sogenannte digital natives aufwachsen, mag ein Leben ohne solche sozialen Medien kaum vorstellbar sein, verläuft doch ein Großteil ihrer täglichen Interaktionen im digitalen Raum. Dass die sozialen Medien somit auch Einzug in die Klassenzimmer gefunden haben, ist daher nur folgerichtig. Inwieweit die mediale Offensive jedoch auch von den Lehrkräften begrüßt wird, ist von der persönlichen Überzeugung und gesammelten Erfahrungen geleitet. Das Ausmaß, in dem Potenziale und Gefahren sozialer Medien identifiziert wird, bestimmt deren aktiven Einsatz in der Institution Schule.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 3 Methodik
- 3.1 Untersuchungsdesign
- 3.2 Stichprobe
- 3.3 Leitfadenkonstruktion
- 3.4 Durchführung
- 3.5 Auswertungsverfahren
- 4 Ergebnisse
- 5 Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese qualitative Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen sozialer Medien auf den deutschen Schulalltag. Ziel ist es, die Einflüsse dieser Medien auf Lehrer und Schüler zu ergründen und zu analysieren, wie diese im Schulkontext wahrgenommen und eingesetzt werden.
- Der Einfluss sozialer Medien auf den Unterricht
- Die Akzeptanz und der Umgang mit sozialen Medien durch Lehrkräfte
- Die Rolle sozialer Medien im täglichen Leben von Schülern
- Potenziale und Herausforderungen des Einsatzes sozialer Medien in der Schule
- Qualitative Forschungsergebnisse und deren Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Auswirkungen sozialer Medien auf den Schulalltag ein und betont die zunehmende Bedeutung digitaler Medien im Leben von Schülern. Sie beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit und gibt einen Überblick über den Aufbau. Der Zitat von Florian Schultz-Pernice verdeutlicht den dringenden Bedarf an der Auseinandersetzung mit dem Thema, da soziale Medien bereits einen erheblichen Einfluss auf den Schulalltag haben, sowohl für Schüler als auch für Lehrer. Die Arbeit will die damit verbundenen Potenziale und Gefahren untersuchen.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es wird auf die Aussagen von Beißwenger und Knopp eingegangen, die soziale Medien als didaktische Werkzeuge beschreiben, die Lehrkräften bei der Wissensvermittlung helfen können. Der Fokus liegt auf der Erläuterung des Konzepts sozialer Medien und ihrer Bedeutung im Kontext Schule. Es werden relevante Forschungsarbeiten und Theorien vorgestellt, welche den Rahmen für die eigene qualitative Untersuchung bilden und ein Verständnis für den theoretischen Kontext schaffen. Dieses Kapitel dient dazu, die Forschungsfrage wissenschaftlich einzuordnen und zu kontextualisieren.
3 Methodik: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der durchgeführten qualitativen Forschungsarbeit. Es erläutert das gewählte Untersuchungsdesign, die Auswahl der Stichprobe, die Konstruktion der Leitfäden für die Interviews oder die Datenerhebung, die Durchführung der Datenerhebung selbst (z.B. Interviews) und die angewandte Methode zur Auswertung der gesammelten Daten. Die Beschreibung der Methodik soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Studie gewährleisten und erlaubt anderen Forschern, die Studie zu replizieren oder zu kritisieren. Die Genauigkeit der Beschreibung der Methodik ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Ergebnisse.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Datenanalyse. Es werden die in der Datenerhebung gewonnenen Informationen systematisch dargestellt und aufbereitet, z.B. durch die Beschreibung wiederkehrender Muster, Thematiken oder Zusammenhänge. Die Darstellung der Ergebnisse ist detailliert und objektiv, um dem Leser ein klares Bild der Untersuchungsergebnisse zu liefern. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die nachfolgende Diskussion und Interpretation.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Schulalltag, Qualitative Datenanalyse, Digital Natives, Lehrkräfte, Schüler, Methodik, Forschung, Deutschland, Potenziale, Herausforderungen, digitales Lernen
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Forschungsarbeit: Auswirkungen sozialer Medien auf den deutschen Schulalltag
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht qualitativ die Auswirkungen sozialer Medien auf den deutschen Schulalltag. Der Fokus liegt auf den Einflüssen dieser Medien auf Lehrer und Schüler, ihrer Wahrnehmung und Nutzung im Schulkontext.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den Einfluss sozialer Medien auf den Unterricht, die Akzeptanz und den Umgang damit durch Lehrkräfte, die Rolle sozialer Medien im täglichen Leben von Schülern sowie die Potenziale und Herausforderungen ihres Einsatzes in der Schule. Die Interpretation der qualitativen Forschungsergebnisse ist ein weiterer wichtiger Aspekt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methodik, Ergebnisse und Diskussion. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Forschungsansatz. Der theoretische Hintergrund legt die wissenschaftlichen Grundlagen dar. Die Methodik beschreibt detailliert den Forschungsansatz, die Stichprobenauswahl und die Datenanalyse. Die Ergebnisse präsentieren die gewonnenen Erkenntnisse, und die Diskussion interpretiert diese Ergebnisse.
Welche Methodik wurde angewendet?
Es handelt sich um eine qualitative Forschungsarbeit. Das Kapitel "Methodik" beschreibt detailliert das Untersuchungsdesign, die Stichprobenauswahl, die Leitfadenkonstruktion für Interviews oder andere Datenerhebungsmethoden, die Durchführung der Datenerhebung und die angewandte Methode zur Auswertung der Daten. Die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Methodik wird betont.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Das Kapitel "Ergebnisse" präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Datenanalyse. Die gewonnenen Informationen werden systematisch dargestellt und aufbereitet, z.B. durch die Beschreibung wiederkehrender Muster und Zusammenhänge. Die Darstellung ist detailliert und objektiv.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Medien, Schulalltag, Qualitative Datenanalyse, Digital Natives, Lehrkräfte, Schüler, Methodik, Forschung, Deutschland, Potenziale, Herausforderungen, digitales Lernen.
Welche Zitate werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Aussagen von Beißwenger und Knopp bezüglich sozialer Medien als didaktische Werkzeuge und auf ein Zitat von Florian Schultz-Pernice, welches den dringenden Bedarf an der Auseinandersetzung mit dem Thema betont.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang der Arbeit und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf (z.B. Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methodik mit Unterpunkten wie Untersuchungsdesign, Stichprobe etc., Ergebnisse und Diskussion).
- Citar trabajo
- Felix Lesch (Autor), 2020, Die Auswirkungen von sozialen Medien auf den Schulalltag in Deutschland. Digitale Plattformen, Netzwerke, Applikationen sowie Film- und Tonmedien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011809