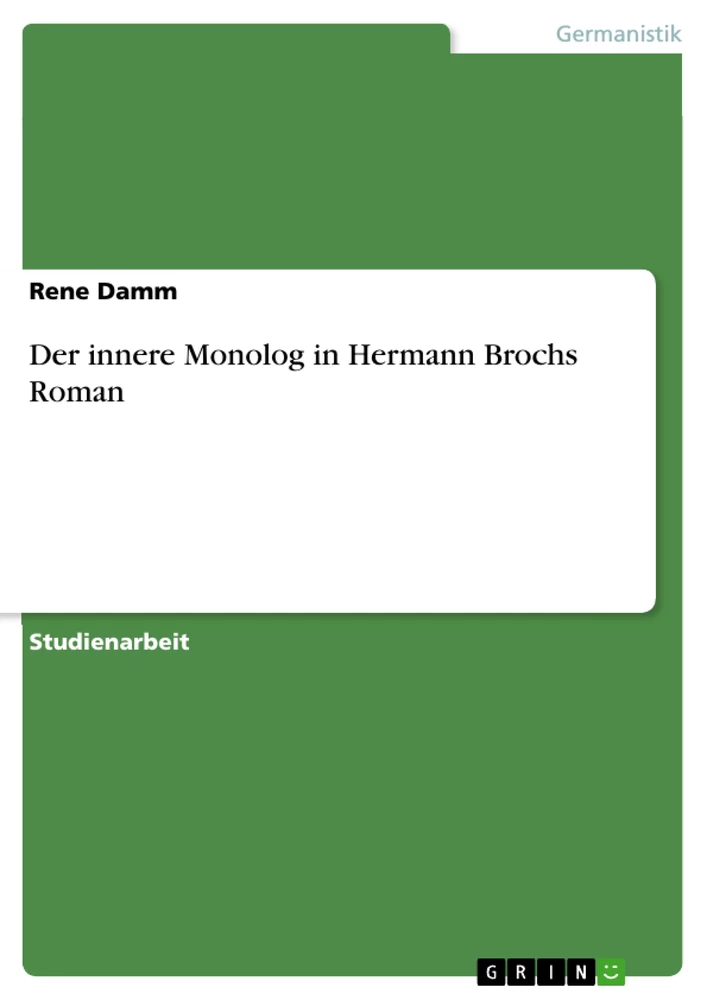Was denken, fühlen und erleben wir wirklich, wenn wir allein mit unseren Gedanken sind? Diese Frage steht im Zentrum einer faszinierenden Reise durch die literarische Moderne, die den inneren Monolog als bahnbrechende Technik der Bewusstseinsdarstellung erkundet. Von den Anfängen bei Edouard Dujardin, dessen Werk von James Joyce als Inspiration für seinen "Ulysses" gefeiert wurde, bis hin zu Arthur Schnitzlers gesellschaftskritischem "Leutnant Gustl" und den komplexen Bewusstseinsströmen in Joyce's "Ulysses" selbst, verfolgt diese Studie die Entwicklung einer Erzählform, die das Innenleben der Figuren in den Vordergrund rückt. Im Mittelpunkt steht Hermann Brochs "Der Tod des Vergil", ein anspruchsvolles Werk, das die Grenzen des inneren Monologs auslotet und eine einzigartige Erzählstruktur schafft, in der auktoriale Perspektive und subjektives Erleben auf innovative Weise miteinander verschmelzen. Der Leser wird eingeladen, in die Gedankenwelt des sterbenden Dichters einzutauchen, seine Sprach- und Identitätskrise mitzuerleben und über die großen Fragen von Leben, Tod, Kunst und Wahrheit zu reflektieren. Dabei werden nicht nur die erzähltechnischen Besonderheiten des Romans analysiert, sondern auch die philosophischen und ethischen Dimensionen beleuchtet, die Brochs Werk zu einem bedeutenden Beitrag zur literarischen Moderne machen. Diese tiefgreifende Analyse bietet neue Einblicke in die Technik des inneren Monologs und dessen vielfältige Ausprägungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, ideal für Literaturwissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Darstellung von Bewusstsein und Subjektivität in der Literatur interessieren. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Erzähltheorie F.K. Stanzels ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der personalen und Ich-Erzählsituationen. Die Reise durch das Innere führt zu einer neuen Gewichtung der Autor-Erzähler-Figur Beziehung. Tauchen Sie ein in eine Welt literarischer Innovation und philosophischer Tiefe! Entdecken Sie die verborgenen Ströme des Bewusstseins und die Macht der Sprache, die menschliche Erfahrung zu erfassen. Diese Studie bietet einen detaillierten Einblick in die Entwicklung und Anwendung des inneren Monologs, von seinen frühen Pionieren bis zu seinen komplexesten Ausformulierungen. Erleben Sie die literarische Moderne aus einer neuen Perspektive und erweitern Sie Ihr Verständnis für die Kunst des Erzählens.
Inhaltsverzeichnis
1. Prolog
2. Edouard Dujardin - "Die Lorbeerbäume sind geschnitten"
3. Arthur Schnitzler - "Leutnant Gustl"
4. James Joyce - "Ulysses" - Stephen Dedalus und Molly Bloom
5. Hermann Broch - "Der Tod des Vergil"
5.1. Das Erzähler-Mysterium als Stimme Vergils?
5.2. Bau und Sprache des Romans
5.3. Die Sprach- und Identitätskrise Vergils
6. Ein Fazit des Vergleichs
7. Bibliographie
Prolog
Als eine neue Methode der Bewußtseinsdarstellung eröffnet der Innere Monolog seit seiner „Entdeckung“ durch Edouard Dujardin investigative Möglichkeiten der literarischen Subjektkonstitution. Unter einem transzendental leeren Himmel wächst das Bedürfnis nach Romansubjekten, die diesen Verlust nicht kompensieren, sondern ihn in ihrer Realität phänomenal aufweisbar machen. Die Entdeckung des Traumes und der Psychoanalyse, aber vor allem der Relativität der Wahrnehmung spiegelt sich nun auch in den Werken der literarischen Moderne von Schnitzler, Proust, Musil, Joyce bis Broch. So werden unweigerlich die alten philosophischen Problemfelder berührt, das Fragen nach Subjekt, Wahrheit und Welt. In diesem, auch von der aufkommenden phänomenologischen Bewußtseinsforschung geprägten Horizont steht der Innere Monolog als eine erkenntnistheoretisch scheinbar privilegierte Variante des „Erzählens“. Eine „Ontologie des Inneren“ wird angestrebt, und dabei zunächst die naturalistische und psychologistische Reduktion in Kauf genommen. Mögen Autor und Erzähler hinter der Figur im Text endgültig versunken scheinen; gerade in ihrer Verdeckung sind sie um so präsenter.
Im folgenden soll die Entwicklung des inneren Monologs an drei prominenten Werken der literarischen Moderne des 19. und 20.Jahrhunderts ausschnittweise exemplifiziert werden. Im Anschluß geht es im Hauptteil um Hermann Brochs Roman "Der Tod des Vergil" und dessen komparatistische Einordnung in die Tradition des Inneren Monologs. Hierbei gilt es, die Selbstkommentare des Autors kritisch- produktiv an den tatsächlichen Erzählsituationen des Vergilromans zu messen. Am Ende soll ein differenziertes Bild disparater Formen der personalen und Ich-Erzählsituation in Anlehnung an F.K.Stanzels Typenkreis stehen.
Begriffstheoretische oder gar etymologische Reflexionen können aus Platzgründen nur marginal berücksichtigt werden.
Edouard Dujardin - "Die Lorbeerbäume sind geschnitten"
Die Traditionslinie des inneren Monologs (Monologue interiéur) begründet der französische Schriftsteller und Literaturkritiker Edouard Dujardin mit seinem Roman "Les Lauriers sont coupés". 1887 erschienen, bleibt der kleine Roman zunächst wenig beachtet, bis er von James Joyce als Vorbild für den inneren Monolog seines "Ulysses" benannt wurde.
Der Roman läßt den Leser sechs Stunden im Leben eines Studenten und seiner Freundin in einem nahezu konsequent durchgehaltenen inneren Monolog "miterleben". Es ist die Geschichte der scheiternden, weil unerwiderten Liebe des Daniel Prince zu der Schauspielerin und Tänzerin Léa d'Arsay.
Dujardin führt den stummen Monolog hier als grundlegendes Prinzip durch und verzichtet dabei auf den mittlerweile üblichen Erzählrahmen in der dritten Person. Der innere Monolog Daniels wird nur durch einige zitierte Dialogpartien aufgelockert. Durch den Wegfall des äußeren, objektiv-auktorialen Erzählrahmens muß der stumme Monolog dessen Aufgaben übernehmen. Die zusätzliche Information des Lesers über den zeitlich-räumlichen und situativen Kontext wirkt zuweilen schwerfällig, da der Monologisierende so gezwungen wird, an sich überflüssige, für ihn offensichtliche Wahrnehmungen und Tätigkeiten in seinen Gedanken für den Leser quasi mit zu protokollieren:
"Diese Leute schauen zu, wie ich hereinkomme; ein magerer Herr, mit langen Koteletten, was für ein Ernst! die Tische sind voll; wo soll ich mich hinsetzen? dort eine Lücke; gerade mein gewohnter Platz; man kann einen gewohnten Platz haben; Léa hätte keinen Anlaß, sich darüber lustig zu machen.“1
Auch die appellativen, zum Mitdenken und -lesen auffordernden Imperative vor und innerhalb der Briefretrospektive wirken auf das Leser-Figur-Verhältnis eher kontraproduktiv, wenngleich sie psychologisch motiviert sind:
"Kommen wir auf die Frage zurück; ich will mich damit unterhalten, mir vorzustellen, wie ich die Dinge ordnen würde, wenn ich reich würde; ja, ordnen wir das, beim gehen."2
oder beim Briefelesen im fünften Kapitel: "Schauen wir uns diesen Brief an..."3
Wähnte sich der Leser bisher noch außerhalb dieser Geschichte, konnte er sich vorbehaltlos auf sie einlassen. Aber die Illusion endet mit seiner wiederholten Adressierung. Dieses dialektische Nähe- Distanz-Verhältnis wird uns später noch beschäftigen. Ideal wäre wohl die Übergabe der Beschreibung aller äußeren Geschehnisse in einen auktorialen Erzählrahmen gewesen. Diese sich mit dem Monolog abwechselnde Schilderung des Monologisierenden in der Dritten Person hätte das Notwendige vom Interessanten adäquat isoliert.
Das stumme Selbstgespräch Daniels beinhaltet gängige Erzählweisen. So die direkte Rede in der Form des Selbstgesprächs, in der er wiederum ein Gespräch zwischen sich und Lucien Chavainne rekonstruiert: "Nun, und Ihre Leidenschaft? Fragt er mich; ich werde es ihm sagen."4 Hier wird das erlebende Ich als Figur unter Figuren zum Subjekt einer Personenrede. Aber auch die erlebte Rede findet in Form rhetorischer Selbstbefragung in den Text:
Daniel: "Warum sollte ich denn nicht eine Melone tragen?"5
"Wird Chavainne meine Gefühle denn nie verstehen?"6
Der stumme, innere Monolog Daniels ist formal über weite Strecken ein "innerer Dialog" in direkter Rede, der die "introspektive Verlegenheit"7, wie Fritz Senn die uns vertraute Unsicherheit über unsere Wirkung auf die Umwelt bezeichnet, anschaulich vorführt.
Dujardins innerer Monolog ist in seiner abgekürzten Tagebuchform aber noch zu logisch-kausal durchkonstruiert, zu rational durch die Syntax und Interpunktion gesteuert, als daß der Eindruck eines durchweg autonomen und plausiblen Monologs entstehen könnte. Es hat den Anschein, als spräche der Erzähler durch seinen Helden hindurch.
Arthur Schnitzler - "Leutnant Gustl"
Arthur Schnitzler gilt als Pionier des inneren Monologs in der deutschsprachigen Literatur. Diesen Ruf begründet er im Jahr 1900 mit seiner gesellschaftskritischen Monolognovelle "Leutnant Gustl". Wie Dujardin verzichtet Schnitzler gänzlich auf einen auktorialen Erzählrahmen. Doch Schnitzler beherrscht, möglicherweise auch bedingt durch den Stoff selbst, den stummen Monolog schon organischer. Das Problem der Verlagerung der Informationen des auktorialen Erzählrahmens stellt sich auch bei ihm, aber er geht mit seinem "Helden" sprachlich routinierter um, reduziert die äußere Bewegung des jungen Offiziers auf den Opernbesuch, den Prater und das Kaffeehaus. In beiden Texten lassen sich jedoch die umständlichen Wortkulissen, bedingt durch die omnipräsente Reflektorfigur und die zu wahrenden Leserrücksichten, nicht vermeiden:
"Da ist ja schon mein Kaffeehaus..., auskehren tun sie noch... Na, gehn wir hinein... Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarock spielen... Merkwürdig, ich kann mir's gar nicht vorstellen, daß der Kerl, der immer da hinten sitzt an der Wand, derselbe sein soll, der mich...- Kein Mensch ist noch da... Wo ist denn der Kellner? ... He! Da kommt er aus der Küche..., er schießt schnell in den Frack hinein..."8
Weit stringenter und psychologisch versierter als bei Dujardin spiegeln sich in Gustls Bewußtsein Vorgänge der Außenwelt, vermischen sich Wahrnehmungen, Gedanken und Reflexionen ohne eine explizite Leserorientierung. Der Leser blickt mit den Augen der Reflektorfigur auf die anderen Charaktere der Erzählung und die Welt. Ob rational reflektierend oder irrational aggressiv, wir lernen einen latent antisemitischen und selbstgerechten Leutnant kennen, der die Schuld stets bei anderen sucht. Die Syntax ist in beiden Texten der Situation angepaßt. Selbstreflexive Passagen wechseln mit Erinnerungen, Kommentaren und der Beschreibung äußerer Vorgänge. Kurze Hauptsätze dominieren, reihen sich und verdichten so den sprunghaften Gedankenstrom. Einzelne Satzfragmente und ganze Sätze werden durch Bindestriche verbunden, wodurch der Redefluß über längere Passagen psychologische Kohärenz gewinnt. Schnitzler verdichtet die Sprache zusätzlich durch Auslassungen und nähert sich so der syntaktisch verkürzten, phrasenhaften Alltagssprache an. Zudem charakterisiert er seine Figur durch das österreichische Idiom. Methodisch bedingt bleibt die erzählte Zeit nahezu sklavisch synchron an die Erzählerzeit gebunden. Beide Texte spielen mit den Möglichkeiten dialogischer Dramatik. Entscheidende Situationen im Erzählfortgang werden deshalb - auch um der drohenden Monotonie entgegenzuwirken - in direkter Rede zitiert. So Leutnant Gustl in der Garderobe im Opernhaus:
"Der Dicke da verstellt einem schier die ganze
Garderobe...'Bitte sehr!'
'Geduld, Geduld!'
Was sagt der Kerl?
'Nur ein bissel Geduld!'
Dem muß ich doch antworten ... 'Machen Sie doch Platz!' 'Na, Sie werden's auch nicht versäumen!'
Was sagt er da? Sagt er das zu mir? Das ist doch stark! Das darf ich mir nicht gefallen lassen! 'Ruhig!' 'Was meinen Sie?'
Ah, so ein Ton? Da hört sich doch alles auf! 'Stoßen Sie nicht!'
'Sie, halten Sie das Maul!' Das hätt ich nicht sagen sollen, ich war zu grob ... Na, jetzt ist's schon g'schehn!"9
Um zusätzliche Spannung aufzubauen, orientiert sich Schnitzler am aristotelischen Drama mit seiner FünfAkte-Struktur.
Hier wie bei Dujardin agieren die Nebenfiguren nur als lebendiges Inventar. Beide Texte kreisen um die beobachtererzeugte Realität und die psychische Innenwelt ihrer Protagonisten, vermitteln die subjektiv gefärbte Wahrnehmung ihrer Außenwelt. Der Leser gewinnt nun seine, vielleicht objektivere Sicht und entwickelt hier eine kritische Distanz zur Hauptfigur. Aus diesem Spannungsverhältnis heraus geraten Daniel Prince und Leutnant Gustl zwangsläufig in ein kritisches Licht. Schnitzler hat mit seiner Figur einen sozialen Typ beschrieben. Der Offizier steht für eine ganze Kaste. Sein stummer Monolog konnte einen pervertierten Standes-, Moral- und Ehrbegriff von innen her vorführen und gleichzeitig die Plausibilität des Charakters gewähren. Schnitzler selbst erkannte, daß sich nur wenige Sujets für diese Methode eignen. Prädestiniert ist der stumme innere Monolog für subjektive Erfahrungsberichte, ironisierende Darstellungen, wie auch für die Aufdeckung verborgener Widersprüche zwischen innen und außen, Anspruch und Wirklichkeit.
James Joyce - "Ulysses" - Stephen Dedalus und Molly Bloom
Die Darstellung Stephens Bewußtsein in der "Proteus"-Episode des Ulysses erfolgt merkwürdig ambivalent zwischen objektiver Beobachtung und subjektiver Wahrnehmung. Erzähltechnisch oszilliert der Text zwischen einer fingierten auktorialen (Er) und einer personalen Erzählsituation (Ich), wenngleich es immer Stephen zu sein scheint, der diese "Rollen" übernimmt. Einmal berichtet Stephan objektiv aus einer Außenperspektive in Form einer auktorialen erlebten Rede (Er) über sich selbst, dann wieder springt er in die Innenperspektive einer Reflektorfigur und führt die Situation im stillen Monolog (Ich) fort bzw. umgekehrt. Im Kontext ergibt sich zuweilen ein experimentell-dialogisches Selbstgespräch:
„Ich komme ganz schön voran in der Dunkelheit. Mein Eschenschwert hängt mir an der Seite. Tipp an damit: sie tun's. Meine beiden Füße in seinen Stiefeln sitzen am Ende seiner Beine, nebeneinander.“10
F.K.Stanzel problematisiert allerdings jene Stellen, an denen Bericht und erlebte Rede fließend ineinander übergehen: „Der körnige Sand war verschwunden unter seinen Füßen. Seine Stiefel traten wieder auf feuchte krachende Mast, auf Messerscheidenmuscheln, quietschende Kiesel, verlorene Armada.“11 Die abschließende gedankliche Sentenz "verlorene Armada" relativiert in ihrem persönlichen Kommentarton die auktoriale Erzählhaltung des vorhergehenden. Wie F.K.Stanzel nachgewiesen hat, "kann daher die Grenze nicht bestimmt werden, wo dieser Bericht in erlebte Rede übergeht.“12 Während bei Molly Bloom das Denken stets an authentische, irrationale Gefühle gekoppelt ist und ihre Sprache nur als Medium der Kommunikation dient, neigt Stephen dazu, in seiner epigonalen Beschreibungswut die äußere Welt in teils verklärenden Worten ästhetizistisch zu überhöhen. Stephens intellektuelle Spekulation und affektierte Anspielungskunst zeigen einen phantasiebegabten, assoziativ reflektierenden Schriftsteller. Er inszeniert seine Wirklichkeit mit Hilfe von Kunstwelten im Kopf und versucht so womöglich, die alltägliche Dubliner Tristesse zu kompensieren. Ihm gegenüber steht die Charakterisierung der Molly Bloom durch ihren inneren Monolog im Penelope-Kapitel. Wie schon Leutnant Gustl spiegelt sie als Reflektorfigur innere Vorgänge, aber in einer freieren Syntax. Motiviert durch die gesteigerte Innerlichkeit verzichtet Joyce hier gänzlich auf einen Erzähler. Molly offenbart uns erotische Details, Reflexionen über die Geheimnisse des Lebens, weibliche Eifersucht und eine vitale Naivität. Aber alles Denken ist zugleich gekoppelt an ein Fühlen. Nahezu authentisch sinniert Molly über ihre persönlichsten Erfahrungen, Wünsche und Ängste. Vor ihrem geistigen Auge läßt sie die Schar ihrer Liebhaber Revue passieren, ruft sie die geradezu physischen Erinnerungen auf und durchläuft sie erneut. Ihr Charakter ist, anders als Stephens, durch ein ungebrochenes und tabufreies Verhältnis zu sich selbst und zur Realität bestimmt. Ihre Persönlichkeit entfaltet sich primär aus ihrer einfachen, unkomplizierten und direkten Sprache, aber auch aus dem Kommunizierten selbst. Der Schritt von dem noch halbauktorialen Proteus-Kapitel zu dem der Molly Bloom markiert die Steigerung vom noch spielerisch auktorial durchsetzten, inneren Monolog zum assoziativ ungesteuerten, hierarchiefreien und interpunktionslosen Bewußtseins-strom, frei von jeglichem Erzählereinfluß. Natürlich ist dieser "Stream of consciousness" nicht weniger Produkt eines Autors als andere Erzählweisen, aber er unterliegt produktionsästhetisch der Prämisse höchster Wahrscheinlichkeit in der Abbildung mentaler Vorgänge. Deren Gleichzeitigkeit wird hier nur linear abbildbar. Dem Leser kommt so vor allem Verstehen die Aufgabe der aktiven Rekonstruktion paralleler „Erzählstränge“ zu. Man spricht hier vielleicht besser von semantischen Feldern, mit denen wir in der täglichen Praxis umzugehen geübt sind, und denen wir nahezu automatisch die Phänomene unserer Lebenswelt zuordnen. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, nicht wer hier denkt, sondern - konstruktivistisch gewendet - was in der Figur „denkt“?
Hermann Broch - „Der Tod des Vergil“
Mit Beginn des Romans stellt sich ein offensichtlich auktorialer Erzähler mit einer fast filmisch zu nennenden Totale vor. Eine Kamera steigt über dem Set auf und überblickt in impressionistischer Detailtreue die Hafeneinfahrt, den Troß der ankommenden Prunkschiffe und die jubelnden, demagogisch beherrschten Massen. Der Erzähler berichtet über das erhabene Spektakel um die Ankunft des Kaiser Augustus in Brundisium und kontrastiert es mit dem antizipierten Schicksal des sterbenden römischen Staatsdichters:
„...Doch auf dem unmittelbar hinterdrein folgenden Schiffe befand sich der Dichter der Äneis, und das Zeichen des Todes stand auf seine Stirne geschrieben.“13
In dieser pathetischen Formel und dem begleitenden sachlichen Bericht der Vorgänge gibt sich der Erzähler durch seine ordnende Außensicht als ein von Vergil verschiedenes Bewußtsein zu erkennen.
Während Vergil krank auf dem Deck des Schiffes liegt, vermag der Erzähler von Orten zu berichten, die sich dem Blick Vergils entziehen. Auch die Vorwegnahme des Todes entspricht einer zeitlichen Voraussicht, die Vergil wohl kaum so dramatisch formuliert hätte und die ihrerseits „die Zukunft als bekannt vorwegnimmt“.14 Zugleich zoomt die Erzählung in die Hauptfigur Vergil, wodurch auch die für die personale Perspektive notwendige Pronomen-verwendung vorbereitet wird. Ein tragender Grundwiderspruch des Buches kündigt sich an: hier das römische Imperium des Augustus mit seiner blind ergebenen Masse, dort ein einsamer Dichter, dem Zweifel kommen ob seines staatsnahen Lebenswerks. So wird Vergil als Vertreter einer Mit- und Gegenwelt zugleich eingeführt, der sich mit dem Tode endlich auch der Selbsterkenntnis nähert.
Das Erzähler-Mysterium als „Stimme“ Vergils?
Bereits auf der zweiten Seite fokussiert der Text auf die Innenwelt Vergils:
„So lag er da, er, der Dichter der Äneis, er, Publius Vergilius Maro, er lag da mit herabgemindertem Bewußtsein, beinahe beschämt ob seiner Hilflosigkeit, beinahe erbost ob solchen Schicksals, und er starrte in das perlmutterne Rund der Himmelsschale: warum nur hatte er dem Drängen des Augustus nachgegeben? Warum nur hatte er Athen verlassen?“15
Mit dem Gedankenbericht in der erlebten Rede und den rhetorischen Fragen in der dritten Person gewinnen wir Einblick in das Bewußtsein des reflektierenden Vergil. Das Beispiel beginnt jedoch mit einem subjektiv gefärbten, auktorialen Bericht über den der Situation ausgelieferten Kranken und blendet erst später, fast unmerklich mit dem Doppelpunkt in die Innenwelt der von Selbstzweifeln geplagten Reflektorfigur über. In diesem noch recht übersichtlichen Beispiel wird deutlich, was den ganzen Roman in seinen Erzählweisen dominiert: ständig überlagert sich der auktoriale Erzählerbericht mit dem indirekten stummen Monolog Vergils bzw. wechselt sich ab, oft an der Grenze zur Unentscheidbarkeit. Der Vergilroman paßt in kein bekanntes Romanmuster. Ein weiteres Beispiel soll zeigen, wie der auktoriale Erzählerbericht in seiner gesteigerten Subjektivität mit dem stumm monologisierenden Vergilbewußtsein nahezu verschmilzt. In einer Art Vision antwortet Vergil auf die Stimme des Knaben Lysanias, während der Erzähler diesen imaginären Dialog zunächst nur zu moderieren schien: „‘Du kannst das Mitklingen der Herzen nicht mehr zum Schweigen bringen; ihr Widerhall ist bei dir, unabänderlich wie dein Schatten.’ Es war Versuchung, und ihm war befohlen, sie abzulehnen: ‘Ich will nicht mehr ich sein; ich will in der tiefsten Schattenlosigkeit meines Herzens und in seiner tiefsten Einsamkeit verschwinden, und dahin muß mein Gedicht mir vorausgehen.’ Es erfolgte keine Antwort, es wehte wie Traum aus dem Unsichtbaren, traumeslang, traumeskurz, und schließlich hörte er: ‘Hoffnung will Mithoffnung,...’“16
Nach Lysanias Antwort meldet sich im zweiten Satz eine merkwürdige Doppelperspektive. Einerseits scheint Vergil mit „Es war Versuchung...“ stumm zu reflektieren, andererseits meint man, im „...und ihm war befohlen, sie abzulehnen:“ durch die Er-Perspektive einen Erzähler zu erkennen. Zudem verweist der subjektive, transzendierende Erzählereinschub „...es wehte wie Traum aus dem Unsichtbaren, traumeslang, traumeskurz...“ eher auf Vergils telepathischen Dialog mit Lysanias. Doch eine Rückübertragung in die erste Person Präsens macht plausibel, daß es sich hierbei, trotz aller Verwirrung, um einen stummen indirekten Monolog im Sinne von Brochs Gesamtdefinition des Vergilromans handeln könnte: „Es ist Versuchung, und mir ist befohlen, sie abzulehnen.“ Natürlich kann vom Leser nicht erwartet werden, die Plausibilität der Erzähl-perspektiven mit derartigen Hilfskonstruktionen zu verifizieren. Hermann Broch begegnet diesem Verständnisproblem mit einer pädagogischen Leseanweisung, und will den gesamten Vergilroman als Ausdruck eines „inneren Monologs in der dritten Person“ verstanden wissen, „in der die erste Person, das Ich des Erzählers, nur an jenen Höhepunkten verwendet wurde, da der Monolog sich zum lyrischen Bekenntnis steigert - zum Selbstbekenntnis des Dichters Vergil.“17 Die so beabsichtigte ästhetische Funktionalisierung der Ich- und Er-Perspektive eines direkten und indirekten inneren Monologs bleibt ambivalent. Die auktoriale Er-Perspektive stellt sich - einmal abgesehen von der dritten Person der direkten oder erlebten Gedankenwiedergabe - einerseits als epischer, allwissender und objektiver Erzähler dar, andererseits aber auch als ein individuelles, subjektives Ich, das überwiegend von den Gefühlen Vergils selbst affiziert ist, mit ihm schon von Beginn an die Abscheu vor den Massen und den Ekel vor der Freßgier an Deck des Schiffes teilt. Aber damit wäre der Erzähler zur Person geworden, was den Gesetzen des Monologromans zuwiderliefe. Eher scheint mir der Erzähler durch sein sprachliches Tasten und Reflektieren, seine widersprüchlichen Standpunkte (erhöht, kommentierend oder subjektiv mitfühlend) und sein umfassendes Wissen eine eigene Identität zu entwickeln, die man als überzeitliches Alter ego Vergils oder als kollektives ethisches Bewußtsein interpretieren kann. Brochs Definition ernst nehmen, hieße, Vergil als Objekt seiner eigenen Erzählung zu verstehen, aus der wiederum ein monologisierendes subjektives Vergil-Ich auftaucht. Wir kennen eine ähnliche Methode bereits aus der Proteus-Episode des „Ulysses“. Doris Stephan löst dieses Paradox einer multiplen Identität in ihrer Arbeit zwar auf, dem Leser liegt derlei logische Rekonstruktion zunächst fern. Speziell in diesem Roman problematisiert die Aufhebung der Erzählkonvention ihrerseits die Interpretationskonvention, nach der wir gewohnt sind, Autor, Erzähler und Figur stets getrennt zu betrachten. Die Komplexität der ohnehin schwierig zu bestimmenden Beziehung zwischen Erzähler und Hauptfigur erhöht sich noch zusätzlich mit der Kategorie des Autors, ist aber ohne sie nicht sinnvoll zu erhellen.
Schon nach wenigen Seiten gewinnen der echte innere Gedankenmonolog Vergils und vor allem die Erlebte Rede an Einfluß, können aber die auktoriale Perspektive nicht vollends verdrängen. Es entwickelt sich eine tendenziell personale Erzählsituation, in der der Leser naturgemäß dazu neigt, sich an der Hauptfigur zu orientieren, da hier die Mittelbarkeit durch die Illusion der Unmittelbarkeit überlagert wird. Eine kompromißlose Identifikation mit dem Sterbenden als personalem Medium der Darstellung wird jedoch durch den ethisch-didaktischen Überbau und das philosophische Pathos des quasi- auktorialen Erzählers verstellt. Es entsteht eine unfreiwillige Konkurrenzsituation zwischen beiden in dem Bemühen, das Interesse des Lesers auf sich und ihre Perspektive zu lenken. Wäre der Erzählakt in einem Ich-Erzähler eindeutig verortet, fiele der transzendente und alles integrierende Erzählstandpunkt der psychologischen Plausibilität einer irdischen Person zum Opfer, und gerade das existentiell-utopische Projekt Brochs ginge in der Banalität des Empirischen verloren. Die metaphysische Aufladung des Textes ist jedoch notwendig. Broch selbst motiviert die Absage an die erste Person als tragende „Erzählperspektive“ durch die sich der Vermittlung entziehende Ich-Auflösung seiner Zentralfigur. Aber nur diese Perspektive in der Form des inneren Monologs einer Reflektorfigur - syntaktisch bis an die Grenze der Bewußtseinsstromtechnik geführt - hätte ein Todeserlebnis weniger kompromißbehaftet transportieren können. Im Gegenzug wären allerdings die umfassende Führung des Lesers und die ethische Sendung des Autors einzuschränken sowie eine stärkere Tendenz des Textes ins Enigmatische in Kauf zu nehmen gewesen. Der experimentelle Charakter der Erzählsituationen im Vergilroman ist somit dem eigensten Anliegen Brochs geschuldet, aus der Erfahrung der Apokalypse der beiden Weltkriege heraus unter Verwendung einer Sprache und Denken transzendierenden lyrischen Methode ethisch zu wirken. Im Eindruck einer quasi-religiösen Jenseitsutopie soll das orientierungslose, vereinzelte Subjekt wieder einem allumfassenden Sinn und Wert versichert werden, soll der humanistische Gedanke symbolisch in der heroischen Apotheose Vergils motiviert werden.
Bau und Sprache des Romans
Die Flut-Metaphorik des Meeres als Synonym der völligen Entgrenzung zeigt sich nicht nur in der exzessiv verwendeten Bildsprache fließender und schwebender Zustände. Auch im Bau des Romans schieben sich Bericht-, Kommentar- und Monologpassagen wie in einer Bachschen Fuge übereinander, durchdringen sich, wechseln, tauchen unvermittelt auf und ab, ohne daß sich das Prinzip dieses arbeitenden Bewußtseins vollständig zu erkennen gäbe. Der Text widersetzt sich der Überschaubarkeit, obwohl eine sukzessiv voranschreitende, zeitlich lineare Folge loser Szenen festzustellen ist. Broch integriert verschiedene Erzählweisen (Auktorialer Bericht, Direkte Rede, Erlebte Rede, Innerer Monolog) und löst die Ränder dieser disparaten Teile in gleitenden Übergängen auf oder springt unvermittelt. Die erzähltechnische Basis bildet die auktorial besetzte Erlebte Rede. Aus ihr steigt der Innere Monolog Vergils ekstatisch auf und in sie sinkt er stets zurück, wenn das Geschehen wieder sachlicher und äußerlich wird. Solange sich die Passagen durch den expliziten Er- bzw. impliziten Ich-Bezug als auktorial bzw. monologisch ausweisen, ist die Erzählsituation nahezu eindeutig. Beginnt aber ein zuordnungsfreier Wortstrom, d.h. fehlen das einleitende Verb des Sagens oder Denkens, ein überleitender Doppelpunkt und Anführungsstriche, dann kann einzig der Kontext der Vor- und Nachpassagen Anhaltspunkte für die personale Zuordnung geben, da wir inzwischen auch dem Erzähler ein subjektives Empfinden zuschreiben müssen und sich seine Identität womöglich in der Vergils aufhebt. Oft ist noch nicht einmal klar, ob es sich um Gedachtes oder Gesprochenes, um ein bewußt oder unbewußt erlebendes Ich handelt. Formal wäre die Auflösung der Er-Ich-Distinktion in der Bewußtseinsdarstellung durch die Psychologie motiviert, aber die demonstrative Anwesenheit des Erzählers, seine notorische Pronomenverwendung und seine vermittelnde Darstellung denunzieren die Plausibilität eines einzigen, durchgehenden Sterbemonologs. Auch die Passagen der Direkten Rede Vergils tragen letztlich dazu bei. Doris Stephan argumentiert in diesem Zusammenhang radikaler. Sie identifiziert den Erzähler mit dem Autor und stellt zum berichtenden Stil im Vergilroman fest: „Im Indirekten Inneren Monolog wie in ‘Erlebter Rede’ unterscheidet sich die Aussage des Autors von der des Helden dem Standort, der Einstellung zum Geschehen und der Funktion der Sprache nach.“18 Wenngleich auf der Kategorie des Erzählers nicht ohne weiteres zu verzichten ist, scheint mir dieser Ansatz der perspektivischen Zuordnung plausibel und praktikabel. So charakterisieren sprachlich emotive Gesten wie „oh“ und „ach“ oder ein unsicheres „wohl“ sowie die rhetorischen Fragen die Äußerung als eine persönlich gefärbte Vergils. Dagegen verweist die explizite Nah- und Ferndeixis (hier, dort, da, oben, unten) bzw. die zeitliche Einordnung des Geschehens (plötzlich, rasch, nun), die rhetorisch redundanten Satzfiguren sowie die Pronomenverwendung eher auf den Erzähler als eine bezugsstiftende, ordnende Instanz. Die subtile sprachliche Überlagerung von Erzähler und Hauptfigur kann nur auf Basis dieser Signale entschlüsselt werden, wenngleich Brochs Intention dieser Klarheit entgegenarbeitet: „...und es gehört zu den besonderen Leistungen dieses Buches, daß es das unaufhörliche Wechselspiel zwischen dem Rationalen und dem Irrationalen in jedem Augenblick aufdeckt...“ und danach trachtet, „...in jedem Darstellungsmoment das Kontradiktorische der Seele zur Einheit zu bringen“.19 Letztlich bleibt der Leser auf sich zurückverwiesen, die Ambivalenz dieses changierenden Erzählers in einem affirmativen Akt zu überwinden und sich ganz der suggestiven Sprache zu überlassen.
Die Sprach- und Identitätskrise Vergils
Der Erzähler gesteht Vergil nur sporadisch, nur an neuralgischen Punkten im Erzählfortgang, eine eigene Stimme in der expliziten Form des direkten inneren Monologs (Ich) zu:
„...das ganze Schiff war von Gier umflackert. Oh, sie verdienten es, einmal richtig dargestellt zu werden! Ein Gesang der Gier müßte ihnen gewidmet werden! Doch was sollte dies schon nützen?! nichts vermag der Dichter, keinem Übel vermag er abzuhelfen; er wird nur dann gehört, wenn er die Welt verherrlicht, nicht jedoch, wenn er sie darstellt, wie sie ist. Bloß die Lüge ist Ruhm, nicht die Erkenntnis! Und wäre es da denkbar, daß der Äneis eine andere, eine bessere Wirkung vergönnt sein sollte? Ach, man wird sie preisen, weil noch alles, was er geschrieben hatte, gepriesen worden war...“20
Die poetologische Selbstreflexion des Dichters legt hier einen stummen Monolog Vergils nahe, in dem er über Beruf und Berufung des Dichtertums sinniert. Unvermittelt wechselt die implizite Ich-Perspektive des stummen Gedankenmonologs am Ende des Beispiels in die Er-Perspektive des Berichts. Der Erzähler entzieht dem desillusionierten Vergil noch im selben Satz das Wort, obwohl zunächst das emotive „Ach“ Vergils Gedanken weiter zu führen schien.
Vergils Leben erfüllte sich bisher in der Sprache, jedoch als Ausdruck eines falschen Bewußtseins von einer selektiv wahrgenommenen, verklärten Realität. Im Eindruck des antizipierten Todes will der Apologet der augusteischen Pax romana sich ein letztes Mal gegen sein verschwendetes Leben auflehnen und zu wahrer Totalitätserkenntnis gelangen:
„Lauschend in diese Sprachentiefe, hatte er gehofft das Sterben belauschen zu dürfen, hatte er gehofft ein Wissen, wenn auch nur den ahnenden Schimmer eines Vorwissens um jene Grenzerkenntnis zu erhaschen, die bereits Erkenntnis außerhalb der irdischen Erkenntnis wäre,...“21
„...überirdischen Mächten und überirdischen Mitteln ist dies vorbehalten,(...), einer Sprache, die außerhalb des Stimmengestrüpps und aller irdischen Sprachlichkeit stehen müßte, einer Sprache, die mehr wäre als Musik, einer Sprache, die es dem Auge gestattete, herzschlagend und herzschlagrasch, die Erkenntniseinheit des Seins zu erfassen, wahrlich einer neuen, einer noch nicht gefundenen, überirdischen Sprache bedürfe es...“22
Diese dialektische Einheit von Todes- und Erkenntnisnähe spiegelt Vergils Todesgier, die Grenzen empirischer Erfahrung zu überwinden und so in eine andere Wirklichkeit überzutreten. Dort erwartet er sich Befreiung von der Schwere einer materiellen Existenz, denn erst der Sterbende erkennt die Gemeinschaft, erkennt die Liebe, erkennt das Zwischenreich,...
Die Schwerelosigkeit einer geistigen Existenz soll mit einer Sprache jenseits der Sprache erfüllt werden.
Vergils Zweifel an der Erkenntnisfähigkeit der Sprache sind durchaus typisch für mystische Denktraditionen und begründen die geradezu physische Rückwendung zur Natur in einer Situation geistiger Haltlosigkeit:
„Oh, unbändig wurde da der Wunsch, die Hand nach diesen, ach so sehr entfernten Ufern auszustrecken, in die Dunkelheit der Gebüsche zu greifen, das erdentsprossene Laub zwischen den Fingern zu spüren, es festzuhalten für immerdar-, der Wunsch zuckte in seinen Händen, zuckte in den Fingern vor unzügelbarem Begehren nach dem grünen Blattwerk, nach den geschmeidigen Blattstengeln,[...], er spürte es sehnend, wenn er die Augen schloß, und es war eine geradezu sinnliche Sehnsucht,[...]; oh, Gras, oh, Laub, oh, Rindenglätte und Rindenrauhheit, Lebendigkeit des Sprießens, vielfältige, in sich verzweigte und körperliche Erddunkelheit! oh, Hand, fühlende, tastende, aufnehmende, einschließende Hand,...“23
Dieser Gedanken- und Gefühlsbericht kulminiert in einer monologisch-hymnischen Beschwörung der Naturlebendigkeit, als deren Teil sich Vergil schließlich selbst begreift. Wie bei Stephen im "Ulysses" wird hier der Übergang zur erlebten Rede nur durch das Ausbleiben des auktorialen Er-Bezugs und den Kontext evident. Der gesteigerte Wunsch sinnlicher Wahrnehmung zeigt Vergils zunehmende Verinnerlichung der Außenwelt. Das Festhaltenwollen ist typisch für eine Sterbesituation. In seiner Beweglichkeit eingeschränkt, wissend um das nahende Ende, wächst die Konzentration auf die einfache Dingwelt und zugleich die Sensibilisierung des gesamten Wahr-nehmungsapparates - Riechen, Hören, Tasten steigert sich bis zur Idiosynkrasie. Die damit verbundene radikale Subjektivierung entzieht sich definitorisch jeder Intersubjektivität. Erzähl-technisch gesehen ist die Verwendung des inneren Monologs - stellenweise mit Ambitionen zum Bewußtseinsstrom - zur Darstellung einer beobachtererzeugten Realität nur logisch konsequent. Vergil begibt sich auf eine Reise zur Selbstfindung in Form einer Metamorphose, an der uns Broch teilhaben läßt. Der Fluchtpunkt des Geschehens verlagert sich von der anfangs noch dominierenden Äußerlichkeit zusehends hinein in die von empirischen Zwängen befreite Innenwelt des Sterbenden. Der Kopf wird zum einzigen Erkenntnisraum, zum „telepathischen Bunker“ eines hypostasierten Wertsubjekts. Das Geschehen wird atmosphärisch reicher und zugleich seelisch eindringlicher, wie es die objektive Darstellung nicht gekonnt hätte. Die offensichtliche Sprachkrise Vergils führt paradoxerweise nicht zu einem völligen Versagen im Ausdruck, sondern formiert sich im ganzen Roman zu einem letzten großen Furioso, das mit dem Sterben und der finalen Emphase des Dichters einher geht, ja durch sie motiviert ist. Durch die exklusive Wortwahl, den langen, schwingenden, aber noch unkomplizierten Satz und die eigenwillige Interpunktion potenzieren sich die Probleme einer Interpretation auf‘s Neue. Auch die ungewöhnliche Motivfülle, die musikalische Leitmotivtechnik sowie die vielen Abstrakta, Paradoxa und Oxymora verweisen auf das Bemühen um eine Sprache jenseits der konventionellen Ausdrucksmöglichkeiten. Diese komplexe Sprachkonstruktion, vor allem der prägende lyrische Ton, ist glaubhaft in der Profession der Hauptfigur autorisiert. Dazu Broch: „Das Lyrische erfaßt die tiefsten seelischen Realitäten.“ und „...nur das Lyrische vermag diese Einheit der antinomischen Gegensätze herzustellen.“24 Aus dieser erkenntnistheoretischen Obsession heraus will Broch das Irrationale von Welt, Mensch und Tod in der Totalität des Kunstwerkes spiegeln. In den vielen widersprüchlichen Partizipialkonstruktionen (contradictio in adiecto), den Antithesen und den zahlreichen Neologismen wird ein zunächst nicht Vorstellbares sprachlich behauptet. Es ist der beständige Versuch, unkonkretes, nicht erfahrbares in seiner Polyvalenz doch faßbar zu machen. Die Neuschöpfung der Welt steht im Zeichen des Wortes. Das Dilemma besteht in dem notwendigen Bewahren der Fremdheit der Phänomene unter der kompromißbehafteten Bedingung ihrer grundsätzlichen Kommunizierbarkeit. So sind wohl die unterschiedlich abstrakten Metaphysik-Niveaus ganz bestimmten Realitätsgraden Vergils zuzuordnen.
Brochs Interpunktion stellt neue Sinneinheiten her, indem sie monumentale Satzgebilde über ganze Seiten hinweg zu Absätzen verbindet bzw. trennt. Ästhetisch ist das hehre Anliegen „ein Gedanke, ein Moment, ein Satz“25 zur Darstellung von Simultaneität durchaus begründet. Aber wir wissen inzwischen, daß das Gehirn extrem lange Sätze schwerer zu einem Sinnkomplex verarbeiten kann, als Sätze in einem Gegenwartsfenster bis zu drei Sekunden Länge. Das sprachliche Wachhalten eines Momentes über mehrere Seiten erfordert Prägnanz und Bezugdichte in der Darstellung der Phänomene, nicht episches Auswalzen.
Angekommen im Palast des Augustus stellt sich Erleichterung für den Gehetzten ein. Erste, transzendierende Wahrnehmungsphänomene zeigen sich sprachlich in den Synästhesien Vergils:
„...und darein verwoben wehte schleierstreifengleich, einmal näher, einmal entfernter, die Musik aus dem Vordergebäude, Klangschleier um Klangschleier, bestickt mit Zymbelpunkten, eingebettet in den grauen Nebel der Stimmen, mit dem das Fest dort über sich selbst hinaussickerte, dort ein klingender schmetternder Lichterlärm, hier nur noch ein weicher Klangnebel, der im ungeheueren Nacht-Raum verrieselte...“26
Mit dem zweiten Kapitel „Feuer - Der Abstieg“ hebt eine geistige Konzentration und Retro-spektive an, gleichzeitig intensiviert sich der körperliche Zerfall zur physischen Selbstentfremdung in den Metaphern unüberwindbarer Schwerkraft und ferner Kontinente:
„...all diese Bereiche des Körperlichen und Überkörperlichen, harte Wirklichkeit des steinernen Knochengerüstes, sie wurden in ihrer ganzen Fremdheit, in ihrer zerfallenen Brüchigkeit, in ihrer Entlegenheit, in ihrer Feindlichkeit, in ihrer unerfaßlichen Unendlichkeit von ihm gewußt...“27
Vergil sehnt den Tod herbei und beginnt, sich mit dem topographischen All zu identifizieren:
„...eingesenkt Geist wie Körper in das Schiff seines Seins, hingebreitet über die weiten Erdflächen, er selber Berg, selber Feld, selber Erde, selber das Schiff, er selber der Ozean ... er lauschte dem Sterben.“28
Sprachlich wird das Kapitel von der Dynamik gegenläufiger Motive beherrscht. Broch versucht, mit artistischen Antithesen und zahlreichen Neologismen das Kontradiktorische der Seele zur Einheit zu bringen, und so die „Sprache“ Vergils der außergewöhnlichen Sterbesituation anzupassen. Komposita wie Dämmerkerker 29 und Versteinerung 30 charakterisieren Vergils Situation hilflosen Ausgeliefertseins. Die Nacht bringt dem Sterbenden quälende Fieberträume, aber auch den alles erhellenden Erkenntnisprozess. So werden die multiplen Metamorphosen Vergils, die in einer Apotheose münden, in diesem Kapitel theoretisch vorweggenommen. Phasen der „Überwachheit“ wechseln mit Phasen tiefer Depression. Stellenweise blendet der Text syntaktisch in eine lyrische Diktion über, obwohl sich inhaltlich und sprachlich kaum etwas ändert. Einzig der Rhythmus der umgebrochenen Sätze wird durch die graphische Aufbereitung neu betont. Blöcke werden geformt, Aussagen durch ihre Isolierung hervorgehoben und für sich gestellt. Diese lyrischen Reminiszenzen wirken etwas unmotiviert eingeschoben, zumindest bis Seite 190, da die Interpunktion und - sieht man von der Überlänge der Sätze ab - der konventionelle Satzbau strikt weitergeführt werden. Erst als Vergil im Traum zu sprechen beginnt, wird die Sprache selbst etwas lyrischer; Großbuchstaben markieren jetzt den Zeilenanfang.
In den platonischen Dialogen des dritten Kapitels („Erde - Die Erwartung“) veräußern sich die inneren Konflikte Vergils zum dialogischen Meinungsaustausch über den gesellschafts-politischen Anspruch des Dichters. Um seine latente Außenseiterposition als Hofdichter hatte Vergil zeitlebens gewußt, doch die Erfahrung existentieller Vereinzelung verdichtet sich nach den Gesprächen mit den Freunden zu der bitteren Erkenntnis, daß er seinen Vertrauten unverstanden gegenübersteht. Für Vergil als Dichter ist die Kommunikation jedoch lebens-bestimmend, woraus folgt, daß hier dem physischen Tod ein kommunikativer vorausgeht. Vergil ist dem Tod und damit der Erkenntnis näher als die Lebenden. Im vierten Kapitel „Äther - Die Heimkehr“ wird die Hauptfigur zunehmend eigenschaftsloser. Durch eine Art Selbsthypnose befindet sich Vergil in einer rücklaufenden Schöpfungsgeschichte - einer umfassenden Regression. Wir durchleben mit ihm verschiedene Phasen der Ich-Auflösung und Einswerdung mit dem All. Der Regression zum Tierischen folgt die zum Pflanzlichen, schließlich zum All selbst. Die im ersten Kapitel noch metaphorische Beschreibung des freßgierigen Hofstaates an Deck des Schiffes31 korrespondiert jetzt mit Vergils tatsächlicher Metamorphose zum Tier im vierten Kapitel durch die sprachlichen Parallelen:
„...und mehr und mehr erfüllte ihn das Tierhafte und vereinfachte ihn zu dem aufgestellten Tier, als das er sich fühlte -, Tier von unten bis oben, Tier von oben bis unten, als klaffender Rachen, mochte er auch nicht zuschnappen, als Krallenträger, mochte er auch kein Wild reißen, als Gefiedertes und Hakenschnäbliges, mochte er auch nicht zustoßen, und das Tier in sich tragend, das Tier von innen sehend, hörte er der Tiere stumme Sprache, [...], eine Verständigung mit dem Vorkreatürlichen, mit dem Vorerschaffenen, [...] ein Erkennen wölfischer, füchsiger, katziger, papageiiger, pferdiger, haiiger Wesenheiten, so eröffnete sich jetzt hiezu das tierisch Eigenschaftslose in noch ungeborener und erst werdender, noch ungeformter Eigenschaft...“32
Hier wird der innere Zustand Vergils mit äußeren Bildern und Vorstellungen assoziiert; methodisch hält sich dieses grundlegende Darstellungsprinzip über den ganzen Roman durch. Umgekehrt evoziert der direkte innere Monolog Vergils die einzigen „authentischen“ Bilder für den Leser. Erst durch diese reziproke Verweisungsstruktur und die Anteile der vermittelten Erlebten Rede wird die Situation des Sterbenden kommuniziert. Die fortgesetzten Metamorphosen münden in die völlige Auflösung jeder denkbaren tierischen, pflanzlichen oder gegenständlichen Gestalt und Identität: „...er jedoch, er, der Schauende, auch er ergriffen vom Allwachstum, er, der Pflanzenverwobene, der Tierverwobene, auch er erstreckte sich durch die Sterngezeiten des Alls...“33 Es geht um die Annäherung an das Absolute, um die Welt als Idee. Die Worte werden deiktisch, wir finden Antithesen, die statt auf eine Gegenwelt auf
eine Welt jenseits aller vorstellbaren verweisen. Signifikat und Signifikant, die Grundbestandteile der Bedeutungskonstitution, referieren nicht mehr auf unsere bekannte Vorstellungswelt. Gleichzeitig gewinnt die Sprache eine suggestive Kraft, die den Verlust der Gegenstände kompensiert. Es ist das utopische Unterwegssein der Worte zur Sprache. Wir können nicht mehr von einer Romanfigur sprechen. Der abstrakte Text hat sich längst von seiner mimetischen Abbildfunktion gelöst und evoziert jetzt Seelenbilder, die jenseits unserer Erkenntniskategorien - Raum und Zeit - liegen. Zwar korrespondiert die quasi-auktoriale Beschreibung noch mit einem Subjekt des Textes, aber dieses „Er“ kann nicht mehr der uns vertraute Vergil sein. Es ist ein namenloses Einauge, dessen Identität sich in der Verschmelzung mit dem All, mit Gott, der in allem ist, „aufgelöst“ hat und jetzt an einem metaphysischen Begriff des Alls partizipiert.
„...vergessen das, worüber er hingeschritten und woraus er geformt gewesen war, und die Gestaltlosigkeit seiner Riesengestalt war in ihrer Durchsichtigkeit ebenso ungreifbar wie das Licht, ebenso ungreifbar wie die flüssige Weltenkuppel, die ihn umgab, durchsichtigster Schatten: er bestand nur mehr aus Auge, aus dem Auge in seiner Stirn.“34
Erst die Korrespondenz verschiedener Textstellen innerhalb einer Leitmotivtechnik verbindet Anfang und Ende des Buches als zeitlich lineare Sukzession zu einem zirkulären Motiv, das sich auch in der rückläufigen Schöpfung des letzten Kapitels spiegelt. Die „Heimkehr“ des Kapitel-namens verweist auf die Rückkehr zum Anfang, zum Ausgangspunkt der Lebensreise des Dichters und zum mythischen Ursprung schlechthin. Der Text wird radikal eigengesetzlich. Es ist nicht klar, in welcher Sinn- und Bewußtseinsebene das hier Geschriebene eingeordnet werden muß. Wenn Verstehen Auslegen impliziert, kann der Leser selbst diese Passagen in der Apotheose des Dichters zur humanistischen Führfigur motiviert sehen.
Ein Fazit des Vergleichs
Mag Joyce für Broch in gewissem Sinne ein Vorbild gewesen sein, so unterscheiden sich doch beide Romane fundamental. Anders als im „Ulysses“ folgen wir im Vergilroman nicht dem banalen Alltag einer bewußt gewählten, eher repräsentativen Figurengruppe, sondern dem einsamen und individuellen Sterben des prominentesten Dichters im augusteischen Rom jenseits aller Alltäglichkeit. Hier werden vor allem ethische und philosophische Fragen zur Erkenntnisfähigkeit des Menschen verhandelt, die sich durch ihre überzeitliche Aktualität auszeichnen. Joyce und Broch verbindet jedoch das experimentelle Anliegen, die Sprache als Gegenstand und als Instrument der Vermittlung zu thematisieren. Beide Texte sind auf ihre Weise durch schier endlose Konnotationen und intertextuelle Bezüge überdeterminiert. Bei Broch der Wunsch, die Sprache in einer experimentellen Form an eine enigmatische Grenze zu treiben, bei Joyce das Projekt einer letzten Totalität im Bewußtsein ihrer Unmöglichkeit, die enzyklopädische Aufhebung der Sprache und ihrer Idiome. Wo Joyce sich voll und ganz auf das kunstvolle Spiel mit dem vorhandenen Sprachmaterial konzentriert, geht Broch von diesem aus, um eine neue Sprache und mit ihr ein neues Denken zu erschaffen. All dies eingelassen in einen Text, der einem Dichter entsprungen ist. Allen vier Texten liegt ein innerer Monolog zu Grunde, gleichwohl in sehr verschiedener Intensität. Bei Dujardin und Schnitzler noch das vergleichsweise bescheidene Anliegen, durch eine Reflektorfigur zeigen zu lassen, wie die Dinge wahrgenommen werden und wie der uns so selbstverständliche, aber komplexe Begriff von Realität im Bewußtsein entsteht. Beide haben sich mit ihrer tendenziell authentischen Darstellung an die Innenwelt ihrer Protagonisten maximal angenähert, aber noch syntaktische und semantische Kompromisse geschlossen, die wohl noch der literarischen Tradition geschuldet sind. Joyce radikalisiert den inneren Monolog der Molly Bloom zum prototypischen Bewußtseinsstrom. Broch beansprucht für seinen ganzen Roman den inneren Monolog als lyrisches Gedicht. Ersteres bleibt Behauptung, da es sich im Vergilroman offensichtlich um ein verdichtetes Stilgemisch handelt, in dem Erzählerbericht und Erlebte Rede dominieren. Der reine direkte innere Monolog Vergils findet nur ephemere Anwendung. So können wir hier nicht von einer authentischen Reflektorfigur im Sinne der oben behandelten Protagonisten sprechen. Die von Broch anders interpretierten Implikationen der psychologischen Kohärenz werden zum Problem des Lesers, wie es in Ansätzen schon im halbauktorialen, inneren Monolog Stephens deutlich wurde. Der Leser wird gezwungen, Er- und Ich-Perspektive zu einem Vergil-Ich zu synthetisieren.
Bibliographie
Primärtexte:
Irene Riesen: Die Lorbeerbäume sind geschnitten, Übersetzung, Haffmans Verlag 19??
Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl, Insel-Bücherei Nr.612 Insel-Verlag, Leipzig 1983
James Joyce: Ulysses, Übersetzung Hans Wollschläger, 2 Bände, Volk und Welt Berlin 1980
Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Kommentierte Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366
Sekundärtexte:
- Wolfgang Kayser: Das Problem des Erzählers im Roman. In: Zur Struktur des Romans, Hrg. Bruno Hillebrand, 1978
- F.K.Stanzel: Die Erzählsituationen im ‘Ulysses’. In: Zur Struktur des Romans, Hrg. Bruno Hillebrand, 1978
- F.K.Stanzel: Die Personalisierung des Erzählaktes im ‘Ulysses’. In: Zur Struktur des Romans, Hrg. Bruno Hillebrand, 1978
- Therese Fischer-Seidel: Charakter als Mimesis und Rhetorik, Bewußtseinsdarstellung in Joyces ‘Ulysses’. In: Zur Struktur des Romans, Hrg. Bruno Hillebrand, 1978
- Bruno Hillebrand: Theorie des Romans, 3.Auflage, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 1996
- Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa, 8.Auflage, Opladen: Westdt.Verlag 1998
- Franz.K.Stanzel: Theorie des Erzählens, 6.Auflage, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1995
- Klaus Heydemann: Die Stilebenen in Hermann Brochs ‘Der Tod des Vergil’, Diss. Verlag Notring, Wien 1972
- Kindler Literatur-Lexikon
- Barbara Lube: Sprache und Metaphorik in Hermann Brochs Roman ‘Der Tod des Vergil’, Verlag Peter Lang, Frankfurt a.M. 1986
- Doris Stephan: Der innere Monolog in Hermann Brochs ‘Der Tod des Vergil’, Mainz 1957
- Moderne Literatur in Grundbegriffen, Hrg. Dieter Borchmeyer und Viktor Zmegac, 2.Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1994
[...]
1 Übersetzung von Irene Riesen: Die Lorbeerbäume sind geschnitten, Zürich 1984, S. 21
2 Ebd. S. 38
3 Ebd. S. 71
4 Ebd. S. 10
5 Ebd. S. 10
6 Ebd. S. 11
7 Fritz Senn im Nachwort der Übersetzung: Die Lorbeerbäume sind geschnitten, Zürich 1984, S. 161
8 Arthur Schnitzler: Leutnant Gustl, Insel-Bücherei Nr.612 Insel-Verlag, Leipzig 1983, S. 41
9 Ebd. S. 13
10 James Joyce: Ulysses, Band I, Übersetzung Hans Wollschläger, Volk und Welt, Berlin 1980, S. 54
11 Ebd. S. 60
12 F.K.Stanzel: Die Erzählsituationen im 'Ulysses' In: Zur Struktur des Romans, Hrg. Bruno Hillebrand 1978, S. 278
13 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 11
14 Doris Stephan, Diss.: Der innere Monolog in Hermann Brochs ‘Der Tod des Vergil’, Mainz 1957, S. 98
15 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 12
16 Ebd. S. 171
17 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 470
18 Doris Stephan, Diss.: Der innere Monolog in Hermann Brochs ‘Der Tod des Vergil’, Mainz 1957, S.95 10
19 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 474f
20 Ebd. S. 15
21 Ebd. S. 85
22 Ebd. S. 86
23 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 17
24 Hermann Broch: Der Tod des Vergil, Komm. Werkausgabe Band 4, Suhrkamp Taschenbuch 2366, S. 473f
25 Ebd. S. 476
26 Ebd. S. 53
27 Ebd. S. 73
28 Ebd. S. 74
29 Ebd. S. 87
30 Ebd. S. 165
31 Ebd. S. 15
32 Ebd. S. 438
33 Ebd. S. 445
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Innere Monolog und wie wird er in der Literatur dargestellt?
Der Innere Monolog ist eine Erzähltechnik, die Einblick in die Gedanken und das Bewusstsein einer Figur gibt. Er wird verwendet, um subjektive Erfahrungen, Wahrnehmungen und Reflexionen direkt wiederzugeben. Im Gegensatz zu einem auktorialen Erzähler, der die Perspektive von außen einnimmt, ermöglicht der Innere Monolog dem Leser, die Welt durch die Augen der Figur zu sehen und ihre inneren Prozesse unmittelbar zu erleben. Die Entwicklung dieser Technik wird an Werken von Edouard Dujardin, Arthur Schnitzler, James Joyce und Hermann Broch illustriert.
Welche Werke werden im Vergleich der Entwicklung des Inneren Monologs betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf folgende Werke:
- Edouard Dujardin - "Die Lorbeerbäume sind geschnitten" ("Les Lauriers sont coupés")
- Arthur Schnitzler - "Leutnant Gustl"
- James Joyce - "Ulysses" (insbesondere die Episoden um Stephen Dedalus und Molly Bloom)
- Hermann Broch - "Der Tod des Vergil"
Was ist die Bedeutung von Edouard Dujardins "Die Lorbeerbäume sind geschnitten" für die Entwicklung des Inneren Monologs?
Edouard Dujardin gilt als Begründer des Inneren Monologs in der Literatur. Sein Roman "Die Lorbeerbäume sind geschnitten" ("Les Lauriers sont coupés") von 1887 wird als frühes Beispiel für diese Technik betrachtet. Der Roman verzichtet auf einen auktorialen Erzählrahmen und präsentiert stattdessen die Gedanken des Protagonisten Daniel Prince in einer Art stummen Monolog.
Wie unterscheidet sich der Innere Monolog in Arthur Schnitzlers "Leutnant Gustl" von dem Dujardins?
Arthur Schnitzler perfektioniert den Inneren Monolog in "Leutnant Gustl", indem er ihn organischer und psychologisch versierter einsetzt. Im Vergleich zu Dujardin gelingt es Schnitzler besser, die äußere Welt und die inneren Vorgänge im Bewusstsein des Protagonisten zu vermischen, ohne explizite Leserorientierung. Die Syntax ist der Situation angepasst, und der Text spiegelt den sprunghaften Gedankenstrom des Leutnants wider.
Welche Rolle spielen Stephen Dedalus und Molly Bloom in James Joyce' "Ulysses" in Bezug auf den Inneren Monolog?
In "Ulysses" verwendet James Joyce den Inneren Monolog auf unterschiedliche Weise für Stephen Dedalus und Molly Bloom. Während Stephens Bewusstsein zwischen objektiver Beobachtung und subjektiver Wahrnehmung schwankt, wird Mollys Monolog im Penelope-Kapitel zu einem ungezügelten Bewusstseinsstrom, der frei von Erzählereinfluss ist. Molly offenbart erotische Details, Reflexionen über das Leben und eine vitale Naivität, während Stephens Monolog von intellektuellen Spekulationen und ästhetizistischen Überhöhungen geprägt ist.
Was sind die zentralen Themen in Hermann Brochs "Der Tod des Vergil" und wie wird der Innere Monolog eingesetzt?
Hermann Brochs "Der Tod des Vergil" thematisiert die Sprach- und Identitätskrise des Dichters Vergil im Angesicht des Todes. Der Roman verwendet eine komplexe Erzählstruktur, in der sich auktorialer Erzählerbericht, indirekter stummer Monolog und erlebte Rede überlagern. Broch will den gesamten Roman als Ausdruck eines "inneren Monologs in der dritten Person" verstanden wissen, in dem die Ich-Perspektive nur an Höhepunkten zum lyrischen Bekenntnis gesteigert wird.
Wie wird die Sprachkrise Vergils in Hermann Brochs Roman dargestellt?
Vergils Sprachkrise manifestiert sich in seinen Zweifeln an der Erkenntnisfähigkeit der Sprache. Er sehnt sich nach einer Sprache jenseits der irdischen Sprachlichkeit, einer Sprache, die die Einheit des Seins erfassen kann. Dieser Zustand führt zu einer Rückwendung zur Natur und zu einer monologisch-hymnischen Beschwörung der Naturlebendigkeit.
Was ist die Bedeutung der Metamorphosen Vergils im vierten Kapitel von Brochs Roman?
Die Metamorphosen Vergils im vierten Kapitel ("Äther - Die Heimkehr") symbolisieren die Auflösung des Ich und die Einswerdung mit dem All. Vergil durchläuft eine rücklaufende Schöpfungsgeschichte, in der er sich von tierischen und pflanzlichen Formen befreit und schließlich in einem metaphysischen Begriff des Alls aufgeht.
Welches Fazit lässt sich aus dem Vergleich der verschiedenen Formen des Inneren Monologs ziehen?
Der Vergleich zeigt die Entwicklung des Inneren Monologs von den frühen, eher konventionellen Darstellungen bei Dujardin und Schnitzler bis hin zu den radikalen Experimenten von Joyce und Broch. Während Dujardin und Schnitzler sich um eine authentische Darstellung der Innenwelt ihrer Protagonisten bemühen, radikalisiert Joyce den Inneren Monolog zum Bewusstseinsstrom. Broch beansprucht für seinen gesamten Roman den Status eines lyrischen Gedichts in Form des Inneren Monologs, obwohl die Erzählstruktur komplexer ist und Erzählerbericht und erlebte Rede dominieren.
Welche Sekundärliteratur wird zur Analyse des Inneren Monologs herangezogen?
Die Analyse stützt sich auf Werke von Wolfgang Kayser, F.K. Stanzel, Therese Fischer-Seidel, Bruno Hillebrand, Jochen Vogt, Klaus Heydemann, Barbara Lube, Doris Stephan und Beiträgen aus "Moderne Literatur in Grundbegriffen", herausgegeben von Dieter Borchmeyer und Viktor Zmegac.
- Citar trabajo
- Rene Damm (Autor), 2001, Der innere Monolog in Hermann Brochs Roman, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101186