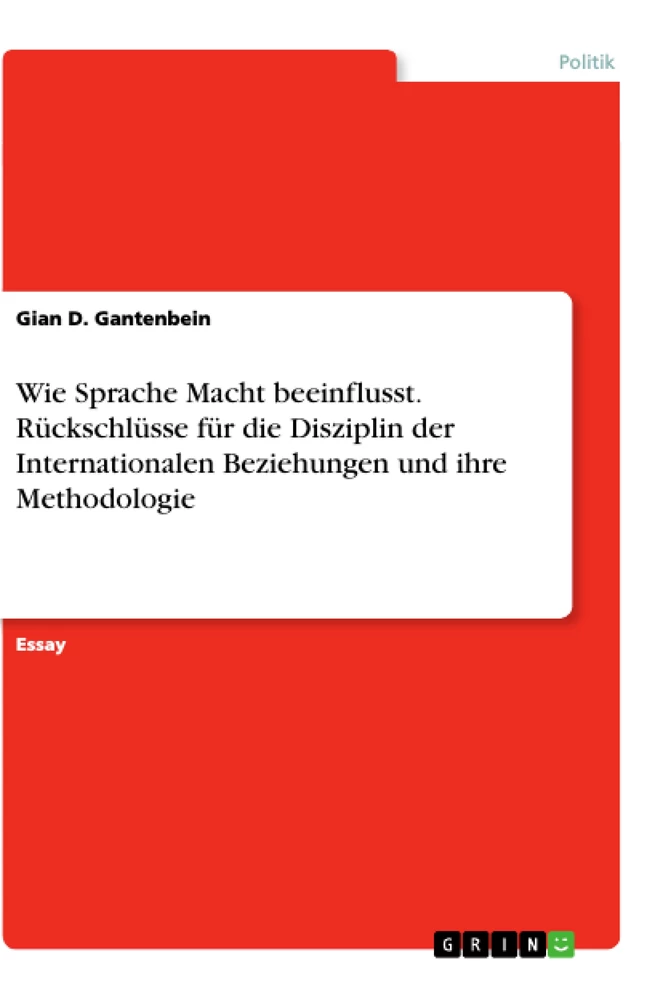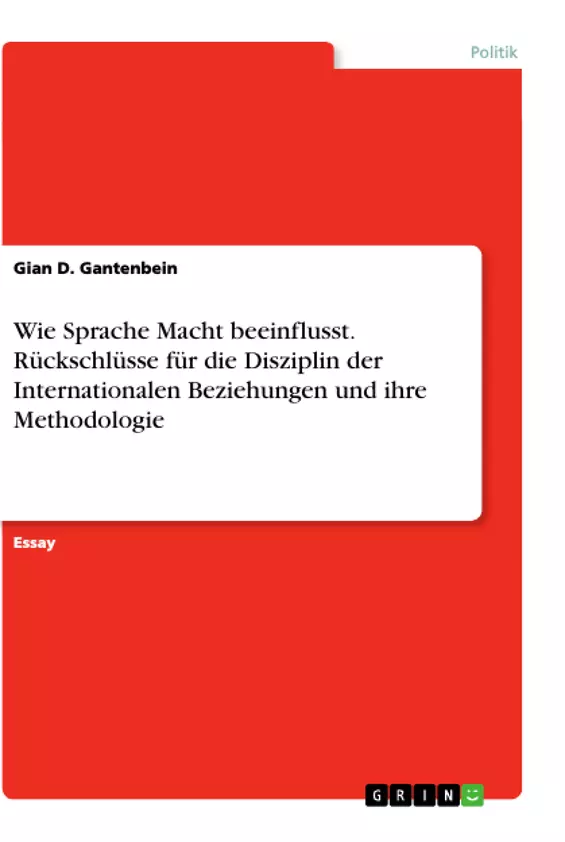Dieses Essay hat zum Ziel, das Verständnis von Macht, unter Einbezug des Einflusses von Sprache, herauszuarbeiten und zu zeigen, in welcher Wechselbeziehung Sprache und Macht stehen.
Dafür wird zunächst ein Rahmen geschaffen, in dem Macht in diesem Essay betrachtet wird, dann der Einfluss der Sprache rekonstruiert und im Anschluss anhand zweier Beispiele untermauert. Die deutsche Außenpolitik in Bezug auf Namibia und die Gender-Debatte verdeutlichen, welche methodischen und epistemologischen Rückschlüsse aus dieser Thematik zu ziehen sind.
Die Vereinten Nationen (UN) haben 193 Mitgliedsstaaten, jedoch nur sechs offizielle Sprachen. Zwar repräsentieren diese einen großen Teil der Weltbevölkerung und erleichtern die Kommunikation der UN, aber sie erreichen zugleich Hunderte Millionen Menschen nicht. Der Grund dafür liegt in der Entstehungsgeschichte der UN nach dem Zweiten Weltkrieg.
Bis heute sind die offiziellen UN-Sprachen die der Siegermächte, ergänzt durch Spanisch und Chinesisch. Deutsch und Japanisch, die gemeinsam auf etwa 200 Millionen MuttersprachlerInnen kommen, sind keine offiziellen UN-Sprachen. Genauso Hindi mit etwa 260 Millionen (SIL International 2014), ganz zu schweigen von Tausenden von Dialekten und Sprachen mit einer jeweils kleineren Anzahl von Sprechenden. Dass diese Sprachen bewusst nicht zu den offiziellen UN-Sprachen zählen, hat damit zu tun, wie die Sprache im Verhältnis zur Macht steht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was bedeutet Macht?
- Max Weber
- Michel Foucault
- Der Einfluss der Sprache
- Sprache und Macht
- Foucaults Diskursbegriff
- Max Webers Ansatz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Essay untersucht den Einfluss der Sprache auf das Verständnis von Macht. Es soll herausgearbeitet werden, in welcher Wechselbeziehung Sprache und Macht stehen. Dazu wird zunächst ein Rahmen für die Betrachtung von Macht geschaffen, anschließend der Einfluss der Sprache rekonstruiert und anhand zweier Beispiele veranschaulicht.
- Definition und Analyse von Macht
- Der Diskursbegriff und seine Auswirkungen auf Machtverhältnisse
- Sprache als Mittel der Herrschaft und der Konstruktion von Grenzen
- Die Wechselbeziehung zwischen Sprache, Normen und Wissen
- Methodische und epistemologische Konsequenzen des Zusammenhangs zwischen Sprache und Macht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Sprache und Macht ein und stellt den Zusammenhang zwischen Sprache und Macht im Kontext der Vereinten Nationen heraus. Das Kapitel "Was bedeutet Macht?" präsentiert zwei unterschiedliche Machtdefinitionen von Max Weber und Michel Foucault. Die klassische Machtdefinition von Weber wird mit Foucaults vielseitigen Überlegungen über Macht kontrastiert, um den Einfluss der Sprache auf die Wandlung des Machtbegriffs zu beleuchten.
Der Abschnitt "Der Einfluss der Sprache" argumentiert, dass Sprache nicht nur ein Mittel zur Verständigung ist, sondern auch die Grundlage für die Entstehung von Wissen und die Konstruktion von Machtverhältnissen darstellt. Dabei wird der Diskursbegriff von Foucault beleuchtet, der den Diskurs nicht als bloße Diskussion, sondern als eine Praktik aus der die Erkenntnis über die Dinge hervorgeht, betrachtet. Das Kapitel analysiert auch Webers Ansatz, der Sprache als Mittel der Herrschaft in der Erziehung und der Schule sieht.
Schlüsselwörter
Dieser Essay befasst sich mit den zentralen Begriffen von Macht und Sprache sowie deren komplexer Beziehung. Die Kernthemen des Textes sind Machtdefinitionen, Diskursanalyse, Herrschaft, Sprache als Mittel der Herrschaft und die Konstruktion von Grenzen.
- Quote paper
- Gian D. Gantenbein (Author), 2020, Wie Sprache Macht beeinflusst. Rückschlüsse für die Disziplin der Internationalen Beziehungen und ihre Methodologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1011949