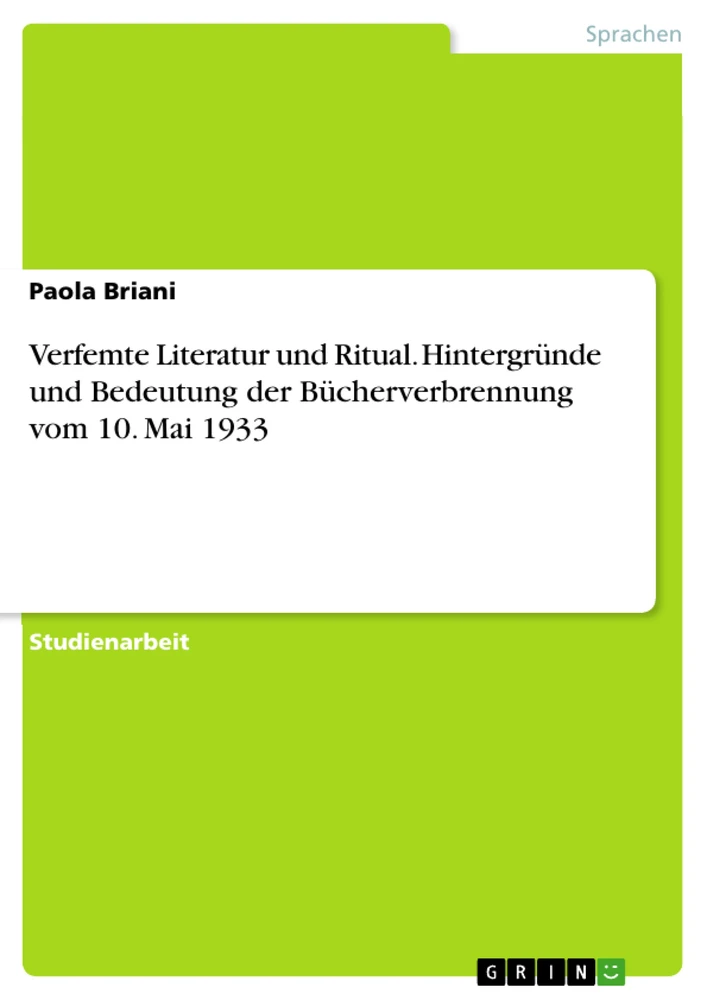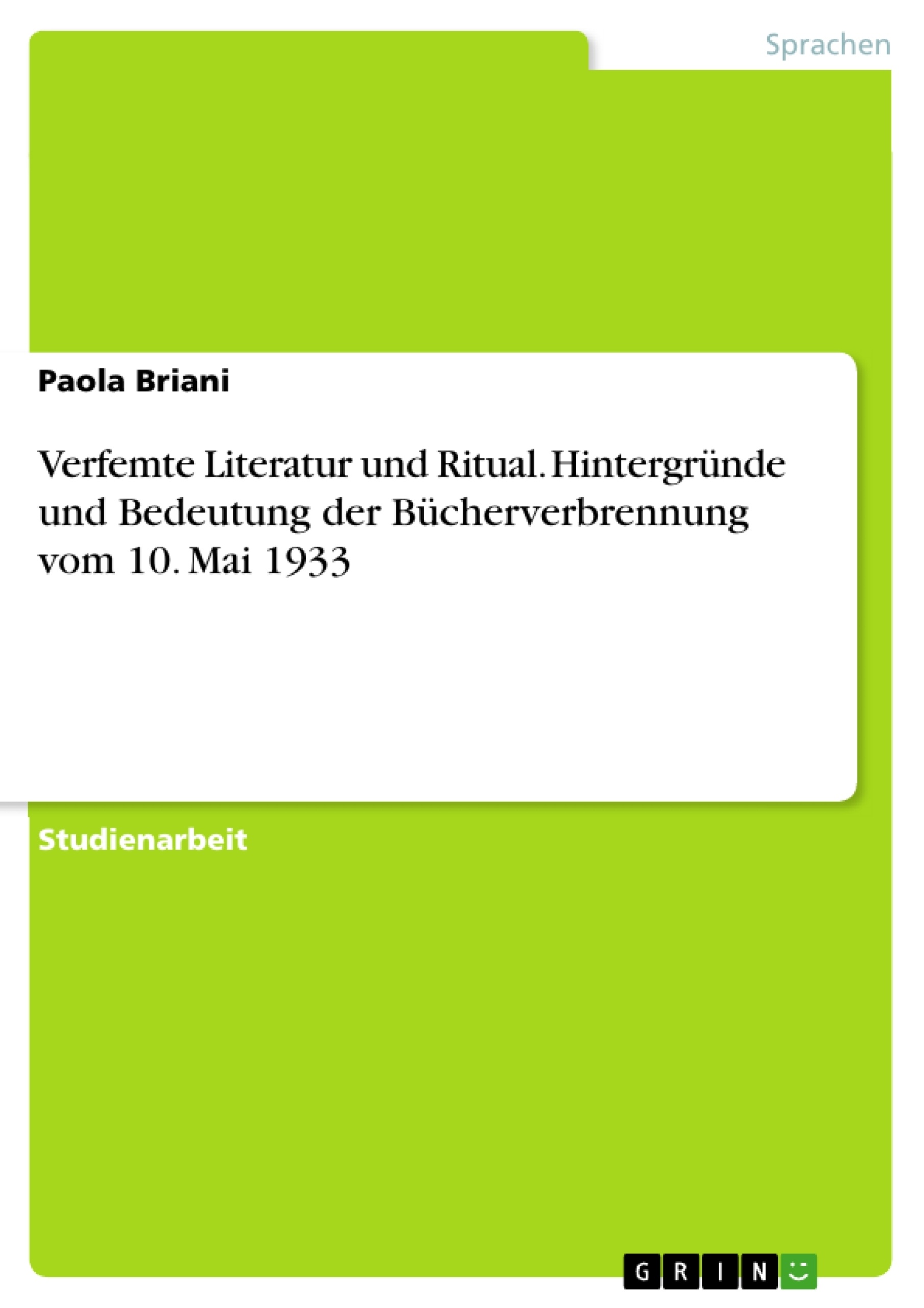Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema der reichsweiten Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten, wobei der Schwerpunkt auf die Hintergründe und die Bedeutung für die Vernichtung literarischer Werke in ritueller Form gelegt wird. Das Fallbeispiel bildet dabei das Autodafé des 10. Mai 1933 in der Stadt Berlin.
Im zweiten Kapitel soll zunächst kurz auf den historischen Hintergrund der Bücherverbrennung des Jahres 1933 eingegangen werden. Es soll der historische Rahmen geschaffen werden, innerhalb dessen sich die »Aktion wider den undeutschen Geist« (hier ‚Aktion’) abspielte.
Im Anschluss an den historischen Rahmen behandle ich die Frage nach der Urheberschaft der ‚Aktion’. Dabei soll geklärt werden, ob sie von oben oder von den Universitätsstudenten gelenkt wurde.
Zum besseren Verständnis der Hintergründe der ‚Aktion’ gehe ich erst kurz auf deren Hauptakteure, die Deutsche Studentenschaft (kurz DSt) und den Nationalsozialistischen Deutschen Studentenschaftsbund (kurz NSDStB) ein, um dann zu belegen, dass die völkisch-nationalen und nationalsozialistischen Anschauungen bereits lange vor der Machtergreifung an deutschen Hochschulen verwurzelt waren. Die ‚Aktion’ galt für diese Gruppen als Anstoß zu einer neu orientierten Literaturpolitik unter nationalsozialistischer Herrschaft, welche die sogenannte Säuberung des Reiches von unliebsamen Autoren begründen sollte.
Das Ausmaß des Kampfes der Nationalsozialisten gegen „artfremde“ und „deutschfeindliche“ Literatur zeigen unter anderem die Vorbereitungsphasen, welche den in ritualisierter Form durchgeführten Bücherverbrennungen vorausgingen: Planung, Aufklärungs- und Sammlungsaktion.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- >>Aktion wider den undeutschen Geist«< am 10. Mai 1933
- Historischer Kontext: Machtergreifung 30. Januar 1933
- Die Drahtzieher der »Aktion wider den undeutschen Geist«
- Planung und Durchführung der »Aktion wider den undeutschen Geist«
- Das Berliner Autodafé am 10. Mai 1933
- Ritual
- Grundmerkmale des Rituals am Beispiel des Berliner Autodafés
- Funktion des Rituals des Berliner Autodafés
- Gründe für die Vernichtung ausgewählter Literatur
- Die Gleichschaltung des Kultur- und Literaturbetriebs am Beispiel des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler
- Schriftliche Quellen: Schwarze Listen und Feuersprüche
- Die programmatische Konstruktion des „Eigen-Fremde“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die reichsweite Bücherverbrennung durch die Nationalsozialisten und konzentriert sich insbesondere auf die Hintergründe und die Bedeutung der rituellen Vernichtung von literarischen Werken. Das Berliner Autodafé vom 10. Mai 1933 dient als Fallbeispiel.
- Historischer Kontext der Bücherverbrennung von 1933
- Analyse der „Aktion wider den undeutschen Geist“ und deren Drahtzieher
- Untersuchung der rituellen Handlung der Bücherverbrennung in Berlin
- Identifizierung der Gründe für die Vernichtung literarischer Werke
- Analyse der programmatischen Konstruktion des „Eigen-Fremde“
Zusammenfassung der Kapitel
Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der Bücherverbrennung und die Entstehung der „Aktion wider den undeutschen Geist“. Es wird untersucht, wer die Initiative für die Aktion ergriff und welche Rolle die Deutsche Studentenschaft und der Nationalsozialistische Deutsche Studentenschaftsbund (NSDStB) dabei spielten. Das Berliner Autodafé wird als Höhepunkt der Aktion beschrieben, bei dem Werke von verfemten Autoren wie Lion Feuchtwanger, Ernst Gläser und Arthur Holitscher verbrannt wurden.
Das dritte Kapitel analysiert die rituellen Elemente des Berliner Autodafés. Es werden die Grundmerkmale von Ritualen erläutert und anhand des Fallbeispiels untersucht. Die Funktion des Rituals, insbesondere in Bezug auf die gezielte Veränderung kultureller Werte und die Entstehung einer neuen Identität, wird beleuchtet.
Das vierte Kapitel behandelt die Gründe für die Vernichtung der ausgewählten Literatur. Es wird die Zusammenarbeit des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler mit den Nationalsozialisten beleuchtet und anhand von Quellen wie Schwarzen Listen und Feuersprüchen erläutert, welche Kriterien für die Vernichtung der Werke ausschlaggebend waren. Die Konstruktion des „Eigen-Fremde“ wird als zentrales Element der nationalsozialistischen Kulturpolitik dargestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die Bücherverbrennung 1933, die „Aktion wider den undeutschen Geist“, das Berliner Autodafé, Ritual, Kulturpolitik, „Eigen-Fremde“, Schwarze Listen und Feuersprüche. Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Bücherverbrennung als Instrument zur Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie und der Etablierung einer neuen kulturellen Identität.
- Citation du texte
- Paola Briani (Auteur), 2019, Verfemte Literatur und Ritual. Hintergründe und Bedeutung der Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012037