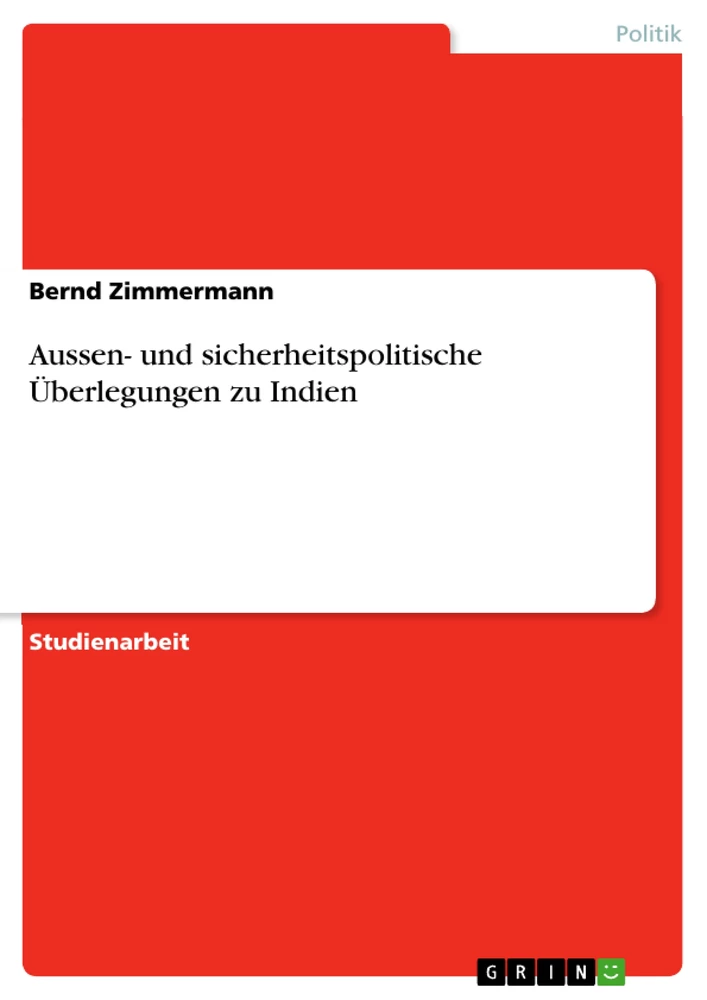Gliederung
1. Einführung
2. Der Wandel des politischen stems vom „Kongresssystem“ zur Regionalisierung und seine Bedeutung für die innere abilität Indiens
3. Die wirtschaftliche Entwicklung im Zeichen der Globalisierung und ihre außenpolitische Dimension
4. Die asiatischen Regionen und ihre Bedeutung für Indien
5. Die Beziehung zwischen Indien und der Volksrepublik China
6. Die Annäherung Indiens an die U
7. Der Aufstieg Indiens zur Atommacht und die offenen Fragen seiner Abschreckungsdoktrin
8. Ausblick
9. Literatur- und Quellenhinweise
1. Einführung
Die Atomtests vom Mai 1998 haben der Welt die technologischen und militärischen Fähigkeiten der Indischen Union vor Augen geführt und der Außen- und Sicherheitspolitik dieses Landes verstärkte Aufmerksamkeit und Interesse der internationalen Akteure verschafft. Die hindunationalistische BJP Regierung unterstrich mit dieser Machtdemonstration den Anspruch Indiens, in der neuen, multipolaren Weltordnung, als globaler und nicht nur als regionaler Akteur zu gelten. Das sich der mächtigste Mann der Welt, US Präsident Clinton, im März dieses Jahres ganze vier Tage für einen Staatsbesuch in Indien Zeit nahm, legt die Vermutung nahe, dass dieses Kalkül aufgeht.
Im Zentrum der indischen Außen- und Sicherheitspolitik steht seit Gründung der Indischen Union das Streben nach internationalem Einfluss und Status, woraus die Konkurrenz zur Volksrepublik China, erwuchs, dem aufgrund seiner Größe und geographischen Lage „natürlichen Rivalen“ Indiens. Demgegenüber nimmt der, wesentlich medienpräsentere, Konflikt mit Pakistan einen deutlich geringeren Stellenwert ein (ein kurzer Blick auf die Größen- und Kräfteverhältnisse zeigt, dass Pakistan nie ein ernsthafter Konkurrent Indiens sein kann).
Doch die Größe des Landes und der Bevölkerung stellt die indische Sicherheitspolitik auch vor erhebliche Herausforderungen, denn die innere Sicherheit der Republik ist durch zahlreiche soziale, religiöse und politische Konfliktlinien bedroht, die nach wie vor virulent sind.
Die Fragen, die im folgenden diskutiert werden sollen, beziehen sich hauptsächlich auf die Veränderungen nach 1991 in den Bereichen politische Stabilität, Wirtschaft (Herausforderung durch ökonomische Globalisierung) und Militär (Aufstieg zur Atommacht). In diesem Zusammenhang sollen auch Indiens regionale Initiativen sowie die Annäherung an die USA und die Volksrepublik China beleuchtet werden.
2. Der Wandel des politischen Systems vom „Kongresssystem“ zur Regionalisierung und seine Bedeutung für die innere Stabilität Indiens
Eine der politisch folgenreichsten Entwicklungen ist die Transformation des politischen Systems von der Einparteiendominanz der Kongresspartei zu einem immer stärker regionalisierten Parteiensystem. Die Wahlergebnisse von 1996, 1998 und 1999 machen deutlich, dass sich die indische Parteienlandschaft auf dem Weg zu einem pluralistischen Mehrparteiensystem befindet.
Der Niedergang der Kongresspartei symbolisiert auch den tiefgreifenden sozialen Wandel der indischen Gesellschaft sowie das Entstehen neuer Konfliktlinien und Wählerbindungen. Bei der Unterhauswahl 1998 erreichte die Kongresspartei nur noch 25% der Wählerstimmen, im Vergleich zu über 40% seit 1952. Zugleich steigt der Anteil der Regionalparteien weiter an, alleine zwischen 1996 und 1998 von 24 auf 29% (vgl. WAGNER 1998, 29). Auch die Regierungsbildung auf Unionsebene zeigt, dass nationale Parteien zunehmend auf Regionalparteien als Koalitionspartner und Mehrheitsbeschaffer angewiesen sind. So führt der amtierende Premierminister Vajpayee eine Koalitionsregierung von nicht weniger als vierzehn Parteien. Die Einbindung in eine so breit gefächerte Allianz dämpft aber auch die Durchsetzungsfähigkeit radikaler hinduistischer Kräfte (nicht nur innerhalb der BJP) und wirkt sich mäßigend auf das politische Klima aus.
Die Gefahren dieser Entwicklung liegen in einer „Weimarerisierung“ des Parlaments, d.h. einer gegenseitigen Blockade der Parteien mit wechselnden Koalitionen und unklaren Mehrheitsverhältnissen, worunter die notwendige Führung und Entwicklung des Landes erheblich leiden würde. Andererseits zeigen die vorangegangen Regierungswechsel, die ausnahmslos demokratisch vonstatten gegangen sind, eine bemerkenswerte demokratische Reife des indischen Regierungssystems und einen breiten Konsens zur nationalen Einheit, trotz aller Regionalisierungstendenzen. Es ist daher anzunehmen, dass die zunehmende Partizipation der Regionen am politischen Prozess eher eine Stabilisierung der innenpolitischen Verhältnisse mit sich bringt, auch wenn das Austarieren der zahlreicher werdenden Partikularinteressen schwieriger werden dürfte.
Für die Annahme der Stabilisierung spricht auch das Vertrauen, dass die Bevölkerung der Regierung und dem demokratischen System entgegenbringt. So waren 1996 über 77% des Wahlvolkes mit ihrer Führung zufrieden oder sehr zufrieden, mehr als zwei Drittel befürworteten, trotz aller Missstände, die Demokratie und ihre Institutionen und nur 16,2% lehnten sie ab. Die Wahlbeteiligung liegt seit der dritten Parlamentswahl konstant über 50% und oft sogar über 60% und übertrifft damit die entsprechenden Werte amerikanischer Wahlgänge (vgl. MITRA 2000).
Die größte Demokratie der Erde kann somit als gefestigt gelten, zumal es keine (ausreichend starken) Akteure gibt, wie etwa Militär oder radikale religiöse und politische Gruppen, die ihre Legitimität grundsätzlich in Frage stellen.
3. Die wirtschaftliche Entwicklung im Zeichen der Globalisierung und ihre außenpolitische Dimension
Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen des zweiten Golfkrieges von 1991 wurde in Indien eine Zahlungskrise ausgelöst, die schonungslos die Schwächen des indischen (Staats)wirtschaftssystems aufdeckte. Es wurde deutlich, dass die bisherige Wirtschaftspolitik den immer stärker werdenden Globalisierungstendenzen nicht mehr gerecht werden würde. Die neue Regierung Rao brach mit der sozialistischen Tradition der Kongresspartei und sein Wirtschaftsminister Manmohan Singh begann mit dem Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, öffnete das Land für die dringend benötigten Direktinvestitionen, senkte Zölle, vereinfachte die Einfuhr von Kapitalgütern und baute das System der Produktionslizenzen ab. Alle diese Maßnahmen wurden auch unter dem Eindruck des Zerfalls, respektive des Scheiterns des sozialistischen Wirtschaftssystems der UDSSR getroffen. Eine weitere Motivation für diese wirtschaftspolitische Wende war sicherlich auch, nicht zu weit hinter das prosperierende China zurückzufallen, dessen Wirtschaft zu dieser Zeit zweistellige Zuwachsraten verbuchte und dadurch nicht nur sehr viel ausländische Investitionen ins Land lockte, sondern auch seine politische Stellung in Asien und auf der internationalen Bühne stärkte.
Die Reformen zeigten Wirkung und das Bruttosozialprodukt wuchs ab 1992 zwar immer noch nicht so stark wie das chinesische, doch hatte dieses seine höchste Wachstumsrate schon 1992 erreicht, während das indische Wachstum heuer zu neuen Höhenflügen ansetzt und nach Schätzungen der Asian Development Bank in diesem Jahr höher ausfallen wird, als das des Reichs der Mitte (vgl. FOLLATH 2000, 308). Dieser Erfolg ist Vajpayees Politik der Kontinuität im Reformprozess zuzuschreiben, die trotz des von des BJP propagierten Konzepts von swadeshi, d.h. wirtschaftliche Eigenständigkeit, genauer: Konsumgüterbereich reserviert für indische Unternehmen und Modernisierung der Infrastruktur für ausländische Unternehmen, die Öffnung aller Wirtschaftssektoren vorantrieb. Im Finanz- und Versicherungssektor sind die Liberalisierungsbemühungen auch aufgrund der Koalitionssituation bisher am wenigsten fortgeschritten. Der geringen Verflechtung dieser Branchen mit dem Weltfinanzsystem verdankt Indien aber auch, dass es die Asienkrise 1997/98 mit einem blauen Auge überstanden hat.
Der Reformprozess brachte auch Probleme mit sich. Das Haushaltsdefizit wuchs schneller als die Wirtschaft und Indien zählt heute zu den höchstverschuldeten Ländern der Welt. Zu einer Zerreisprobe für die innere Stabilität Indiens könnten sich die regionalen Disparitäten entwickeln, die sich zu Lasten der ärmeren Bundesstaaten verschärfen und sich, wie in Bihar und Orissa, durch Naturkatastrophen noch weiter verschlimmern. Während die großen Wirtschaftzentren Bombay, Bangalore, Hyderabad (auch „Cyberabad“ genannt) und Neu Delhi boomen, können die ländlichen Gebiete mit der Entwicklung kaum Schritt halten. Die Frage nach einer möglichen Reform der zumeist unrentablen und veralteten Staatsbetriebe birgt ebenfalls innenpolitischen Sprengstoff, da bei deren Schließung oder Privatisierung Millionen Menschen arbeitslos werden würden und die politischen Widerstände daher kaum zu überwinden scheinen.
Auch in der Außenpolitik Indiens erlangten die ökonomischen Faktoren und die wirtschaftlichen Interessen einen neuen Stellenwert. 1993 nahm die Regierung Rao eine vollständige außenpolitische Neuorientierung vor, die einen Übergang zur Wirtschaftsdiplomatie bedeutete. Das Personal der Auslandsvertretungen wurde durch entsprechend geschulte Kräfte verstärkt und die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen zu einem Schwerpunkt der Außenpolitik erklärt. Diesem Konzept liegt bis heute die Überlegung zu Grunde, durch eine selbstbestimmte Adaption möglichst viel Souveränität und nationalen Entscheidungsspielraum gegen den wachsenden Anpassungsdruck der Globalisierung zu bewahren.
4. Die asiatischen Regionen und ihre Bedeutung für Indien
Seit Ende des Kalten Krieges nimmt die zentrale Stellung der Groß- und Supermächte für die indische Außenpolitik und für die internationale Politik Indiens langsam, aber unaufhaltsam ab. Dies hat natürlich zum einen etwas mit dem erstarkten Selbstbewusstsein einer aufstrebenden Nation zu tun, zum anderen mit einem Bedeutungswandel asiatischer Regionen für indische Interessen. Durch Erweiterung, Vertiefung und mögliche Institutionalisierung versucht die indische Regierung, die übergreifenden Aspekte der nationalen Sicherheit zu stabilisieren.
Die Regierung unter Gujaral (der gleichzeitig Außenminister war) leitete 1997 eine neue Ära in der Außenpolitik gegenüber den Nachbarstaaten ein (Gujaral-Doktrin), die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruht und auf der Prämisse, dass Indien als Hegemonialmacht seinen kleineren Nachbarn stärker entgegenkommen müsse (asymmetrische Kompromisse). Damit verlieh Gujaral der Zusammenarbeit und den vertrauensbildendenden Maßnahmen in der Außenpolitik ein deutlich größeres Gewicht als es früher üblich war. Auch konnten auf Grundlage dieser Doktrin einige Erfolge, z.B. mit Bangladesh bezüglich der Ganges- Regulierung, erzielt werden.
Die Chancen für eine tatsächliche politische Partnerschaft mit den unmittelbaren Nachbarn sind aber angesichts der erdrückenden Dominanz Indiens in Südasien eher bescheiden. Wirtschaftlich spielen die Anrainerstaaten für die indische Ökonomie keine große Rolle, so dass kaum ein wirtschaftlicher Anreiz für engere Beziehungen besteht. Strategisch militärisch fällt regional nur Pakistan ins Gewicht, das aber nach dem Militärputsch mehr mit innenpolitischen und ökonomischen Problemen zu kämpfen hat und deshalb sowohl strategisch als auch wirtschaftlich für die außen- und sicherheitspolitischen Interessen Indiens auf absehbare Zeit eher von nachgeordneter Bedeutung sein dürfte.
Im erweiterten asiatischen Umfeld fällt hauptsächlich das verstärkte Engagement indischen Kapitals in den westasiatischen Staaten auf. Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung der indisch-iranischen Beziehungen, die vor allem der Absicherung des Zugangs zu natürlichen Ressourcen (Öl) dienen, die die expandierende indische Wirtschaft dringend benötigen, zudem ist der Iran Pakistans Gegenspieler im Afghanistan-Konflikt. Darüber hinaus bietet nicht nur der Iran, sondern auch andere asiatische Staaten einen großen Absatzmarkt für indische Erzeugnisse. Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Bemühungen Indiens um Zusammenarbeit bzw. Aufnahme in die ASEAN und APEC zu bewerten (die ihrerseits natürlich die indische Mittelschicht als Käufer ihrer Produkte im Visier haben). Auch bei den von Indien mitinitiierten Kooperationen Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IORARC)1 und Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand- Economic Cooperation (BIMST-EC) steht für Indien der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen im Vordergrund, vorwiegend mit den Wachstumsökonomien Südostasiens (vgl. WEIDEMANN 1998, 12 und MISHRA 2000, 2).
Bleibt noch die südasiatische Regionalkooperation SAARC2 zu erwähnen, die, trotz der obigen Aussage (ein Elefant und sechs Zwerge), zumindest den Dialog zwischen den Mitgliedsstaaten gewährleistet und einen Rahmen für bilaterale Abkommen bietet. Zudem können durch die Stärkung von transnationalen Akteuren in der SAARC und den anderen Kooperationen und Regimen Gegengewichte zu außenpolitischen Hardlinern oder extremistischen Parteien und Gruppierungen gebildet werden. Mit der Strategie einer verstärkten asiatisch-regionalen Zusammenarbeit versucht Indien, sich gegen die nachteiligen Effekte der Globalisierung zu schützen und ein eigenes Handelsnetzwerk aufzubauen, dass nicht von der „Triade“ USA, EU und Japan (langfristig China) dominiert wird. Die indische (Außen)politik wird sich in Zukunft also noch stärker nach Asien orientieren.
5. Die Beziehung zwischen Indien und der Volksrepublik China
Trotz der schon angesprochenen Rivalität, der offenen Frage der Grenzziehung zwischen Indien und China und der chinesischen Rüstungshilfe für Pakistans Atomwaffenprogramm, begannen sich die Beziehungen zwischen den beiden bevölkerungsstärksten Ländern der Welt seit Mitte der 80er Jahre zu entspannen. Rajiv Gandhi legte 1988 mit seinem Besuch in Peking den Grundstein für die Annäherung der beiden Riesenreiche.
Seither fallen auch die Stellungnahmen indischer Spitzenpolitiker zu anderen neuralgischen Punkten in Bezug auf China moderat aus. Die indische Haltung zu Tibet ist seit Anfang der 90er Jahre die, dass es Tibet als autonomes Gebiet der Volksrepublik betrachtet, daran hat sich auch unter der BJP Regierung nichts geändert. Auf der anderen Seite betonen chinesische Politiker, dass Nepal seine Probleme mit seinem übermächtigen südlichen Nachbarn ohne die Hilfe Chinas lösen müsse (was die Chinesen nicht davon abhält, durch den Bau von Krankenhäusern, Wasserkraftwerken und anderer Infrastruktur eine chinafreundliche Stimmung in Nepal zu erzeugen).
Im September 1993 wurde mit dem Abkommen über Ruhe und Sicherheit an der gemeinsamen Grenze ein Durchbruch in den bilateralen Beziehungen erzielt. Der umstrittene Grenzverlauf wird seither in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe (Joint Working Group, JWG) beraten. Eine weitere vertrauensbildende Maßnahme bestand in der Öffnung zweier Bergpässe im März 1995, die der besseren Kontaktaufnahme der Grenztruppen dienen sollte. Indien betrachtete dabei die Öffnung eines Passes in Sikkim als die Annerkennung seines Anspruchs auf dieses Territorium. Dennoch ist der Konflikt bis heute nicht gelöst. Doch ist ein erneuter Waffengang Chinas zur Eroberung von beanspruchten Gebieten in Arunachal Pradesh angesichts des „Kosten-Nutzen-Verhältnisses“ sehr unwahrscheinlich. Außerdem hat China mit seinem Vorstoß von 1962 seine militärisch-strategischen Ziele zum größten Teil erreicht.
Beide Seiten sind zudem so rational, um zu erkennen, dass ein neuer Grenzkrieg wesentlich mehr Nachteile als Vorteile bringen würde. Die Zeiten, da Staaten durch gewaltsame territoriale Expansion ihre Machtbasis vergrößern konnten, sind in der heutigen Welt multilateraler wechselseitiger Abhängigkeiten entgültig vorbei. Aus diesen Gründen ist auch die BJP Regierung daran interessiert, die beiderseitigen Gespräche im Rahmen der JWG fortzusetzen, auch wenn das Klima seit der Regierungsübernahme durch die BJP etwas abgekühlt ist und Verteidigungsminister Fernandes sich kurz nach seinem Amtsantritt zu der Äußerung hinreisen lies, dass China Indiens potenzieller Feind Nummer eins sei. Heute relativiert er diplomatisch: „ Wir verhandeln derzeit mit Peking und können alle Probleme friedlich lösen “ (FOLLATH 2000, 304)
Auch nach den indischen Atomwaffentests stehen also die Zeichen weiter auf Entspannung - oder zumindest nicht auf Eskalation - davon zeugt auch das Zitat des chinesischen Botschafters in Indien, der die offizielle Haltung seiner Regierung diesbezüglich am 25. März dieses Jahres mit folgenden Worten auf den Punkt brachte: „ Beijing does not view India as a threat to its security “ (SOUTH ASIAN ANALYSIS GROUP 2000)
6. Die Annäherung Indiens an die USA
Die neuen wirtschaftlichen Interessen der Indischen Union in Folge der Liberalisierungspolitik seit 1991 förderten die Annäherung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Der Zerfall der Sowjetunion, mit der Indien trotz Blockfreiheit besondere Beziehungen unterhielt, und die damit einhergehenden Veränderungen der internationalen Konstellationen, erforderten ebenfalls eine neue strategische Orientierung der indischen Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei konnte Narasimha Rao und seine Nachfolger auf den Erfolgen des Besuchs Rajiv Gandhis in Washington 1985 und des Gegenbesuchs des damaligen Verteidigungsministers Caspar Weinberger 1986 aufbauen. Im Indischen Ozean wurden sogar gemeinsame Manöver von Marineeinheiten im Rahmen der neuen militärischen Zusammenarbeit durchgeführt. Dies ist um so bemerkenswerter, als Indien solche Manöver mit seinem größten Rüstungslieferanten, der UDSSR, nie exerziert hatte. Ein deutliches Zeichen also für die Wahrnehmung neuer außen- und sicherheitspolitischer Handlungsoptionen der Indischen Union und eine Aufweichung von Nehrus Konzept der Nichtbindung (non-alignment), das nach Beendigung des kalten Krieges ohnehin obsolet geworden ist.
Als positive Aspekte für eine intensivere Zusammenarbeit gelten die Verbundenheit zu angelsächsischen Rechts- und Bildungstraditionen, die gemeinsame Amtssprache Englisch und die demokratischen Werte, zu denen sich beide Staaten verpflichtet fühlen. Übereinstimmende Sicherheitsinteressen sehen beide Seiten gegenüber einem stärker werdenden islamischen Fundamentalismus v.a. in Zentral- und Westasien. Für Neu Delhi geht es dabei um mehr als nur Terrorismusbekämpfung; eine religiöse Radikalisierung Pakistans oder gar der 120 Mio. muslimischer Inder würde die Stabilität im Lande und in der Region gefährden. Wahrscheinlich hatte Präsident Clinton auch diese Gefahren im Blick, als er bei seiner Visite auf dem Subkontinent von Südasien als gefährlichster Region der Welt sprach. Doch der Besuch des US-Präsidenten wurde in Indien auch als Ausdruck der gewachsenen Bedeutung Indiens in der Welt gesehen und der Führer der freien Welt bezog gegenüber Pakistan eindeutig Stellung für Indien, zur großen Genugtuung desselben.
Darüber hinaus wurde die Aufmerksamkeit der amerikanischen Wirtschaft auf Indien gelenkt, das auf Grund seiner (aus amerikanischer Sicht) instabilen politischen Lage und seiner im Vergleich zu China moderaten Wachstumsraten, bisher als ungünstiger Investitionsstandort angesehen wurde. Mit seiner Aufwartung bei Hyderabads High-Tech Firmen gab Clinton gleichzeitig ein Signal zu Gunsten der zukunftsträchtigen IT-Branche. Aus dem Silicon Valley heraus werden schon jetzt immer mehr Investitionen von den 750 von Indern geführten IT-Firmen getätigt (weshalb mancher schon vom „Curry Valley“ spricht). Gut ausgebildete Inder mit Geschäftserfahrung sehen jetzt ihre Chance gekommen und kehren aus den Staaten in ihre Heimat zurück, um dort ein Unternehmen aufzubauen. Ein echter „brain gain“ für Indien (vgl. FOLLATH 2000, 278-306).
Indessen läuft natürlich nicht alles glatt in diesem politischen und wirtschaftlichen Annäherungsprozess. Der kritischste Reibungspunkt betrifft das Drängen der USA gegenüber
Indien, dem Atomwaffensperrvertrag (Non-proliferation Treaty, NTB) und Teststoppabkommen (Comprehensive Test Ban Treaty, CTBT) beizutreten und die Weigerung der indischen Regierung, diese Verträge zu unterzeichnen. Bei genauerem Hinsehen eine verständliche Reaktion, zumal die Amerikaner nach den Kernwaffentests signalisiert hatten, dass sie nicht bereit seien, Indien als gleichrangige Atommacht zu behandeln (vgl. WAGNER 1998, 52). Die indische Seite verweist diesbezüglich auf ihr Selbstbestimmungsrecht und die Tatsache, dass auch die Legislativorgane Chinas, Frankreichs, Großbritanniens, Russlands und der USA selbst (nebst 39 weiteren Staaten) den CTBT noch nicht ratifiziert hätten.
Es ist ein sehr durchsichtiges Manöver der Amerikaner, um Indien aus dem exklusiven „Club“ Weltsicherheitsrat herauszuhalten, wenn sie einerseits die indischen Nuklearwaffen unter ein Kontrollregime stellen wollen, das von den „klassischen“ Atommächten beschlossen worden ist und andererseits keine Gegenleistung dafür bieten, z.B. die Unterstützung Indiens in seinem Bestreben um einen ständigen Sitz in eben jenem „Club“.
Um dieses kardinale Ziel seiner Außen- und Sicherheitspolitik erreichen zu können, ist Indien nun einmal auf die Amerikaner angewiesen. Es wird also weiter seine Beziehungen zu den
Vereinigten Staaten auf allen Feldern intensivieren, um gegenüber China an Bedeutung zu gewinnen. Die Chancen dafür stehen, wegen der genannten positiven Faktoren, nicht schlecht.
7. Der Aufstieg Indiens zur Atommacht und die offenen Fragen seiner Abschreckungsdoktrin
Vierundzwanzig Jahre, nachdem Indien eine „friedliche nukleare Vorrichtung“ (peaceful nuclear device) zur Explosion gebracht hatte, demonstrierte es der Welt am 11. und 13. Mai 1998, dass es jetzt entgültig zum Kreis der Nuklearwaffenmächte gehört. Im Gegensatz zu 1974 aber wurden die Atomwaffentests nicht von einer international als gemäßigt angesehenen Kongressregierung angeordnet, sondern von einer hindunationalistischen BJP Regierung. Anders als damals verfügen die indischen Streitkräfte heute über weitreichende Waffensysteme, v.a. Mittelstreckenraketen, mit einer Aktionsradius bis zu 2500 km. Das deckt nicht nur ganz Pakistan ab, sondern auch große Teile Chinas.
Die Tests waren nach indischer Lesart die Antwort auf die Unnachgiebigkeit der Volksrepublik in der Grenzfrage und seiner Rüstungshilfe für Pakistan, besonders auf dem Gebiet der Nuklearwaffen- und Raketentechnologie (vgl. BANERJEE 1999, 12). Trotz aller Rhetorik und Drohgebärden haben aber weder Indien noch Pakistan bis jetzt einsatzfähige Atomwaffensysteme stationiert. Dies lässt nicht nur auf technische und logistische Schwierigkeiten schließen, sondern vor allem auf eine nicht ausgereifte Nukleardoktrin für den Umgang mit diesem Vernichtungspotential. Doch die Berechenbarkeit der nuklearen Fähigkeiten und Doktrin sind unabdingbar für die Glaubwürdigkeit und Stabilität einer atomaren Abschreckung.
Indien erklärte eine Politik der „minimalen glaubwürdigen Abschreckung“ (minimal credible deterrence) und offerierte Pakistan und allen anderen betroffenen Staaten einen Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen (no first use). Diese Absichtserklärungen werfen jedoch eine Reihe von Fragen auf, die man in Neu Delhi klären muss, wenn Indien als ernsthafte Atommacht anerkannt werden will:
- Bedeutet no first use, dass Indien nur auf einen bereits erfolgten Atomangriff mit den gleichen Waffen reagiert, oder antwortet Indien mit einem Nuklearschlag auch bei einem Angriff mit biologischen oder chemischen Waffen?
- Was bedeutet minimal credible deterrence im Hinblick auf die Anzahl der Sprengköpfe?
- Soll Abschreckung gewährleistet werden durch die Androhung der Vernichtung von Städten des potentiellen Aggressors (counter value) oder der Zerschlagung seiner Militärmaschinerie (counter force)?
- Mit welcher Sicherheit und Zielgenauigkeit können diese Waffen eingesetzt werden? ? Welche Sprengkraft sollen die Gefechtsköpfe haben?
- Wie steht es um die Funktionsfähigkeit der Befehlskette und dem Primat der Politik in Krieg und Frieden?
- Kann Indien die Sicherheit und unbeabsichtigte Anwendung von Atomwaffen jederzeit garantieren?
(Vgl. NAIR 1998, 67 u.81/ BANERJEE 1999, 13)
Die gleichen Fragstellungen gelten selbstverständlich auch für Pakistan, mit dem einen kleinen aber entscheidenden Unterschied, dass Pakistan aus eigener Kraft nie eine ernstzunehmende Atommacht sein wird.
Indien und Pakistan haben mit ihren Atomwaffentests die im vorigen Kapitel angesprochene globale Vertragsordnung (NPT, CTBT) herausgefordert. Es wird befürchtet, dass andere Staaten diesem Beispiel folgen und aus dem Vertragswerk aussteigen könnten; dreißig Monate nach den Tests haben sich diese Befürchtungen aber nicht bestätigt. Die indische Regierung hat wohl auch das ihre zu dieser gelassenen Haltung beigetragen, indem sie deutlich gemacht hat, dass sie keine weiteren Atomwaffenversuche plane und sich Indien an den Richtlinien des NPT und CTBT orientieren werde.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich das strategische Gefüge in Asien nachhaltig geändert hat und sich - auch im Bereich konventioneller Rüstung - noch viel stärker verändern wird. Noch steht die Welt nicht vor einem neuen Rüstungswettlauf zweier Supermächte (eigentlich müsste man angesichts der Größenordnungen von Megamächten sprechen) und so sieht auch der Direktor des Regional Centre of Strategic Studies in Colombo keinen Grund zur Panik:
„ A more complex situation undoubtedly, but not one to cause any great alarm. “
(BANERJEE 1999, 14)
8. Ausblick
Die Indische Union ist nach China das bevölkerungsreichste Land der Erde und wird, nach allen Prognosen, in ca. 40 Jahren etwa 1,5 Milliarden Menschen beherbergen und auf den ersten Rang in der Weltbevölkerungsstatistik vorrücken. Wir können heute nur erahnen, welche Probleme damit auf Indien zukommen. Immer noch gibt es himmelschreiende Ungerechtigkeiten und soziale Missstände: 50% Analphabeten, ungenügender Zugang für Unterprivilegierte zu Bildung, Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung, die herabwürdigende Stellung der Frau in der Gesellschaft, v.a. in ländlichen Gebieten, die Mitgiftregelung und die damit einhergehende Abtreibung weiblicher Föten, die nach wie vor praktizierten Witwenverbrennungen, Korruption und Misswirtschaft, um nur einige zu nennen.
Doch dieser Vielvölkerstaat hat es bisher immer wieder geschafft, nicht in Chaos und Anarchie zu versinken. Seine inneren Probleme hat Indien, mit Ausnahme des Punjab- und Kaschmirkonflikts, immer politisch geregelt und damit eine erstaunliche politische und demokratische Stabilität bewiesen. Es verfügt über große materielle Ressourcen und über ein enormes Humankapital, dessen Entwicklung die zentrale Aufgabe seiner exzellent ausgebildeten Eliten sein sollte.
Indiens internationale Bedeutung wird zunehmen, wenn es seine staatliche Integrität erhalten kann und seine Liberalisierungspolitik erfolgreich fortsetzt. Es bietet einen gewaltigen Zukunftsmarkt und besitzt heute schon High-Tech Standorte der Spitzenklasse. Indien dürfte also von der Globalisierung und der damit verbundenen Ökonomisierung der weltweiten Beziehungen und Prozesse in zunehmenden Maße profitieren.
Von Neu Delhi ging nie eine Bedrohung der internationalen Sicherheit aus und es war nie auf eine expansive Politik ausgerichtet; seriösen Szenarien gehen davon aus, dass dies auch unter nuklearen Vorzeichen so bleiben wird. Die großen internationalen Akteure werden Indien als Faktor in der Weltpolitik nicht mehr ignorieren können und die Indische Union wird aller Voraussicht nach den ihr gebührenden Platz im internationalen System einnehmen. Ob Indien allerdings zum „Guru der Nationen“ werden wird, wie es sein Premierminister Vajpaee wünscht, steht allerdings in den Sternen.
9. Literatur- und Quellenhinweise
BANJERJEE, D. (1998): The New Strategic Environment. In: MATTOO, A. (ed.) (1998): India’s
Nuclear Deterrent. Pokhran II and beyond, S270-287. New Delhi
BANJERJEE, D. (1999): Nuclear South Asia and its Impact on Asia-Pacific Security. In: Asian Defence Journal 05/1999, S.12-14
BAXTER, C. (1998): Government & Politics in South Asia. Oxford
CHADDA, M. (1997): Ethnicity, security, and separatism in India. New York
CORDESMAN, A.H. (1999): Trends in the Asian Military Balance. A Comparative Summary of Military Expenditures; Manpower; Land, Air, Naval, and Nuclear Forces; and Arms Sales. Center for Strategic and International Studies. Washington. Quelle: www.csis.org
FOLLATH, E. (2000): Mythos Indien. In: Der Spiegel 42/2000, S.278-310
FREUDENSCHUSS-REICHL, IRENE von (1999): Tritt ein Verbot von Atomtests in Kraft? In: der überblick 2/1999, S.89-92
GOPAL, S. (1999): SINO-INDIAN Relations. Do Indian Nukes inhibit improvement? Quelle: www.saag.org/notes/note14.htm
HARDGRAVE, R./ KOCHANEK (1993): India. Government and Politics in a Developing Nation. Fort Worth
MANISH (1998) :India ’ s Policy towards the CTBT and the FMCT. In: In: MATTOO, A. (ed.) (1998):
India’s Nuclear Deterrent. Pokhran II and beyond, S.328-345. New Delhi
MISHRA, B. (2000): Global Security: an Indian Perspective. National Security Advisor and Principal Secretary to the Prime Minister of India At National Defence Institute, Lisbon April 13, 2000. Quelle: www.fas.org/news/india/2000/braj-portugal.htm
MITRA, S.K. (2000): Politics in India. In: ALMOND, G.A. (Hg.) (2000): Comparative Politics Today, S.629-680. New York
MITRA, S.K. (2000): Handout zur Vorlesung: Politische Ö konomie der Entwicklung in Indien nach der Unabhängigkeit, Sommersemester 2000. Heidelberg
NAIR, V.K. (1998): The Structure of an Indian Nuclear Deterrent. In: MATTOO, A. (ed.) (1998): India’s Nuclear Deterrent. Pokhran II and beyond, S.65-107. New Delhi
ROTHERMUND, D. (1993): Staat und Gesellschaft in Indien. Meyers Forum Bd.15. Mannheim
SOUTH ASIA ANALYSIS GROUP (2000): Notes and Updates. Quelle:
http://saag.org/notes/note14.html
THAKUR, R. (1995): The Government and Politics of India. London
WAGNER, C (1998): Von der Regionalmacht zum weltpolitischen Akteur? Die indische Außenpolitik im Spannungsfeld nationaler und internationaler Veränderungen. Interne Studie der Konrad Adenauer Stiftung Nr. 174/1998. Sankt Augustin
WEIDEMANN, D. (1998): Von der Regionalmacht zur Großmacht? Indien und seine Rolle in der Welt. In: Der Bürger Im Staat 01/1998
[...]
1 Australien, Indien, Indonesien, Jemen, Kenia, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mosambik, Oman, Singapur, Sri Lanka, Südafrika, Tansania
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text bietet eine umfassende Sprachvorschau, einschliesslich Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Was sind die Hauptthemen des Textes?
Zu den Hauptthemen gehören: Indiens Aussen- und Sicherheitspolitik, der Wandel des politischen Systems, wirtschaftliche Entwicklung im Zeichen der Globalisierung, regionale Initiativen, die Beziehung zu China, die Annäherung an die USA und der Aufstieg zur Atommacht.
Was sind die wichtigsten Veränderungen in Indiens politischem System?
Eine der politisch folgenreichsten Entwicklungen ist die Transformation des politischen Systems von der Einparteiendominanz der Kongresspartei zu einem immer stärker regionalisierten Parteiensystem.
Wie hat sich die Globalisierung auf Indiens Wirtschaft ausgewirkt?
Die Globalisierung hat zu einer wirtschaftlichen Liberalisierung geführt, einschliesslich des Rückzugs des Staates aus der Wirtschaft, der Öffnung für Direktinvestitionen, der Senkung von Zöllen und der Vereinfachung der Einfuhr von Kapitalgütern. Es gab positive Auswirkungen wie BIP-Wachstum, aber auch Herausforderungen wie Haushaltsdefizite und regionale Disparitäten.
Welche Rolle spielen regionale Initiativen für Indien?
Indien versucht, seine nationale Sicherheit durch regionale Initiativen zu stabilisieren. Dazu gehören die Gujaral-Doktrin, die Zusammenarbeit in Südasien (SAARC) und die Beteiligung an Initiativen wie IORARC und BIMST-EC.
Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Indien und China?
Trotz Rivalität und offener Grenzfragen haben sich die Beziehungen seit Mitte der 80er Jahre entspannt. Es gibt ein Abkommen über Ruhe und Sicherheit an der gemeinsamen Grenze, und beide Seiten sind rational genug, um die Nachteile eines erneuten Krieges zu erkennen.
Was sind die Gründe für die Annäherung Indiens an die USA?
Die Annäherung wird durch neue wirtschaftliche Interessen, den Zerfall der Sowjetunion, gemeinsame demokratische Werte und Sicherheitsinteressen (z.B. gegenüber islamischem Fundamentalismus) gefördert.
Was sind die offenen Fragen bezüglich Indiens Atomwaffenprogramm?
Es gibt Fragen bezüglich der Abschreckungsdoktrin, wie z.B. die Bedeutung von "no first use", die Anzahl der Sprengköpfe, die Zielsetzung (counter value vs. counter force), die Sicherheit und Genauigkeit der Waffen und die Funktionsfähigkeit der Befehlskette.
Welche Herausforderungen stehen Indien in Zukunft bevor?
Herausforderungen sind u.a. soziale Ungerechtigkeiten, Analphabetismus, unzureichender Zugang zu Ressourcen, die Stellung der Frau, Korruption und die Bewältigung des Bevölkerungswachstums.
- Citar trabajo
- Bernd Zimmermann (Autor), 2000, Aussen- und sicherheitspolitische Überlegungen zu Indien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101228