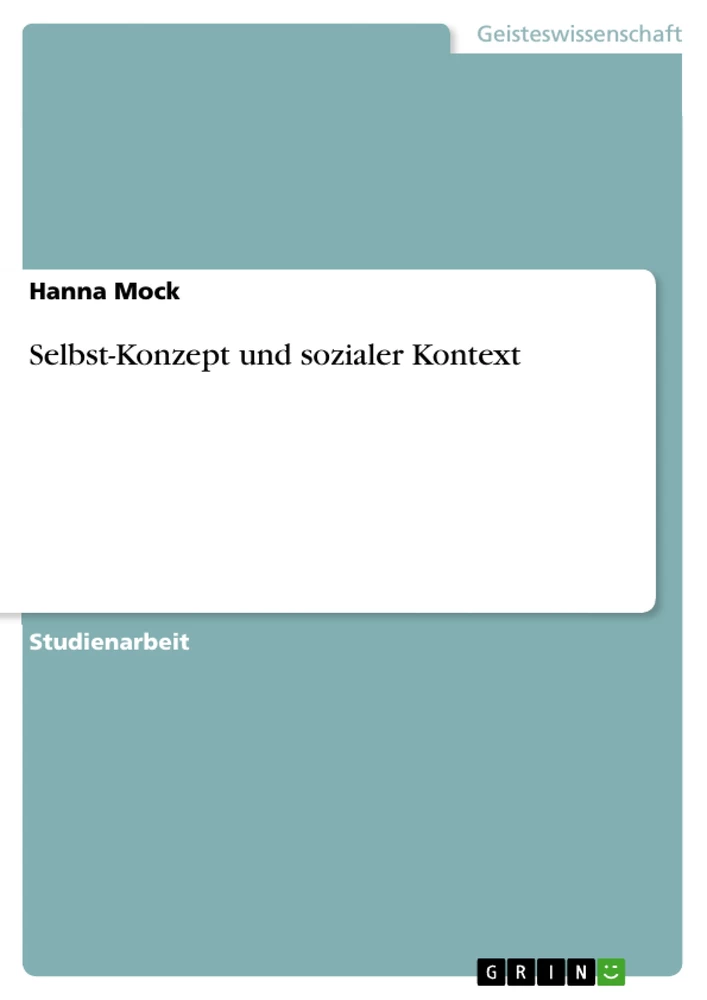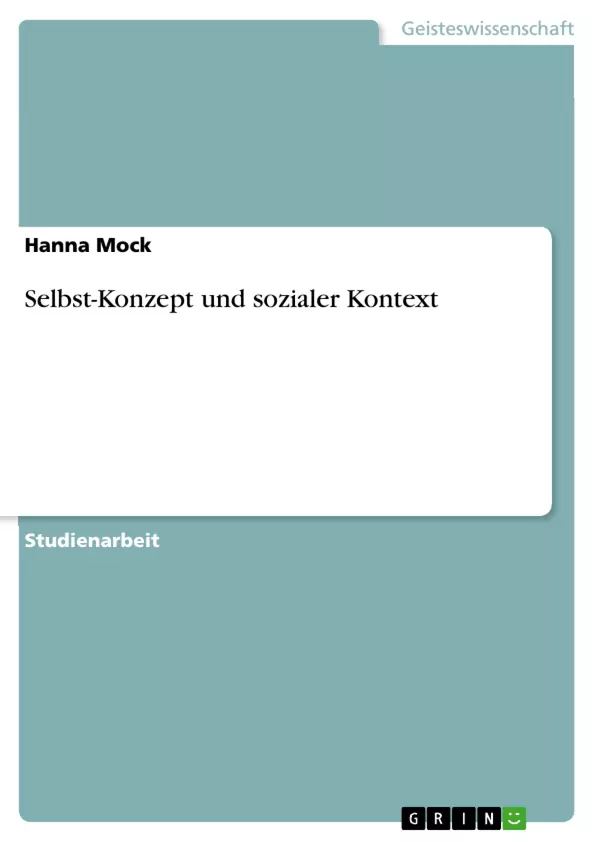Selbst-Konzept und sozialer Kontext
Jeder Mensch gehört zu vielen verschiedenen, sich wechselseitig nicht ausschließenden Gruppen (in-groups). Man ist zum Beispiel Deutscher, Amerikaner, Inder oder Angehöriger einer anderen Nationalität und gleichzeitig auch männlich oder weiblich, ledig, verheiratet oder geschieden usw.. Andere betrachten und beurteilen wir gerne bezüglich deren Gruppenzugehörigkeit, wir stereotypisieren sie und erwarten, daß sie sich den Normen ihrer Gruppe konform verhalten. So beeinflußt unsere Denkweise über andere Gruppen, wie wir deren Mitglieder sehen.
Aber auch wir selbst sind Mitglieder verschiedener Gruppen und wir haben ein Bild von uns selbst, und so ist es naheliegend, daß unsere Meinung über unsere eigenen Gruppen ebenso unser Selbstbild beeinflußt. Hogg und Turner (1987, zitiert nach Simon und Hamilton, 1994) gehen davon aus, daß mehrere Individuen, die sich als Mitglieder der selben Gruppe sehen, dazu tendieren, sich selbst in Bezug auf ihre gemeinsamen Eigenschaften zu stereotypisieren. Das bedeutet, wenn sie sich selbst beschreiben, ist zu erwarten, daß sie für ihre Gruppe typische Eigenschaften für sich bestätigen und untypische zurückweisen.
Simon und Hamilton untersuchten 1994, wie Selbst-Stereotypisierung mit dem sozialen Kontext zusammenhängt, in zwei Experimenten.
Selbst-Stereotypisierung und relative Gruppengröße
Nach Hogg und Turner (s.o.) wächst also der Hang, sich selbst zu stereotypisieren, mit der Feststellung, daß man gemeinsam mit anderen eine Gruppe bildet. Doch was kann zu einer solchen Einsicht führen?
Ein bestimmender Faktor hier ist die in-group-Größe relativ zu der der out-group. So berichten McGuire und McGuire (1988, zitiert nach Simon and Hamilton, 1994), daß Kinder sich, wenn sie sich selbst beschreiben, mit der jeweiligen Gruppe identifizieren, die in ihrem gegenwärtigen sozialen Umfeld in der Minderheit ist. So neigt beispielsweise ein Mädchen türkischer Herkunft unter lauter Jungen der gleichen Nationalität dazu, sich spontan als „Mädchen“ zu beschreiben, während es sich unter nur deutschen Mädchen wohl er als mit dem Begriff „türkisch“ charakterisieren würde.
In dem vorliegenden Experiment wurde nun der Zusammenhang zwischen der Tendenz, sich selbst zu stereotypisieren und der relativen in-group-Größe zur out-group- Größe untersucht.
Erwartet wurde, daß Minoritätsmitglieder sich stärker selbst stereotypisieren als Majoritätsmitglieder. Sie sollten also die für ihre in-group typischen Attribute mehr für sich bestätigen und untypische deutlicher zurückweisen als die Majoritätsmitglieder.
Der Versuch wurde an einer amerikanischen Universität mit 32, im Durchschnitt 19 Jahre alten Studenten durchgeführt. Den Studenten wurde erzählt, es handle sich um eine Studie über den Zusammenhang zwischen Persönlichkeit und Künstlervorliebe. So sollten sie einige Gemälde beurteilen und fünf persönliche Fragen beantworten. Durch eine der Fragen charakterisierten sie sich selbst als extrovertiert oder introvertiert. Dann erfuhren sie, daß sie deutliche Präferenzen für einen bestimmten Maler gezeigt hätten und das diese Präferenz mit Introvertiertheit, bzw. Extrovertiertheit, eben der Eigenschaft, mit der sie sich vorher selbst benannt hatten, zusammenhängen würde. Außerdem würden 80 Prozent (Majoritätsbedingung) der Bevölkerung den gleichen Maler vorziehen und nur 10 Prozent den entgegengesetzten. In der Minoritätsbedingung wurden die Zahlen vertauscht, wobei die Zuordnung zur Majoritäts-, bzw. Minoritätsbedingung rein zufällig war.
Die Selbst-Stereotypisierung wurde anhand von sechs Rating-Skalen gemessen, bei denen die Versuchspersonen das Ausmaß einschätzen sollten, in dem sie „...calm, careful, rigid, lively, sociable, and restless...“ ( Simon und Hamilton, 1994, S. 701) waren. Es handelte sich also um jeweils drei typisch introvertierte (calm, careful, rigid) und extrovertierte (lively, sociable, restless) Eigenschaften, von denen wiederum jeweils zwei positiv (calm, careful, lively, sociable), und eine negativ (rigid, restless) beladen waren.
Das Ergebnis war wie erwartet: „Overall, self-stereotyping was more pronounced for minority members than for majority members.“ (Simon und Hamilton, 1994, S. 703). Minoritätsmitglieder stereotypisierten sich mehr als Majoritätsmitglieder mit einer Ausnahme, nämlich wenn als Indikator der Selbst-Stereotypisierung das Zurückweisen positiver out-group-Attribute genommen wurde. Eine mögliche Erklärung dafür kann ich leider nicht abgeben, aber dennoch wird durch dieses Experiment bestätigt, daß SelbstStereotypisierung mit der relativen in-group-Größe negativ korreliert.
Selbst-Stereotypisierung und sozialer Status
Im vorangegangenen Experiment unterschieden sich die Gruppen nur im Hinblick auf ihre relative Größe. Normalerweise aber steht jede Gruppe außerdem in einem bestimmten Status. So gibt es Minoritäten mit hohem Status (Eliten, Prominente...), Minoritäten mit niedrigem Status (Randgruppen wie Asylbewerber, Arbeitslose, Suchtkranke...), aber auch Majoritäten mit hohem (Nicht-Suchtkranke, Heterosexuelle...), bzw. niedrigerem („gemeines Volk“, Arbeiter...) Status. Nach Tajfel und Turner (1986, zitiert nach Simon und Hamilton, 1994) verhilft ein hoher Status einer Gruppe den Mitgliedern zu einer positiven Gruppenidentität, was besonders wichtig ist für die Bereitschaft, sich der Gruppe zugehörig zu fühlen. Also sollten Mitglieder einer Gruppe mit hohem Status sich verstärkt in Begriffen ihrer Gruppenzugehörigkeit wahrnehmen als Gruppenmitglieder mit niedrigem Status.
Forschungen von Ellemers, Doosje, Van Knipenberg und Wilke (1992, zitiert nach Simon und Hamilton, 1994) haben zudem bei der Gruppenattraktivität einen Interaktion zwischen dem Status und der relativen Größe gezeigt: „Whereas a minority in-group with high status was more attractive than a minority in-group with low status, high and low status majority in-groups did not differ in attractiveness.“ (Simon und Hamilton, 1994, S. 704)
Im diesem Experiment mit den unabhängigen Variablen Größe und Status wird vermutet, daß besonders Minoritätsmitglieder mehr zu Selbst-Stereotypisierung neigen, wenn der in-group-Status hoch ist.
Dieser Versuch wurde mit 72 Studenten an der selben amerikanischen Universität wie im ersten Versuch durchgeführt. Mit ein paar Ausnahmen war auch das Verfahren so wie im vorangegangenen.
Zum einen wurde die Größe der Minoritätsgruppe auf 7 Prozent verkleinert.
Ferner wurde den Studenten in der Bedingung mit niedrigem Status zusätzlich mitgeteilt, der Maler, den sie favorisierten, wäre „,NOT very DISTINGUISHED‘“ (Simon und Hamilton, 1994, S. 704), und der andere Maler das Gegenteil. In der Bedingung mit hohem Status wurde die Mitteilung vertauscht.
Die diesem Experiment zugrunde liegende Vermutung wurde auch hier bestätigt. Hoher Status einer Minoritäts-in-group war mit gewachsener Selbst-Stereotypisierung verbunden, was bei der Majoritäts-in-group mit ebenfalls hohem Status nicht der Fall war. Jedoch auch hier gab es eine nicht erwartete Abweichung: Majoritätsmitglieder wiesen out-group-Attribute für sich deutlicher zurück, wenn sie sich in der Bedingung mit hohem Status befanden.
Wenn auch auf den ersten Blick der Annahme widersprechend, unterstützt laut Simon und Hamilton (1994) dieses Ergebnis doch die Meinung von Ellemers et al. (1992), daß die Attraktivität von Minoritäten sehr stark von ihrem Status abhängt.
Passend schreiben sie: „...members of high status minorities...seem especially willing to define themselves in terms of their shared group membership, whereas members of high status majorities seem especially motivated to clarify that they are not members of a deviant minority.“ (Simon und Hamilton, 1994, S.709)
Selbst-Kategorisierung und Bedeutsamkeit der Gruppenzugehörigkeit
Die beiden eben beschriebenen Experimente führen zu dem Ergebnis, daß Minoritätsmitglieder im Allgemeinen eher zu Selbst-Stereotypisierung tendieren als Majoritätsmitglieder. Dieses Phänomen wird normalerweise dadurch erklärt, daß Zugehörigkeit zu einer Minorität schon allein wegen seiner Seltenheit Aufmerksamkeit auf sich zieht und ein hervorstechendes Merkmal in der Wahrnehmung der sozialen Welt, sei es von sich selbst oder von anderen, wird (Fiske und Taylor, 1991, S. 247-266; Kunda,1999, S. 21f).
Oakes (1987, zitiert nach Simon, Hastedt und Aufderheide, 1997) übte an dieser Erklärung Kritik. Nicht die relative Gruppengröße allein macht ihrer Meinung nach Minoritätsmitgliedschaft hervorstechend und so zu Selbst-Stereotypisierung verleitend, sondern ihre Bedeutsamkeit (meaningfulness) im jeweiligen sozialen Umfeld. Sitzen etwa in einem Sozialpsychologie-Seminar weibliche und männliche Studenten und diskutieren über ein geschlechtsirrelevantes Thema, wird das eigene Geschlecht einen kaum in seinem momentanen Selbstbild beeinflussen, selbst nicht wenn man sich z.B. als Mann deutlich in der Minderheit befindet. Ganz anders verhält es sich aber, wenn der Gesprächsinhalt geschlechtsspezifisch ist, wenn es z.B. um Geschlechtsunterschiede oder Rollenverteilung geht und somit das Geschlecht relevant ist.
Auf den ersten Blick mag dies den Ergebnissen von Simon und Hamilton (1994) widersprechen, aber Kategorisierung auf der Basis von Künstlervorlieben war in diesem Kontext wirklich relevant (meaningful), da die Probanden glaubten, die Gruppenzugehörigkeit nach der Künstlervorliebe würde hoch mit Introvertiertheit, bzw. Extrovertiertheit korrelieren und sie sich dann auch nur bezüglich dieses Persönlichkeitszuges beurteilen mußten (Simon et al., 1997).
Simon et al. führten 1997 zwei Versuche durch, um zu erfahren, in welchem Ausmaß die Selbstkategorisierung, also Depersonalisierung, als Minoritäts-, bzw.
Majoritätsmitglied von der Bedeutsamkeit der jeweiligen sozialen Kategorisierung abhängt.
Ihre Hypothese war, „that minority and majority members would not differ in depersonalized self-perception when the meaningfulness of the social categorization was low. Given high meaningfulness...minority members were expected to show more depersonalized self-perception than majority members;“ (Simon et al., 1997, S. 311).
Unabhängige Variablen waren relative in-group-Größe und Bedeutsamkeit (hoch vs. niedrig), von denen die Depersonalisierung der Selbstwahrnehmung abhing. Am ersten Experiment nahmen 197 Probanden ,Durchschnittsalter 23 Jahre, teil. Sie wurden in dem Glauben gelassen, es handle sich um eine Studie über menschliche Informationsverarbeitung.
Erst sollten sie sich selbst in sechs Dimensionen, eine davon Bevorzugung von Stadt- oder Landleben, einordnen. Die Bedeutsamkeit wurde manipuliert, indem man den Probanden erzählte, Voruntersuchungen hätten ergeben, daß Präferenz von Land- oder Stadtleben in keinem Zusammenhang mit Persönlichkeit im Allgemeinen und Informationsverarbeitungsstil im Speziellen steht (niedrige Bedeutsamkeit), sondern eher als neutraler Stimulus fungiert, oder im Gegenteil, daß eben diese Präferenz ausgewählt worden ist, weil sie besonders hoch mit Informationsverarbeitungsstil korreliere (hohe Bedeutsamkeit).
Relative Gruppengröße wurde ähnlich wie im schon beschriebenen Experiment von Simon und Hamilton (1994) manipuliert: Der Hälfte der Probanden wurde gesagt, Vortests hätten ergeben, sie teilten ihre Vorliebe mit einer Minderheit (15 Prozent), die übrigen erfuhren, sie gehörten mit ihrer Vorliebe zu einer Mehrheit von 85 Prozent (Minorität vs. Majorität). Die Zahlen waren rein fiktiv und die Zuordnung zur Minoritäts- bzw. Majoritätsbedingung zufällig.
Nun maßen die Versuchsleiter anhand von Selbsteinschätzungen der Versuchspersonen drei Aspekte von depersonalisierter Selbstwahrnehmung: (a) Angleichung vom Selbst mit der in-group, (b) beobachtete in-group-Homogenität und (c) Wahrnehmung des Selbst eher als typisches Gruppenmitglied oder eher als einzigartiges Individuum.
Die Hypothese, daß Minoritätsmitglieder eine entschiedenere Depersonalisation in der Selbstwahrnehmung, also mehr Selbst-Stereotypisierung, als Majoritätsmitglieder zeigten, wenn, und nur wenn die zugrundeliegende soziale Kategorisierung von Bedeutung ist, wurde durch die Ergebnisse dieses Experiments bestärkt. Wie man in Figur 1 erkennt, steigt die Depersonalisierung in der Selbstwahrnehmung mit gewachsener Bedeutung der Kategorisierung in der Minoritätsbedingung stark an, während sich bei der Majorität nahezu keine Veränderung, und wenn dann in negativer Richtung zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figur1. (aus Simon et al., 1997, S. 315) Depersonalisation der Selbstwahrnehmung als Funktion relativer ingroup-Größe und Bedeutsamkeit der sozialen Kategorisierung.
Nun kann man anmerken, daß Majortäten sich im Allgemeinen nur ungern selbst kategorisieren. Möglicherweise war in diesem Experiment die variierte Bedeutung der Kategorisierung nur zu schwach, um einen nennenswerten Effekt bei der Majorität zu erreichen, weil ihre „Selbst-Kategorisierungs-Schwelle“ deutlich höher liege.
Um diese Möglichkeit auszuschließen und die Ergebnisse des ersten Experimentes noch weiter zu unterstützen, wurde ein zweites mit stärkerer Bedeutsamkeitsmanipulation durchgeführt.
Durch den zweiten Versuch wurden die Ergebnisse des ersten vollkommen bestärkt. Selbst bei deutlich größerer Manipulation der Bedeutsamkeit zeigte die Majorität keinen Anstieg bei der Depersonalisierung im Selbstbild, wohingegen der Effekt bei der Minorität noch verstärkt wurde. Es läßt sich also folgern, daß in einem Kontext mit einer größeren und kleineren Gruppe, weder eine große Bedeutung, noch Minoritätszugehörigkeit allein ausreicht, um den Prozeß der Depersonalisation des Selbstbildes auszulösen, da diese beiden Faktoren gleichzeitig zusammen vorliegen müssen.
Die bis jetzt angeführten Untersuchungen haben einen Schwachpunkt: Es handelte sich immer um Laborexperimente mit künstlich ad hoc zusammengestellten Gruppen in einem unnatürlichen Rahmen. Es ist demzufolge fraglich, ob man ihre Ergebnisse verallgemeinern kann. In der Realität befinden sich Individuen in zeitlich stabilen, nicht statischen Gruppen, mit einer Vergangenheit, in der sich oft Stereotype entwickelt haben, welche nun allgemein geteilt werden. Wahrscheinlich ist, daß Individuen sich in der Wirklichkeit in Bezug auf Selbst-Stereotypisierung oder -Katogorisierung anders verhalten, zum Teil stärker zu Selbst-Stereotypisierung neigen als in den Versuchen, weil sie etwa eine gewisse Behandlung von ihrem Umfeld erfahren haben und erfahren oder sich tatsächliche Gruppenzugehörigkeit stärker im Selbstbild verfestigt.
Simon, Pantaleo und Mummendey führten 1995 eine Studie durch, in einen Vorteil des Feldversuchs, bessere Übertragbarkeit, mit dem des Laborexperiments, experimentelle Kontrollierbarkeit, vereinigte. Sie bezogen sich nämlich auf die Mitglieder natürlicher Gruppen und integrierten zusätzlich eine unabhängige, experimentell manipulierte Variable.
Kollektives Selbst und Wissen um ein gemeinsames Schicksal
Gegenstand der Untersuchung war die Ausprägung des kollektiven Selbst gegenüber dem des individuellen Selbst in der Selbstwahrnehmung bei homosexuellen Männern als stigmatisierte Minderheit (im Gegensatz zu heterosexuellen Männern als allgemein anerkannte Mehrheit). Als Indikator dafür wurde die Betonung von selbst wahrgenommenen Ähnlichkeiten im Verhältnis zu Unterschieden innerhalb der Gruppe, zum einen des Individuums selbst mit der in-group, zum anderen der in-group insgesamt, genommen. Interessant ist dieser intragroup-Kontext, da laut Simon et al. durch vergangene Forschungen schon nahegelegt ist, daß „...while sharing the socially prevalent stereotypes about their own social category, gay men may at the same time try to escape stigmatization individually by highlightning the individual self.“ (Simon et al., 1995, S.111). Simon et al. bestätigten 1995 erneut, daß das kollektive Selbst in Bezug auf die sexuelle Orientierung für heterosexuelle Männer leichter zu akzeptieren ist als für schwule (Siehe Simon et al., 1995, S.112), womit auch die Ergebnisse von Simon und Hamilton (1994, s. o.) für einen realen Kontext belegt sind.
Trotz aller auch schon genannten Befunde, die besagen, daß Mitglieder niedrig stehender Minderheiten sich schwer tun, ihr kollektives Selbst in ihr Selbstbild aufzunehmen oder sich selbst zu stereotypisieren (Simon und Hamilton,1994; Simon et al. 1995), sind dennoch Umstände möglich, unter denen auch Minoritätsmitglieder mit niedrigem Status ihr kollektives Selbst betonen. Tajfel analysierte nach Simon et al. (1995) im Jahre 1981 Bedingungen, unter denen Minoritätsmitlgieder eine gemeinsame Identität entwickeln: „a common identity is thrust upon a category of people because they are at the receiving end of certain attitudes and treatment from the ‚outside‘“ (Tajfel, 1981, S. 315, zitiert nach Simon et al., 1995, S. 113). Das ist gut auf die hier untersuchte Gruppe anzuwenden, da homosexuelle Männer in der Realität häufig von der Außenwelt eine besondere Behandlung, positiv oder negativ, erfahren, und zum Teil eben deshalb gemeinsame schwule Identität entwickelt haben, sei es als automatische Reaktion oder als bewußte Antwort darauf(Siehe Sigusch, 1984; Simon et al., 1991, zitert nach Simon et al., 1995).
Simon et al. folgten Tajfel (1981, zitiert nach Simon et al., 1995) und vermuteten, schwule Männer bezögen ihre sexuelle Orientierung in dem Ausmaß in ihr Selbstbild mit ein, in dem sie sich der besonderen Behandlung ihrer Gruppe durch die Außenwelt, hier die heterosexuelle Mehrheit, bewußt sind.
In ihrer Studie manipulierten sie dieses Bewußtsein experimentell, indem 79 schwule Männer (Durchschnittsalter 26 Jahre) entweder Situationen wiedergeben sollten, in denen sie als Schwule eine besondere Behandlung von der Außenwelt erfahren hatten (Versuchsgruppen), oder irrelevante Fragen zu beantworten hatten (Kontrollgruppe). Zusätzlich bezogen sie noch die Qualität der Behandlung mit ein, das heißt, die Männer der einen Versuchsgruppe sollten sich an eine Situation erinnern, in der Schwule feindselig behandelt wurden, die Männer der anderen an eine Situation, in der Schwulen in einem sonderlich freundlichen und fairen Weg begegnet wurde. Darauf wurden von den Individuen wahrgenommen intragroup-Ähnlichkeiten im Verhältnis zu Unterschieden gemessen als Indikator für Betonung des kollektiven Selbst versus individuelles Selbst.
Erwartet für die Versuchsgruppe wurde eine Umkehr von erlebten mehr intragroup- Differenzen in der Kontrollgruppe zu mehr wahrgenommenen intragroup-Ähnlichkeiten als Differenzen in den Versuchsgruppen, wobei dieser Effekt bei Probanden in der Bedingung mit feindseliger Behandlung noch stärker sein sollte. Das sollte so sein, da nach z.B. Dion (1979, zitiert nach Simon et al., 1995) feindselige Behandlung das Gefühl von Solidarität und gemeinsamen Schicksal bei in-group-Mitgliedern noch mehr ansteigen läßt und so zusätzlich die Betonung des kollektiven Selbst fördert.
Die Vermutung dieser Studie fand Bestätigung: Schwule Männer waren eher bereit ihr kollektives Selbst hinsichtlich der sexuellen Orientierung zu beanspruchen, wenn sie sich bewußt darüber waren, bzw. bewußt gemacht worden waren, daß Mitglieder ihrer ingroup „Opfer“ spezieller Behandlung von der Außenwelt sind. Wie man in Figur 2 erkennt betonten sie dann nicht so sehr intragroup-Differenzen im Gegensatz zu Ähnlichkeiten wie Männer der Kontrollgruppe. Man sieht hier aber überraschenderweise auch, daß die Qualität der Behandlung keinen nennenswerten Effekt hatte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Figur 2. (aus Simon et al., 1995, S. 115) Wahrgenommene intragroup-Ähnlichkeiten (SIM) und Differenzen (DIF) als Funktion von geschilderter Behandlung von in-group-Mitgliedern.
Simon et al. (1995) nehmen an, das sei darauf zurückzuführen, daß Männer die von einer feindseligen Situation berichten sollten, nur zu 29 Prozent selbst involviert waren (Personen mit freundlicher Behandlung zu 95 Prozent), sie also nicht selbst betroffen waren und so das Gefühl der Solidarität nicht besonders tief war, jedenfalls nicht stärker als bei der anderen Versuchsgruppe.
Die Hypothese einer Umkehr von mehr beobachteten intragroup-Differenzen in der Kontrollbedingung zu mehr Gemeinsamkeiten in den Experimentalbedingungen wurde trotz des deutlichen Effektes der manipulierten Variable nicht völlig belegt. Die wahrgenommenen intragroup-Ähnlichkeiten überwogen in keinem Fall die Differenzen (Siehe Figur 2). Das paßt zu den schon erwähnten (s.o.) Forschungen, die belegen, daß schwule Männer als schlecht angesehene Minoritätsmitglieder im Allgemeinen versuchen, sich von ihrer in-group mit geringem Status abzugrenzen (z.B. Simon et al., 1995; Simon und Hamilton, 1994).
Zusammenfassung und Schlußbemerkung
Das soziale Umfeld beeinflußt, wie die aufgezeigten Untersuchungen belegen, bedeutend unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst und wie sehr wir uns mit welchen in-groups, zu denen wir gehören, identifizieren.
Da die Ergebnisse aus Versuchsbedingungen stammen und die Probanden sich einer Prüfsituation bewußt waren, sei es der tatsächlichen oder einer angeblichen, kann man sie nicht uneingeschränkt auf die reale Welt übertragen (s.o.). Dennoch sind aus ihnen bestimmte Umstände zu schließen, unter denen ein Individuum mehr zu Selbstkategorisierung neigt oder mehr nicht.
Man tendiert für gewöhnlich dazu, sich besonders der in-group zugehörig zu fühlen, die sich in der jeweiligen Situation in der Minderheit befindet, weil diese Gruppenzugehörigkeit dann salient ist (siehe Simon und Hamilton, 1994; .Fiske und Taylor, 1991, S. 247-266; Kunda, 1999, S. 21f). Das gilt aber nur, wenn alle Gruppen über einen ähnlich hohen Status verfügen. Sonst nimmt man nur ungern eine weniger geachtete Gruppenzugehörigkeit in sein eigenes Selbstbild auf, bzw. steht zu ihr, will ein jeder doch vor sich und den anderen in einem möglichst guten Licht stehen (Siehe Simon und Hamilton, 1994).
Laut den Untersuchungen von Simon et al. (1997) ist es aber in erster Linie wichtig für Selbst-Kategorisierung hinsichtlich einer bestimmten in-group-Zugehörigkeit, daß diese in dem jeweiligen Kontext von Relevanz ist. Andernfalls nimmt man sie wahrscheinlich gar nicht wahr oder ist sich ihr nicht bewußt.
Eine weitere Variable in der Entwicklung eines Gruppengefühls ist das Wissen um ein gemeinsames Schicksal aller Gruppenmitglieder. Dieses Wissen läßt Gruppen mit niedrigem Status ein Solidaritäts- bzw. Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen, ein wichtiger Schritt dazu, sich von der Außenseiterposition und eventueller Unterdrückung zu befreien und Rechte für die Gruppe durchzusetzen. Beispielsweise die Frauenbewegung und die mit ihr eingekehrte Emanzipation der Frau wären ohne ein solches Solidaritätsgefühl gar nicht denkbar gewesen.
Wir wehren uns eher dagegen, uns bewußt mit einer Gruppe zu identifizieren, wie man auch in den vorgestellten Untersuchungen sieht, und sehen uns doch lieber als Kathrin, Jan, Christian etc.. Der Mensch aus den westlichen Industrienationen ist, möglicherweise aufgrund der schlechten Erfahrungen, die er im vergangenen Jahrhundert mit totalitären, alles und jeden gleichmachenden Gesellschaften machen mußte, betont dazu erzogen, sich seine Individualität zu bewahren. Aber auch das impliziert paradoxerweise Selbst-Kategorisierung oder Selbst-Stereotypisierung. Simon et al. (1997) berufen sich auf Oakes et al.(1994), wenn sie schreiben: „Note that strictly speaking, even such an individual place (i.e., one’s individual self or individual identity) is predicated on social categorization prozesses in that it represents the least inclusive social category of which oneself is a member.“ (S. 319).
Literaturverzeichnis
- Fiske, S. T. & Taylor S. E. (1991). Social Cognition. McGraw-Hill. New York. 2nd ed.
- Kunda, Z. (1999). Social Cognition: Making Sense of People. MIT Press. Cambridge.
- Simon, B. & Hamilton, D.-L. (1994). Self-stereotyping and social context: The effects of relative in-group size and in-group status. Journal of Personality and Social Psycholgy, 66 (4), 699-711.
- Simon, B., Hastedt, C. & Aufderheide, B. (1997). When self-categorization makes sense: The role of meaningful social categorization in minority and majority members‘ self-perception. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (2), 310- 320.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Text "Selbst-Konzept und sozialer Kontext"?
Der Text behandelt, wie das Selbstbild und die Selbstwahrnehmung eines Individuums durch den sozialen Kontext, insbesondere die Gruppenzugehörigkeit, beeinflusst werden. Es werden verschiedene Experimente und Studien vorgestellt, die untersuchen, wie Faktoren wie relative Gruppengröße, sozialer Status und die Bedeutsamkeit der Gruppenzugehörigkeit die Selbst-Stereotypisierung und die Betonung des kollektiven Selbst beeinflussen.
Was ist Selbst-Stereotypisierung?
Selbst-Stereotypisierung beschreibt die Tendenz von Individuen, sich selbst in Bezug auf die typischen Eigenschaften ihrer Gruppe(n) zu beschreiben und untypische Eigenschaften zurückzuweisen. Mit anderen Worten, man übernimmt das Stereotyp der eigenen Gruppe als Teil des Selbstbildes.
Wie beeinflusst die relative Gruppengröße die Selbst-Stereotypisierung?
Studien zeigen, dass Minoritätsmitglieder tendenziell stärker zur Selbst-Stereotypisierung neigen als Majoritätsmitglieder. Dies liegt daran, dass die Zugehörigkeit zu einer Minderheit oft auffälliger ist und somit das Selbstbild stärker beeinflusst.
Welche Rolle spielt der soziale Status bei der Selbst-Stereotypisierung?
Der soziale Status einer Gruppe beeinflusst die Bereitschaft ihrer Mitglieder, sich mit ihr zu identifizieren. Mitglieder von Gruppen mit hohem Status neigen eher dazu, sich in Begriffen ihrer Gruppenzugehörigkeit wahrzunehmen als Mitglieder von Gruppen mit niedrigem Status. Besonders Minoritätsmitglieder mit hohem Status neigen stärker zur Selbst-Stereotypisierung.
Wie beeinflusst die Bedeutsamkeit der Gruppenzugehörigkeit die Selbstwahrnehmung?
Die Bedeutsamkeit der Gruppenzugehörigkeit im jeweiligen sozialen Kontext spielt eine entscheidende Rolle. Wenn die Gruppenzugehörigkeit relevant ist, zeigen Minoritätsmitglieder tendenziell eine stärkere Depersonalisierung der Selbstwahrnehmung (Selbst-Stereotypisierung) als Majoritätsmitglieder. Wenn die Gruppenzugehörigkeit jedoch irrelevant ist, gibt es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Minoritäts- und Majoritätsmitgliedern.
Was ist das kollektive Selbst und wie wird es beeinflusst?
Das kollektive Selbst bezieht sich auf die Betonung der Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten innerhalb einer Gruppe im Vergleich zu den Unterschieden. Das Bewusstsein für eine gemeinsame Behandlung durch die Außenwelt (z.B. Diskriminierung) kann dazu führen, dass Mitglieder einer stigmatisierten Minderheit (wie z.B. homosexuelle Männer) ihr kollektives Selbst stärker in ihr Selbstbild integrieren.
Welche Einschränkungen gibt es bei den vorgestellten Studien?
Die meisten Studien sind Laborexperimente mit künstlich zusammengestellten Gruppen. Daher ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf reale soziale Situationen begrenzt. In der Realität sind Gruppen oft stabiler und es gibt bereits etablierte Stereotypen, die das Verhalten der Individuen beeinflussen können.
Welche Schlussfolgerungen können aus den Studien gezogen werden?
Das soziale Umfeld beeinflusst maßgeblich unsere Selbstwahrnehmung und die Identifikation mit verschiedenen Gruppen. Die relative Gruppengröße, der soziale Status und die Relevanz der Gruppenzugehörigkeit spielen dabei eine wichtige Rolle. Das Wissen um ein gemeinsames Schicksal kann insbesondere bei Gruppen mit niedrigem Status ein Gefühl der Solidarität und Zusammengehörigkeit fördern.
- Quote paper
- Hanna Mock (Author), 2001, Selbst-Konzept und sozialer Kontext, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101295