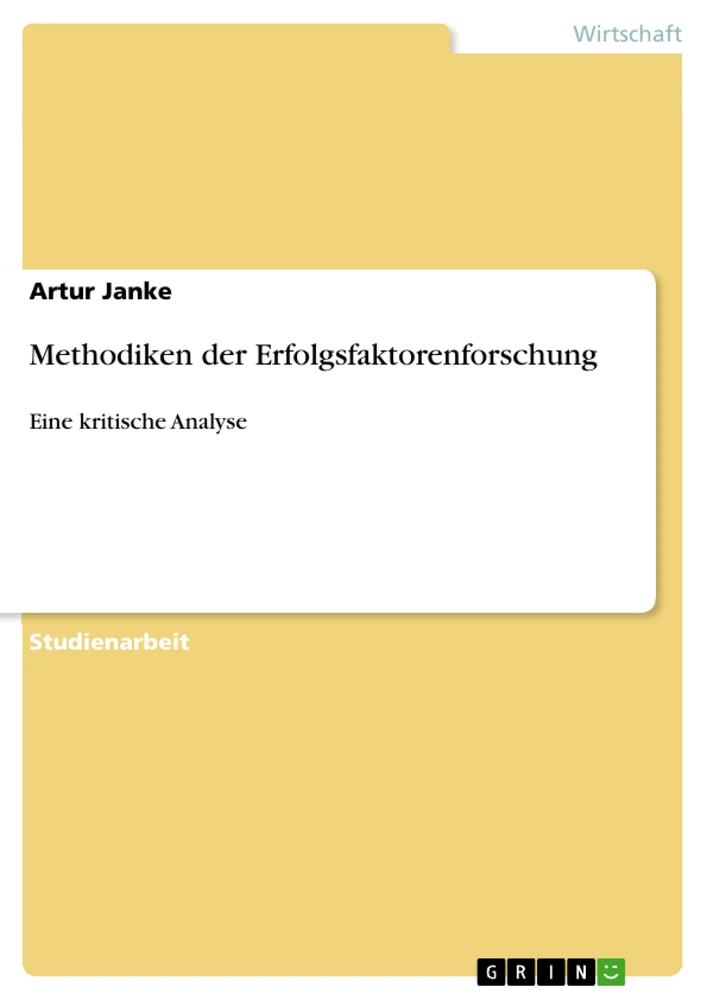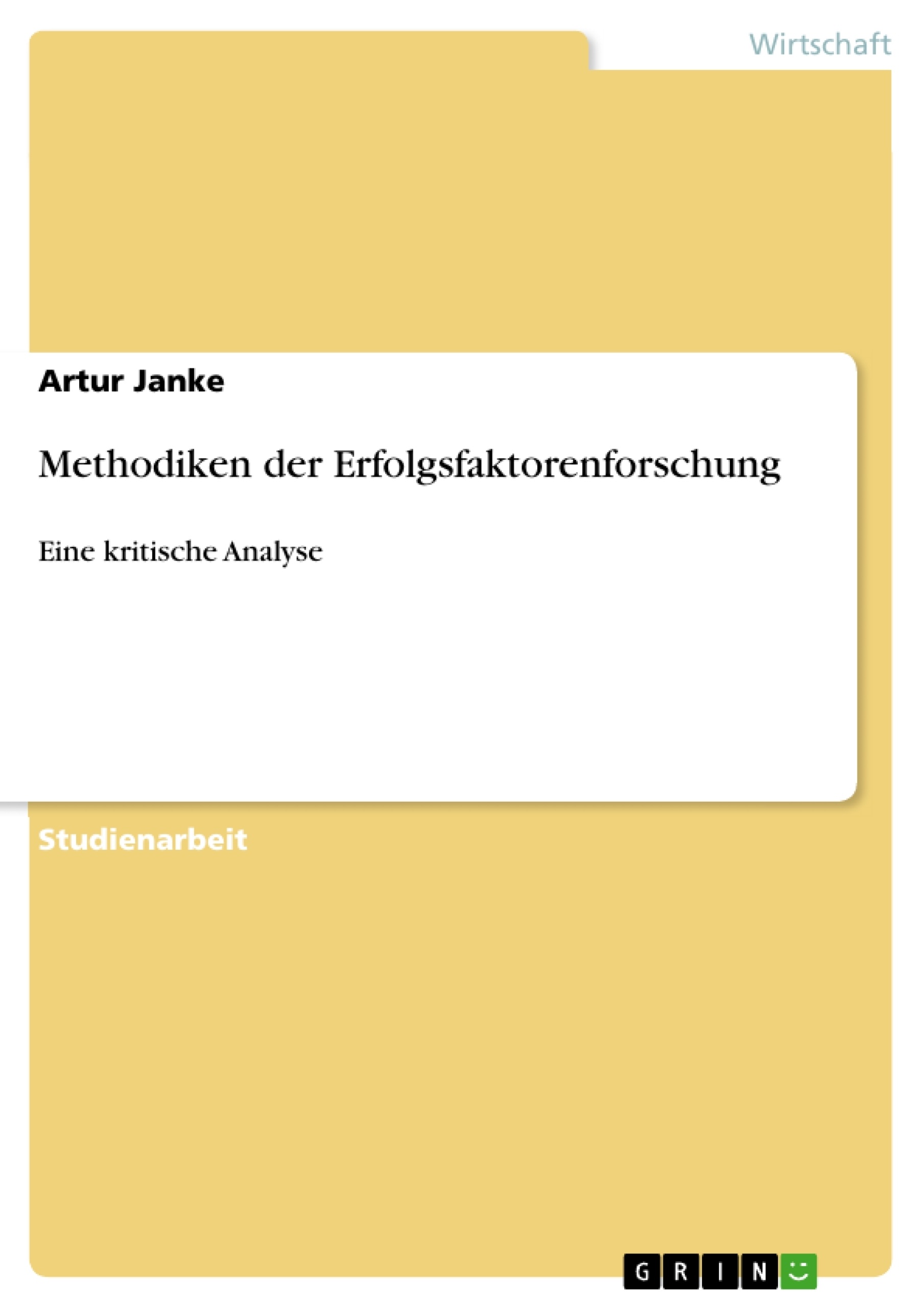Ziel dieser Arbeit ist es, ausgewählte Methodiken im Bereich der Erfolgsfaktorenforschung zu erläutern und kritisch zu analysieren. Innerhalb des zweiten Kapitels werden die grundlegenden Begriffe Erfolgsfaktoren, Erfolg und Erfolgsgrößen definiert sowie der Vorgang zur Identifikation von Erfolgsfaktoren erläutert. Im dritten Kapitel werden drei Methodiken der Erfolgsfaktorenforschung vorgestellt. Dabei handelt es sich um das PIMS-Programm, die Studie von Peters und Waterman sowie das Experteninterview. Das vierte Kapitel befasst sich mit der kritischen Reflexion der Erfolgsfaktorenforschung, insbesondere der drei vorgestellten Methodiken. Im fünften Kapitel wird diese Arbeit mit einer kritischen Auseinandersetzung innerhalb der Zusammenfassung abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Grundlagen
- 2.1 Erfolgsfaktoren
- 2.2 Erfolg
- 2.3 Erfolgsgrößen
- 2.4 Identifikation der Erfolgsfaktoren
- 3 Erfolgsfaktorenforschung
- 3.1 PIMS-Programm
- 3.2 Studie von Thomas J. Peters und Robert H. Waterman
- 3.3 Experteninterview
- 4. Kritische Reflexion der Erfolgsfaktorenforschung
- 4.1 Kritik am PIMS-Programm
- 4.2 Kritik an Thomas J. Peters und Robert H. Waterman
- 4.3 Kritik am Experteninterview
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Ziel dieser Arbeit ist die Erläuterung und kritische Analyse ausgewählter Methoden der Erfolgsfaktorenforschung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Definition der zentralen Begriffe Erfolgsfaktoren, Erfolg und Erfolgsgrößen sowie die Identifikation von Erfolgsfaktoren. Darüber hinaus werden drei weit verbreitete Methoden vorgestellt und kritisch betrachtet: das PIMS-Programm, die Studie von Peters und Waterman und das Experteninterview.
- Definition von Erfolgsfaktoren, Erfolg und Erfolgsgrößen
- Identifikation von Erfolgsfaktoren
- Analyse und Kritik des PIMS-Programms
- Bewertung der Studie von Peters und Waterman
- Kritik am Experteninterview als Methode der Erfolgsfaktorenforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt die Problemstellung der Erfolgsfaktorenforschung vor und definiert die Zielsetzung sowie den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die grundlegenden Konzepte von Erfolgsfaktoren, Erfolg und Erfolgsgrößen und beschreibt die Methodik zur Identifikation von Erfolgsfaktoren. Kapitel 3 widmet sich der Vorstellung und Beschreibung der drei wichtigen Methoden der Erfolgsfaktorenforschung: dem PIMS-Programm, der Studie von Peters und Waterman sowie dem Experteninterview. Kapitel 4 beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den zuvor vorgestellten Methoden der Erfolgsfaktorenforschung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Erfolgsfaktorenforschung und befasst sich mit Themen wie Erfolgsfaktoren, Erfolg, Erfolgsgrößen, PIMS-Programm, Peters und Waterman, Experteninterview, Kritik an Methoden, strategisches Management.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Erfolgsfaktoren in der Betriebswirtschaft?
Erfolgsfaktoren sind jene Variablen oder Bedingungen, die einen maßgeblichen Einfluss auf das Erreichen der Unternehmensziele und die Wettbewerbsfähigkeit haben.
Was ist das PIMS-Programm?
PIMS (Profit Impact of Market Strategies) ist eine Datenbankstudie, die den Zusammenhang zwischen Marktstrategien und dem wirtschaftlichen Erfolg von Geschäftseinheiten analysiert.
Welche Erkenntnisse lieferten Peters und Waterman?
In ihrer Studie „In Search of Excellence“ identifizierten sie acht Merkmale exzellenter Unternehmen, wie z.B. Kundennähe und Handlungsorientierung.
Wie werden Erfolgsfaktoren identifiziert?
Dies geschieht durch empirische Analysen, Experteninterviews oder Vergleiche zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmen (Benchmarking).
Warum wird das Experteninterview kritisiert?
Kritikpunkte sind die mangelnde Objektivität, die Abhängigkeit von der subjektiven Wahrnehmung des Experten und die schwere Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse.
Was ist der Unterschied zwischen Erfolg und Erfolgsgrößen?
Erfolg ist das positive Ergebnis des Handelns, während Erfolgsgrößen die messbaren Kennzahlen (z.B. ROI, Gewinn) sind, die diesen Erfolg quantifizieren.
- Arbeit zitieren
- M.Sc. Artur Janke (Autor:in), 2018, Methodiken der Erfolgsfaktorenforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014923