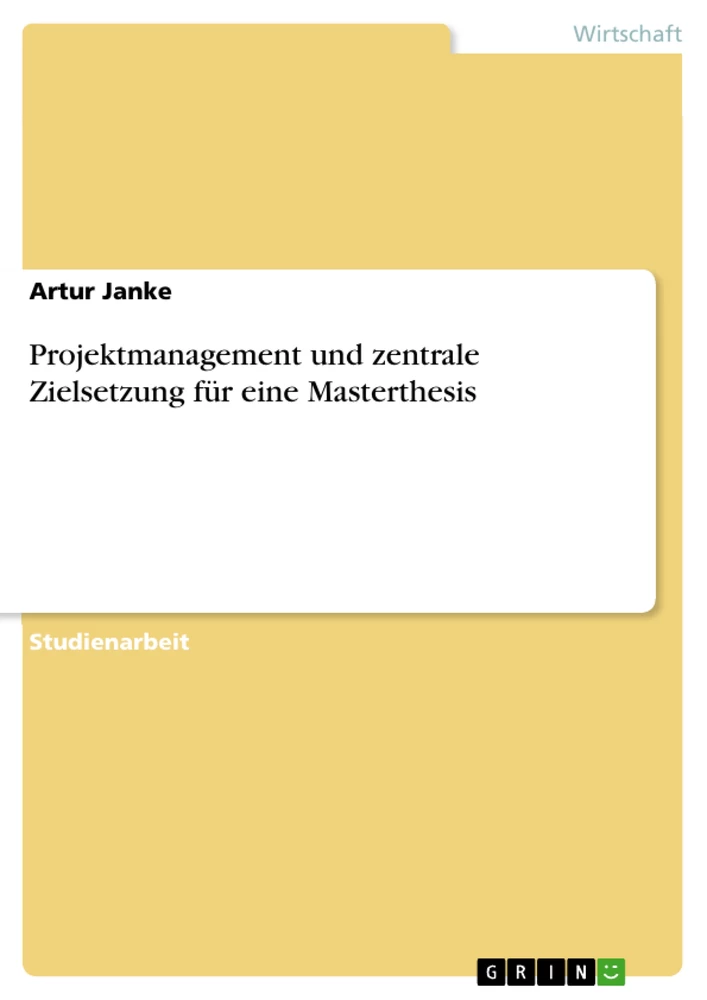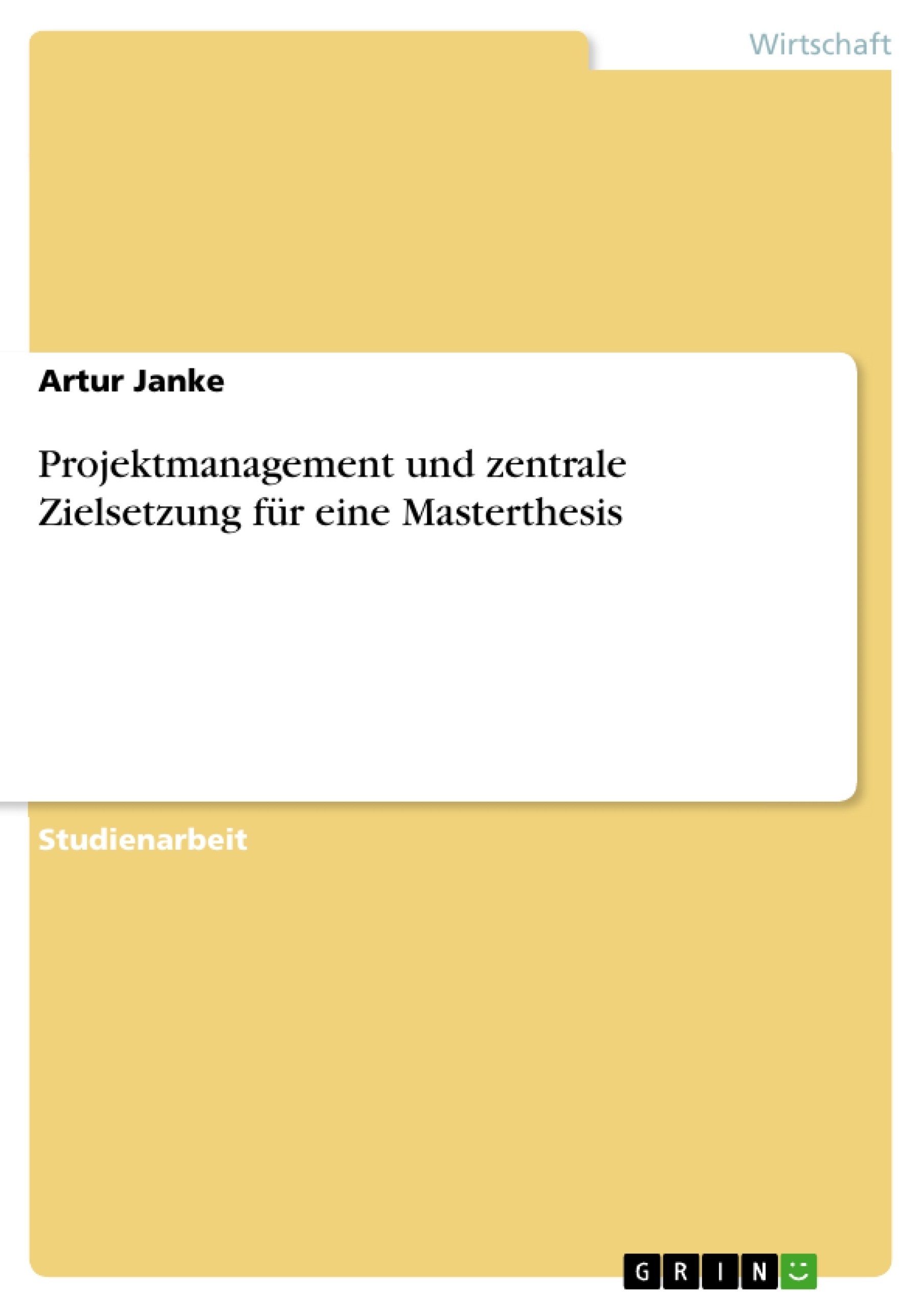Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundlagen des Projektmanagements aufzuzeigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem klassischen Projektmanagement, andere Formen wie zum Beispiel das agile Management werden dabei nur als Ergänzung erwähnt.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen vorgestellt. Dazu werden zunächst die einzelnen Begriffe Projekt, Management und anschließend das Kompositum Projektmanagement definiert. Anschließend wird die Bedeutsamkeit der Projektziele erläutert. Das dritte Kapitel beschreibt die klassische Vorgehensweise beim Projektmanagement. Diese besteht aus dem phasenweisen Verlauf und wird in den gängigsten Phasenmodellen (lineares, paralleles und iteratives Phasenmodell) dargestellt. Im vierten Kapitel wird die gewonnene Erkenntnis auf die anschließende Masterthesis übertragen. Zunächst wird die Problemstellung erläutert und anschließend sowohl die zentrale Zielsetzung als auch die entsprechenden Teilziele abgeleitet. Eine vorläufige Grobgliederung der Masterthesis (Anhang II) rundet das Vorhaben ab. Das fünfte Kapitel schließt diese Arbeit mit einer kritischen Auseinandersetzung innerhalb der Zusammenfassung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Definition Projekt
- Definition Management
- Definition Projektmanagement
- Projektziele
- Klassische Vorgehensweise beim Projektmanagement
- Phasenweiser Verlauf
- Meilensteine
- Phasenmodell
- Lineares Phasenmodell
- Paralleles Phasenmodell
- Iteratives Phasenmodell
- Anwendung im Rahmen der Masterthesis
- Einführung in die Thematik und Problemstellung
- Zentrale Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Grundlagen des klassischen Projektmanagements und zeigt dessen Relevanz in einem dynamischen Umfeld auf. Sie analysiert die verschiedenen Phasen und Modelle des klassischen Projektmanagements und beleuchtet deren Anwendung im Kontext einer Masterthesis.
- Definition und Abgrenzung des Projektmanagements
- Phasenweise Vorgehensweise und Phasenmodelle im Projektmanagement
- Anwendung des klassischen Projektmanagements in der Praxis
- Relevanz des Projektmanagements in der modernen Arbeitswelt
- Zusammenhang zwischen Projektmanagement und der Masterthesis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel erläutert die Motivation und Ziele der Arbeit sowie das Vorgehen. Es wird die Problemstellung des klassischen Projektmanagements in einem zunehmend agilen Umfeld beleuchtet.
- Grundlagen: In diesem Kapitel werden die Begriffe Projekt, Management und Projektmanagement definiert, um das grundlegende Verständnis für die weiteren Kapitel zu schaffen.
- Klassische Vorgehensweise beim Projektmanagement: Dieses Kapitel beschreibt die klassische Vorgehensweise beim Projektmanagement anhand des phasenweisen Verlaufs und der gängigsten Phasenmodelle (lineares, paralleles und iteratives Phasenmodell).
- Anwendung im Rahmen der Masterthesis: Dieses Kapitel zeigt die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse auf die Masterthesis. Es erläutert die Problemstellung, die zentrale Zielsetzung und den Aufbau der Masterthesis.
Schlüsselwörter
Projektmanagement, klassische Vorgehensweise, Phasenmodell, lineares Phasenmodell, paralleles Phasenmodell, iteratives Phasenmodell, Masterthesis, Problemstellung, Zielsetzung, Aufbau.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen linearen und iterativen Phasenmodellen?
Lineare Modelle folgen einer festen Abfolge, während iterative Modelle Wiederholungsschleifen erlauben, um Ergebnisse schrittweise zu verbessern.
Warum sind Projektziele für das Management so wichtig?
Ohne klar definierte Ziele fehlt dem Projekt die Orientierung; sie sind die Basis für Planung, Kontrolle und den abschließenden Erfolg.
Wie lassen sich Meilensteine im Projektmanagement nutzen?
Meilensteine markieren wichtige Etappenziele und dienen zur Überprüfung des Projektfortschritts zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Inwiefern hilft Projektmanagement beim Schreiben einer Masterthesis?
Es hilft bei der Strukturierung der Arbeit, der zeitlichen Planung und der Ableitung von Teilzielen aus der zentralen Forschungsfrage.
Wird in der Arbeit auch agiles Management behandelt?
Der Schwerpunkt liegt auf dem klassischen Projektmanagement; agile Methoden werden lediglich als ergänzende Form erwähnt.
- Quote paper
- M.Sc. Artur Janke (Author), 2019, Projektmanagement und zentrale Zielsetzung für eine Masterthesis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1014928