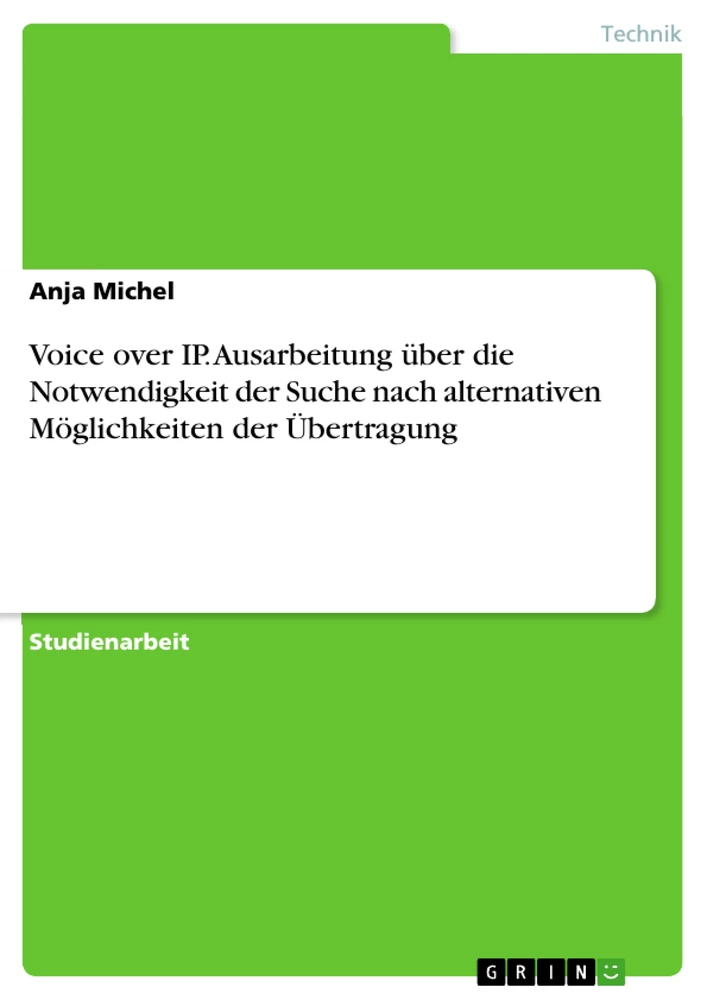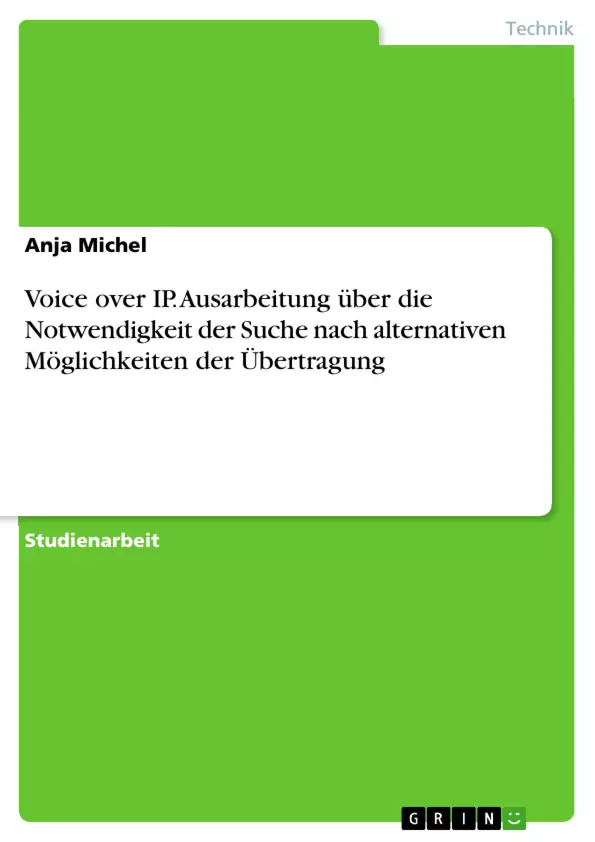Klassische Sprachnetze sind zwar netzintern mittlerweile ausschließlich digital, allerdings sind die Teilnehmerzugänge zumeist noch analog.Dies gilt besonders für den privaten Bereich, im Geschäftsbereich ist die Digitalisierung bereits weiter fortgeschritten. Bisherigen Sprachnetzen liegen unterschiedliche Konzeptionen zugrunde, das historisch älteste ist das Festnetz.
Um den Anforderungen von Unternehmen nach mehr Flexibilität gerecht zu werden, wurden Virtual Private Networks entwickelt. Dabei stehen weniger die Hardwareeigenschaften des Netzes im Vordergrund. Aus den gleichen Gründen entwickelten sich die Enterprise Networks, die sich hauptsächlich durch ihren juristischen Status unterscheiden. Dies führte zur Entwicklung von zahlreichen eigenständigen Sprach-Daten-Netzen.
Angesichts der Ausgereiftheit der klassischen Sprachnetze und deren hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf die Sprachübertragung stellt sich die Frage, wieso man überhaupt
nach anderen Möglichkeiten der Übertragung sucht, die wesentlich mehr Probleme mit sich bringen. Dieser Frage soll in den folgenden Kapitel nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
1 WARUM IP
1.1 Klassische Sprachübertragung
1.2 Konvergenz von Sprach- und Datennetzen - Vorteile und Probleme
1.3 Das IP-Protokoll
1.4 Quality of Services (QoS)
2 PROTOKOLLE UND VERFAHREN
2.1 H.323 und dessen Subprotokolle
2.2 Übertragung und Kommunikationsablauf über H.323
2.3 Alternative Protokolle
2.3.1 SIP
2.3.2 Tiphon
3 PRAKTISCHE UMSETZUNG
3.1 Architektur von H.323-Netzwerken
3.2 Anwendungsmöglichkeiten
3.3 Der Markt für VoIP
4 AUSBLICK
5 LITERATURVERZEICHNIS
6 EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG
7 STICHWORTVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Bild 1: Konvergenz der Netze zu einem Universalnetz
Bild 2: Vom klassischen Telefonie-Netz zur IP-Telefonie - ein Kostenvorteil ?
Bild 3: Aufbau eines IP-Paketes
Bild 4: Verzögerung zwischen den Endpunkten in einem VoIP-Netz
Bild 5: Verzögerung durch Jitter
Bild 6: Verzögerung durch falsche Reihenfolge der Pakete
Bild 7: Qualitätsminderung durch Paketverluste
Bild 8: H.323 und seine Subprotokolle
Bild 9: Komponenten des Standards H.323
Bild 10: H.323-Protokolle im OSI-Schichtenmodell
Bild 11: Ablauf eines Gesprächs über H.323
Bild 12: VoIP über SIP
Bild 13: SIP - Verbindungsaufbau im Proxy Mode
Bild 14: SIP - Verbindungsaufbau im Redirect Mode
Bild 15: Tiphon-Architektur
Bild 16: Architektur eines H.323-Netzwerkes
Bild 17: Varianten der IP-Telefonie
Bild 18: Zweigstellenlösung mit VoIP
Bild 19: Marktvolumen für sprachgestützte Web-Services wächst bis 2004 auf 16 Mrd. US- Dollar
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Warum IP
1.1 Klassische Sprachübertragung
Klassische Sprachnetze sind zwar netzintern mittlerweile ausschließlich digital, allerdings sind die Teilnehmerzugänge zumeist noch analog.1 Dies gilt besonders für den privaten Bereich, im Geschäftsbereich ist die Digitalisierung bereits weiter fortgeschritten. Bisherigen Sprachnetzen liegen unterschiedliche Konzeptionen zugrunde, das historisch älteste ist das Festnetz. Um den Anforderungen von Unternehmen nach mehr Flexibilität gerecht zu werden, wurden Virtual Private Networks entwickelt. Dabei stehen weniger die Hardwareeigenschaften des Netzes im Vordergrund. Aus den gleichen Gründen entwickelten sich die Enterprise Networks, die sich hauptsächlich durch ihren juristischen Status unterscheiden. Dies führte zur Entwicklung von zahlreichen eigenständigen Sprach-Daten- Netzen.2 Der wachsenden Mobilität wurden die Mobilfunknetze gerecht, die außerordentliche Zuwachsraten verzeichnen. Sie werden zukünftig mit den Festnetzen verschmelzen. Sprache zeichnet sich durch einen kontinuierlichen Signalfluss aus. In klassischen Sprachnetzen wird die Sprache dann digitalisiert, d.h. sie wird mit einer Frequenz von 8 kHz abgetastet und die digitalen Impulse gesendet. Es wird nicht die gesamte Bandbreite der menschlichen Sprache, die von 120 Hz bis etwa 10 kHz reicht, übertragen. Das würde die Leitungen unnötig belasten, da zur Verständlichkeit und Sprechererkennung auch der Bereich von 300 Hz bis 3400 Hz ausreicht. Da die Sprachsignale mit 8 bit quantisiert werden, ergibt sich eine Datenrate von 64 kbit/s. Im PCM-Verfahren, das der ISDN-Übertragung zugrunde liegt, sind die einzelnen Quantisierungsstufen nicht gleich groß. Hier wird für kleinere Signalwerte eine feinere Quantisierung als für höhere Werte verwendet. Durch die damit verbundene Verringerung des Störgeräuschpegels kann mit 8 bit dieselbe Sprachqualität erreicht werden wie bei einer 11bit- Linearquantisierung. Standardisiert wurde dieses Verfahren in der ITU-Norm G.711, die auch für die Quantisierung der Sprache bei VoIP benutzt wird.
In der ISDN-Übertragung wird der PCM30-Rahmen benutzt. Durch die Staffelung werden 30 Kanäle mit je 64 kbit/s erzeugt, zusätzliche Informationen werden in zwei Steuerkanälen untergebracht.3 Dadurch kann eine Übertragungsrate von 2 Mbit/s erreicht werden. Wichtig für die Sprache ist ein isochroner Verkehr, d.h. die Abstände zwischen den Nachrichtenteilen sind konstant.4 Diese Forderung wird in den leitungsvermittelten Netzen, die für die Sprachübertragung bisher genutzt werden, uneingeschränkt erfüllt.
Angesichts der Ausgereiftheit der klassischen Sprachnetze und deren hervorragende Eigenschaften in Bezug auf die Sprachübertragung stellt sich die Frage, wieso man überhaupt nach anderen Möglichkeiten der Übertragung sucht, die wesentlich mehr Probleme mit sich bringen. Dieser Frage soll in den folgenden Kapitel nachgegangen werden.
1.2 Konvergenz von Sprach- und Datennetzen - Vorteile und Probleme
Zukünftige Netze werden sich durch wesentlich höhere Anforderungen an Bandbreite auszeichnen, dies gilt sowohl für den Festnetz als auch für den Bereich der Mobilkommunikation.5 Die meisten Quellen gehen von einer Konvergenz von Sprach - und Datennetzen zu einem Universalnetz aus. Dies bietet für das Unternehmen entscheidende Vorteile.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1: Konvergenz der Netze zu einem Universalnetz6
Durch den Aufbau einer einheitlichen Infrastruktur für alle Netze eines Unternehmens entfallen die gesonderten Anforderungen eines Sprachnetzes. Das bedeutet, dass die Wartung einheitlicher wird und somit Kosten gespart werden können.7 Ein weiterer, sehr wesentlicher Faktor, der die Entwicklung von VoIP-Lösungen stark vorantrieb, war die Einsparung von Gesprächskosten.8 Mit dem Begriff Voice over IP soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das IP-Protokoll zur Sprachübertragung verwendet wird.9 So könnte z.B. das firmeneigene Intranet für die Telefonie genutzt werden. In diesem Fall würden lediglich die Kosten für die ohnehin meist gemieteten Leitungen entstehen, Kosten für das Telefonieren über das öffentliche Netz würden entfallen. Die Übertragung von Sprache und Daten über dasselbe Netz bietet so erhebliche Einsparungen im Weitverkehrsbereich.10 Hier bietet sich gerade für Unternehmen mit mehreren Standorten, die über das ganze Land verteilt sind, ein enormes Sparpotential. Jedoch hat dieser Faktor aufgrund des Preisverfalls am Telefonmarkt an seiner Bedeutung verloren. Näher betrachtet schlägt der Kostenvorteil momentan sogar in einen Nachteil um. Gegenwärtig belaufen sich die Kosten für einen Anschluss auf etwa 200 bis 1000 US-Dollar.11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 2: Vom klassischen Telefonie-Netz zur IP-Telefonie - ein Kostenvorteil ?12
Es gibt jedoch andere Vorteile, die VoIP zu einer echten Alternative zur klassischen Telefonie machen.
IP liefert eine einheitliche Schnittstelle für neue Anwendungen und ein Betätigungsfeld für viele Softwareentwickler. Die TK-Anlage entwickeln sich zu Multimedianetzen mit steigenden Funktionalitäten. Genau diese steigenden Funktionalitäten werden den Erfolg von VoIP ausmachen, die Anwendungen müssen mehr Leistungen und Komfort bieten als die bisherigen. Dies gestaltet sich noch schwierig, momentan umfaßt der Leistungsumfang gerade mal den Basic Call. Außerdem müssen sich die Anwendungen schneller als die bisherigen Systemtelefone entwickeln.13
Gegenüber der klassischen Telefonie hat VoIP aber noch einige Schwachstellen aufzuweisen. Die bisherigen Netze zeichnen sich durch besondere Robustheit aus, sie weisen pro Jahr einen Ausfall von maximal 5 Minuten auf. Außerdem verfügen sie bereits über ausgereifte Standards. Die Infrastruktur insgesamt ist sehr kostengünstig, die Systeme arbeiten wirtschaftlich. Das bedeutet nicht das Aus für VoIP, entscheidend wird die Akzeptanz jedoch davon abhängen, ob die Einbindung in die vorhandenen Telekommunikationssysteme gelingt.14
Weitere Tücken der IP-Telefonie sind die bisher noch mangelhafte Interoperabilität der Systeme verschiedener Anbieter. Außerdem bereitet die Abrechnung (Billing) von Leistungen noch Schwierigkeiten.
Allerdings wurden bei den einzelnen Sprachnetzen15 weitgehend Einzellösungen realisiert, zwischen denen Netzübergänge zwar prinzipiell möglich sind, aber häufig nur einen Basic Service unterstützen. Da sich zukünftig eine Integration der Netze abzeichnet16, kann IP eine geeignete Basis dafür bieten.
1.3 Das IP-Protokoll
Wenn man von IP spricht, meint man häufig eine ganze Protokollfamilie mit zusätzlichen Hilfsprotokollen, ohne die eine Kommunikation über IP nicht möglich wäre. Dieses Protokoll selbst arbeitet auf der Ebene 3 des OSI-Modells. Dieser verbindungslos arbeitende Dienst wird zur Kommunikation zwischen den Endsystemen benutzt.17 Aus Geschwindigkeitsgründen wurde in der IP-Ebene auf Sicherungsalgorithmen für die Daten verzichtet, es gibt einzig eine Prüfsumme für die Headerinformationen.
IP-Netze sind paketvermittelte Netze, die Datenpakete werden von Routern weitergeleitet. Es kann so keine bestimmte Antwortzeit garantiert werden, da Pakete, die aus unterschiedlichen Gründen nicht weitergeleitet werden können, verworfen werden. Netzseitig wird keine Sicherheit für die Daten gewährleistet, das wird den Endgeräten überlassen.18 IP verwendete bisher 4 Bit lange Adressen, in der neuen Generation Ipv6 werden die Adressen eine Länge von 128 Bit haben. Diese Erhöhung ist notwendig geworden, da weltweit immer mehr Rechner über IP vernetzt werden und so die Eindeutigkeit der Adressen nicht mehr dauerhaft gewährleistet werden könnte. Gerade bei den Bestrebungen zum Ausbau der IP-Telefonie, die weitere Endgeräte in Einsatz bringt, ist ein Ausbau des Adressraums zwingend erforderlich. IPv6 bietet weiterhin eine eingebettete Verschlüsselung, verbessertes Routing und QoS. So gibt es im Header des Datenpaketes ein 24Bit-Flow-Label-Feld, in dem Datenpakete, die eine spezielle Dienstgüte erfordern, gekennzeichnet werden können.19
IP-Pakete haben einen Header und einen Rumpf, der die Dateninformationen enthält. Im Header werden Protokollinformationen, wie Sender und Empfängeradresse transportiert. Um zu verhindern, dass fehlgeleitete Pakete die Netzwerke unnötig belasten, ist im Header auch die Lebensdauer eines Paketes (TTL) vermerkt. So wird die Anzahl der Router, die so ein Paket durchlaufen kann, beschränkt.20
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 3: Aufbau eines IP-Paketes21
IP realisiert nur die Adressieren und das Routing der Pakete, darüber hinausgehende Dienste werden von anderen Protokollen der IP-Familie übernommen. Für den Transport sind UDP oder TCP zuständig. Weiterhin gibt es noch Hilfsprotokolle, die für Fehlermeldungen, Bandbreitenreservierung (RSVP) oder Adreßauflösung zuständig sind. Zur IP-Familie gehören auch die Applikationsprotokolle für E-mail (SMTP), Namensauflösung (DNS), Management, File Transfer (FTP) und das World Wide Web (HTTP).22
Die Weiterleitung der IP-Protokolle erfolgt über Router, die als Vermittlungsknoten fungiert. Er entpackt das Paket und interpretiert die Ebene-3-Informationen. Dann wird das Paket entweder zu einer Station in einem lokal angebundenen Netzwerk oder zu einem nächsten Router weitergeleitet. Die Adresse des nächsten Routers entnimmt der Router aus Routingtabellen, indem er den Netzanteil der IP-Adresse mit den Einträgen dort vergleicht. Wird kein passender Eintrag gefunden, wird das Paket verworfen und eine Fehlermeldung an die Ursprungsadresse geschickt.
Transportiert werdend die Pakete über UDP oder TCP. UDP arbeitet verbindungslos und ungesichert, TCP baut eine Verbindung auf und bestätigt die Pakete.23 Hier liegt die Vermutung nahe, dass Sprache über TCP übertragen wird. Das würde aber einen zu großen Overhead verursachen, der den Prozess erheblich verlangsamt. Es wird daher UDP verwendet, was wiederum weitere Mechanismen zur Nummerierung und Sortierung der Pakete notwendig macht. Darauf wird jedoch an anderer Stelle noch genauer eingegangen.
1.4 Quality of Services (QoS)
Die Anforderungen an ein Sprachnetz sind vielfältig: vor allem wichtig ist jedoch ein gutes Echtzeitverhalten. Sprache ist ein kontinuierlicher Prozess, dessen Natur es völlig widerspricht, in Pakete aufgeteilt zu werden. Telefonie ist neben Video Conferencing der klassische Fall der Echtzeitanwendung. Hier müssen die Verzögerungszeiten beim Datentransport minimal sein, da das menschliche Gehör sie sonst wahrnehmen und die Teilnehmer das als nicht zu akzeptierende Fehler auffassen würden. Es muss ebenfalls gewährleistet sein, dass die Pakete in der richtigen Reihenfolge beim Empfänger abgeliefert werden, da die übertragenen Sprachfetzen sonst keinen Sinn mehr ergeben. Erst wenn diese beiden Störfaktoren minimiert werden, kann ein Mindestmaß an Sprachqualität gewährleistet werden, ohne dass andere Datenübertragungen massiv beeinträchtigt werden. Des weiteren muss ein gezieltes Bandbreitenmanagement gewährleisten, dass stets genug Bandbreite zur Verfügung steht, dass aber auch ungenutzte Bandbreite für andere Anwendungen freigegeben wird.
Diese Anforderungen können von IP allein nicht erfüllt werden, so dass noch zusätzliche
Mechanismen geschaffen werden mußten, um die Dienstgüte (Quality of Service) zu gewährleisten. IP bietet lediglich die Möglichkeit einer Priorisierung der Datenpakte im Type- of-Service-Feld im Header. Bei starker Netzbelastung ist allerdings diese Priorisierung hinfällig und Echtzeitübertragung sowie die richtige Reihenfolge werden ohnehin nicht garantiert.
Daher wurde bereits 1989 das Real Time Transport Protocol entwickelt, das diese Mängel beseitigen soll. In diesem Zusammenhang wurden auch das Real Time Transport Control Protocol (RTCP) und das Real Time Transport Streaming Protocol beschrieben, die für die Überwachung der Datenzustellung und die Kontrolle der Multimedia-Datenströme zwischen den Kommunikationspartnern zuständig sind. Zur Reservierung der Bandbreite wird das von Cisco und IETF entwickelte RSVP (Ressource Reservation Protocol) verwendet. Dieses
Protokoll baut über die Router zunächst einen Pfad auf und reserviert dann die entsprechenden Ressourcen für die spätere Übertragung. Diese Übertragung kann auch in Verkehrsklassen definiert werden.24
Schon daraus wird deutlich, dass die Bandbreitenreservierung im firmeninternen Intranet weniger Probleme bereitet, da dort vom Netzwerkmanagement Maßnahmen zur Priorisierung von Sprachdaten getroffen werden können. Über das öffentlich Internet müssen jedoch Abstriche hingenommen werden, da die maßgeblichen Faktoren nur sehr eingeschränkt beeinflußt werden können.25
Für die Sprachqualität einer VoIP-Verbindung sind folgende Kriterien bestimmend26:
- Laufzeit des Sprachsignals
- Verlust einzelner Sprachabschnitte
- Einsatz von Sprachkomprimierung
Wie sich die einzelnen Faktoren auf die Sprachverbindung auswirken, soll nun erläutert werden.
Verschiedene Faktoren sind dafür verantwortlich, dass die Laufzeit bei Sprachverbindungen über das IP-Protokoll wesentlich höher sein kann als bei der klassischen Telefonie. Dafür sind unter anderem die Sprachkomprimierung und die Wartezeit bei der Paketierung verantwortlich. Weiterhin verzögert die Zwischenspeicherung der Pakete in den Netzknoten bei hoher Netzlast deren Weiterleitung und beeinträchtigt somit die Sprachqualität. Auch die Sprachkomprimierung an sich kann zu Verzerrungen des Signals führen. Zu lange Signallaufzeiten können dazu führen, dass eine ordentliche Kommunikation nicht mehr möglich ist, daher wurde von der ITU eine Obergrenze von 400ms empfohlen. Im öffentlichen Telefonnetz liegen die Verzögerungszeiten bei 20 bis 30 ms, während sie in VoIP-Netzen Größen von über 500 ms erreichen können.27
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 4: Verzögerung zwischen den Endpunkten in einem VoIP-Netz28
Da das IP-Protokoll verbindungslos arbeitet, nehmen nicht alle Sprachpakete den gleichen Weg durch das Netz. So kommt ein Jitter zustande, das bedeutet, die Abstände zwischen den Paketen sind nicht mehr gleich groß.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 5: Verzögerung durch Jitter29
Außerdem kann die Reihenfolge vertauscht worden sein. Um die Pakete wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen, ist ein Jitter-Buffer notwendig. Die Pakete werden dort zwischengespeichert und in der richtigen Reihenfolge ausgegeben. Da die Laufzeiterhöhung zu einem Sprecherecho führen kann, müssen im Verbindungsweg und in den Endgeräten zusätzliche Echokompensatoren vorgesehen werden.30
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 6: Verzögerung durch falsche Reihenfolge der Pakete
Da für die Pakete die ungesicherte Übertragung via UDP gewählt wurde, kann es vorkommen, das Pakete verlorengehen. So werden zum Beispiel Pakete, deren Jitter größer ist als der Jitter-Buffer auf der Empfangsseite verworfen. Genauso verfahren IP-Knoten, die übermäßig belastet sind, um die Überlast abzubauen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 7: Qualitätsminderung durch Paketverluste31
Die Tonqualität ist außerdem abhängig von der Rechnerleistung, dem Internet-Zugang und der momentanen Netzbelastung auf dem gesamten Übertragungsweg.32 Die Kombination verschiedener negativer Einflussfaktoren kann zu einer erheblichen Verschlechterung der Sprachqualität führen, was wiederum Akzeptanzprobleme nach sich ziehen kann, da die Sprachqualität in den klassischen Telefonienetzen kontinuierlich verbessert wurde.
2 Protokolle und Verfahren
2.1 H.323 und dessen Subprotokolle
Für die gegenwärtige VoIP-Übertragung wird zumeist das Protokoll H.323 benutzt. Es wurde von der ITU 1996 verabschiedet und sollte eigentlich vorrangig für Multimedia-Konferenzen im LAN dienen.33 Genaugenommen ist H.323 eine Sammlung von Standards, die Verbindung, Codierung und Sicherheit bis Zusatzdienste regeln.34 Dies wird durch folgende Grafik genauer verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 8: H.323 und seine Subprotokolle35
1998 wurde der Standard erstmals überarbeitet und um die Leistungsmerkmale Rufumleitung und Gesprächsübergabe im Subprotokoll H.450 ergänzt.36 In der dritten Version aus dem vorletzten Jahr wurde H.450 um die Rückfrage und Rufnummernübermittlung ergänzt und die Skalierbarkeit verbessert. Momentan ist für H.323 die vierte Version geplant, die Ende November 2000 verabschiedet werden sollte. Sie soll dann außerdem Fax über IP in Echtzeit ermöglichen. Außerdem wurden Maßnahmen zur Sicherstellung der Dienstgüte (QoS) festgeschrieben.
H.323 beschreibt vier Netzbestandteile, die für die Kommunikation notwendig sind. Die Endgeräte werden als Terminals bezeichnet. Sie müssen Sprachdienste unterstützen, können darüber hinaus aber auch Video- und Datenkommunikation ermöglichen.37 Die Endgeräte müssen außerdem H.245, Q.931 und RAS unterstützen.
Die Gateways bilden die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Netztypen, so zum Beispiel zwischen dem LAN und Circuit Switching Networks. Sie konvertieren sowohl die Übertragungsformate als auch die Kommunikationsprozeduren in andere ITU-konforme Formate.38 Weiterhin werden auch Audio- und Video-Codecs übersetzt und für den Verbindungsaufbau und -abbau gesorgt. Obwohl die Gateways mit den Terminals über H.245 und Q.931 kommunizieren, sind viele Leistungsmerkmale herstellerspezifisch. Das äußert sich in der maximalen Anschlusszahl von Terminals oder der Zahl der gleichzeitig möglichen Konferenzen. Allerdings beschränkt das die Kommunikation nur geringfügig, denn sobald die Geräte dem H.323-Standard genügend, können sie auch zusammenarbeiten.39
Die Gatekeeper sind hauptsächlich für Bandbreiten-Management und die Adressübersetzung von Audio-/Videoadressen in IP-Adressen zuständig. Das Bandbreiten-Management umfaßt unter anderem den Verbindungsaufbau bis zu einer maximalen Verbindungszahl, um gleichzeitig anderen Anwendungen wie E-mail oder File Transfer noch genügend Bandbreite zur Verfügung zu stellen. Der Gatekeeper überwacht die gesamte Kommunikation zwischen den anderen Netzkomponenten. Er muss in einem Netz nicht zwingend vorhanden sein, wenn er es ist, sind seine Dienste allerdings für alle Komponenten verbindlich. Zusätzlich kann der Gatekeeper noch weitere Funktionen, z.B. Call Control Signalling oder Call Authorization anbieten.40 Wichtig ist der Gatekeeper jedoch für die Mehrpunkt-Verbindung, die auch von der MCU unterstützt werden. Die Multipoint Control Unit handelt die zur Verfügung stehenden Ressourcen zwischen allen Teilnehmern, sowohl für Audio- als auch für Video- Daten aus.41 Diese Aufgabe wird vom Multipoint Controller der MCU übernommen, der die Anzahl der Konferenzteilnehmer überwacht. Pro Konferenz läßt H.323 nur einen MC zu. Der Multipoint Processor ist für das Zusammenfügen, Multiplexen und Switchen der Datenströme verantwortlich. Er kann auch unterschiedlich Codecs und Bitraten behandeln.42
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 9: Komponenten des Standards H.32343
Die H.323-Konferenz kann in verschiedene Typen eingeteilt werden. In einer zentralisierten Konferenz werden die Datenströme aller Terminals zur in einer Point-to-Point-Verbindung zur MCU gesendet, die dann die Kapazitäten im Netz definiert und die Bits sendet. In einer dezentralen Konferenz werden die Daten von jedem Terminal selbst gesendet. Die Kontrolle der Konferenz bleibt aber weiterhin der MCU überlassen. Außerdem ist eine Mischform der beiden Typen möglich, die sogenannte Hybrid Conference.
Wie bereits erwähnt, ist H.323 eigentlich ein Synonym für eine ganze Produktfamilie, deshalb sollen nachfolgend die Subprotokolle von H.323 kurz erläutert werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 10: H.323-Protokolle im OSI-Schichtenmodell44
Zur Signalisierung wird bei VoIP der Standard H.225 angewandt, der sich wiederum in die Subprotokolle RAS und Q.931 aufspaltet. Diese Protokolle regeln die Kommunikation der Gatekeeper. RAS steht für Registration, Admission & Status und wird vom Gatekeeper zur Signalisierung verwendet. Außerdem registrieren sich die Terminals beim Gatekeeper über RAS.45 Q.931 ist für die Call Control verantwortlich.
Für die Verbindungskontrolle findet der Standard H.245 Anwendung. Er regelt das Öffnen der Medienströme. Für die Codierung der Videoinformationen wird die Standardreihe H.26x verwendet, auf die jedoch hier nicht weiter eingegangen werden soll.
Für reine Audio-Informationen wird der ITU-Standard G.711 zur Codierung verwendet.
Dieser Standard findet ebenfalls bei der herkömmlichen ISDN-Übertragung Anwendung, aber auch im Mobilfunkbereich. Für die Übertragung wird die Pulse Code Modulation (PCM) benutzt, im ISDN das bereits beschriebene PCM 30-System. Die Sprache wird hier unkomprimiert übertragen. Sie liefert eine gute Sprachqualität, ist aber nicht geeignet für SoHo-Verbindungen und ein hohes Sprachverkehr-Aufkommen bei H.323.46 Daneben finden auch noch andere ITU-T Standards zur Komprimierung Anwendung, so etwa G.721, der Sprache mit 32kbit/s kodiert und bei vielen Übertragungsfehlern eine bessere Sprachqualität im Vergleich zu G.711 liefert.47 Dieser Standard sowie G.723.1, G.728 undd optional.48
Für die Zusammenarbeit von Media Terminals und Schwitched Networks, also die Funktionalität der Gateways ist H.246 verantwortlich. Das Protokoll sorgt unter anderem für die Übersetzung von IP-Adressen in Rufnummern.49 Für die Sicherheit und Verschlüsselung der Daten wird H.235 verwendet.
Zusatzdienste werden über H.450 implementiert und stellen gegenwärtig noch eines der größten Probleme bei VoIP dar. Viele in der klassischen ISDN-Kommunikation bereits nutzbaren Leistungsmerkmal sind über VoIP noch nicht realisiert. Erst in den letzten beiden Jahren wurde verstärkt, daran gearbeitet, für VoIP dieselben Merkmal zur Verfügung zu stellen. So wurden 1998 Call Transfer, Forward und Call Hold implementiert. Im darauffolgenden Jahr die Message Waiting Indication und Call Waiting eingeführt. In diesem Jahr soll die Anruferkennung folgen.50 Die Palette der Leistungsmerkmale, die alle mit H.450.xx benannt werden, soll und muss in den nächsten Jahren ständig erweitert werden, um VoIP-Nutzern den gleichen Komfort wie beim ISDN bieten zu können.
2.2 Übertragung und Kommunikationsablauf über H.323
Zur Kommunikation verwendet H.323 sowohl gesicherte Kanäle als auch ungesicherte. Die zu übertragenen Daten, Sprache und Video, aber auch der RAS-Channel werden ungesichert übertragen. Sicherungsalgorithmen werden nur für die H.245-Kontrollkanäle und die Signalisierungskanäle verwendet. Diese Daten dürfen nicht verlorengehen und müssen auf der Gegenseite auch in der richtigen Reihenfolge ankommen, um eine erfolgreiche Kommunikation zu ermöglichen.51 Deshalb wird hier das verbindungsorientierte TCP verwendet, das auch eine Flusskontrolle beinhaltet. TCP hat aber auch einen großen Overhead, der beträchtliche Laufzeiten mit sich bringt.
Da die Sprach- und Videodaten schnellstmöglich beim Empfänger ankommen sollen, werden sie über das verbindungslose UDP übertragen. Allerdings muss dabei auch auf die Flusskontrolle, also das Nummerieren der Datenpakete verzichtet werden. Mittels der Voice Activity Detection wird ermittelt, wann gesprochen wird und wann nicht. In den Sprachpausen werden dann keine Daten gesendet, um die Netzlast geringer zu halten. Dies kann bei den Gesprächspartner zur Irritationen führen, da selbst bei einer ISDN-Übertragung Hintergrundgeräusche zu hören sind. Bei einem VoIP-Gespräch hingegen ist in Sprachpausen nichts zu hören, was dazu führen kann, dass der Teilnehmer glaubt, das Gespräch sei unterbrochen worden. Daher wird in den Pausen ein sogenanntes comfort noise, ein Rauschen eingespielt, um die Verbindung realistisch zu gestalten.52
Der Verbindungsauf- und abbau oder auch Call Signalling ist der erste Schritt der Kommunikation über H.323. Außerdem werden über diesen Dienst Änderungen in der Bandbreite vorgenommen und Status-Meldungen der Terminals weitergegeben. Jede Einheit eines H.323-Netzes muss mindestens eine Netzwerkadresse haben.
Im folgenden werden die einzelnen Schritte eines typischen Gesprächsverlaufes über H.323 beschrieben, sie werden zusätzlich in Bild 11 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 11: Ablauf eines Gesprächs über H.32353
Zunächst wird vom Terminal, das ein Verbindung aufbauen will, beim Gatekeeper die Erlaubnis dazu über den RAS-Channel angefordert (Admission Request). Ist die Erlaubnis erteilt worden (Admission Confirm), sendet das Terminal 1 den Setup-Befehl über Q.931 an das zweite Endgerät. Damit wird der Verbindungswunsch übermittelt. Nimmt die Gegenseite den Call an, sendet es über das gleiche Protokoll die Mitteilung, dass die Verbindung initiiert wurde und dass keine weiteren Verbindungsgesuche angenommen werden (Call Proceeding). Nun fordert das zweite Terminal ebenfalls beim Gatekeeper die Erlaubnis zum Verbindungsaufbau an. Wurde die bestätigt, sendet Terminal 2 an des erste Terminal ein Connecting-Signal über Q.931 und die Verbindung kommt zustande.
Nun werden über H.245 noch Informationen zwischen den Endgeräten ausgetauscht, bevor die eigentlichen Daten übermittelt werden. Zunächst wird über den Befehl Terminal Capability Set übermittelt, inwieweit die Terminals in der Lage sind, Multimediadaten zu senden oder zu empfangen. In diesem Schritt wird außerdem ausgehandelt, welches Terminals bei dieser Verbindung die übergeordnete Rolle54 spielen soll. Zu diesem Zweck sendet Terminal 1 die Anforderung Master/Slave Determination. Vom Terminal 2 kann diese Anforderung angenommen oder verweigert werden. Wird sie angenommen, sendet das Terminal ein entsprechendes Acknowlegde-Signal zurück. Vom Terminal 1 wird dieses Signal ebenfalls noch einmal übermittelt, um diese Abmachung zu bestätigen. Danach sendet Terminal 1 den Befehl zum Öffnen eines logischen Kanals, über den die Daten gesendet werden sollen (Open Logical Channel). Vom Terminal 2 wird zur Bestätigung wird ein entsprechendes Acknowledge-Signal gesendet, das vom Terminal 1 ebenfalls bestätigt wird. Daraufhin werden die Multimediadaten über RTP übermittelt. Ist die Übertragung beendet, wird vom Terminal 1 der Befehl zum Schließen des logischen Kanals (Close Logical Channel) und zum Beenden der Sitzung (End Session Command) gesendet. Es erfolgt eine Bestätigung mittels entsprechendem Acknowledge-Befehl. Vom Terminal 1 erfolgt dann die Meldung Release Complete zur Freigabe des logischem Kanals. Die Call Reference kann somit erneut verwendet werden. Über den RAS-Channel melden sich daraufhin beide Endgeräte wieder beim Gatekeeper ab (Disengage Request), der dies mit einer Confirm- Meldung bestätigt.55
Für Konferenzen laufen die Call Signalling Prozesse verändert ab. Für Centralized Multipoint Conferences werden die Signalisierungsinformationen von allen Terminals mit der MCU ausgetauscht. Der H.245-Kanal verläuft hier nicht von Terminal zu Terminal, sondern von den einzelnen Endpoints zur MC. Die Kanäle zum Datentransport verlaufen zwischen den Terminals und dem MP. In einer Decentralized Multipoint Conference werden die Kanäle für die H.245-Informationen ebenfalls zwischen den Terminals und dem MC transportiert, allerdings werden die Nutzdaten hier per Multicast zwischen den Terminals gesendet. Der weitere Ablauf ist analog zu einem einfachen Call.56
Während einer Verbindung können die Parameter des Calls über die Call Services geändert werden. Hierzu gehören Änderungen der Bandbreite oder der Teilnehmerzahl einer Konferenz oder aber auch ein Statusabfrage der Endpoints.
Die Bandbreite kann zu jedem Zeitpunkt der Verbindung erhöht werden. Dazu wird vom Terminal eine Bandwidth Request Message an den Gatekeeper geschickt. Der bestätigt (Confirm) oder verwirft (Reject) diese Anfrage. Während einer Verbindung wird vom Gatekeeper periodische der Status der beteiligten Terminals mit einer Status Enquiry Message abgefragt. Das Abfrageintervall ist vom Hersteller abhängig, sollte aber auf jeden Fall größer als zehn Sekunden sein.57
H.323 wird von den meisten Herstellern als das Protokoll angesehen, dass sich zukünftig durchsetzen wird. Es existieren darüber hinaus noch weitere Protokolle, die im folgenden erläutert werden sollen.
2.3 Alternative Protokolle
2.3.1 SIP
Auch andere Standardisierungsgremien als die ITU haben sich mit VoIP beschäftigt und dazu Übertragungsverfahren entwickelt. Die IETF hat das Session Initiation Protocol, kurz SIP, entwickelt, das in der einschlägigen Literatur als ernsthafte Konkurrenz zu H.323 gehandelt wird.58 Die wesentlichen Unterschiede sollen im folgenden kurz dargestellt werden. SIP ist ein einfacheres Protokoll, der Verbindungsaufbau ist textbasiert, ähnlich wie bei E-mail- oder HTTP-Diensten. Auch die Netzwerkadressen sind ähnlich den E-mail-Adressen aufgebaut59. Dieser Standard ist nicht nur auf Sprach- und Videoanwendungen ausgelegt, er unterstützt auch mobile Kommunikation, was zukünftig zu einem sehr wichtigen Faktor werden dürfte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 12: VoIP über SIP60
Bei SIP gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, an einer Multimedia-Session teilzunehmen:61 Die Sitzungen werden über verschiedene Medien wie E-mail, Webseiten, Newsgroups oder über sogenannte Multicast Advertisements über SAP62 bekanntgegeben. Im zweiten Fall werden die Teilnehmer von anderen eingeladen, an der Sitzung teilzunehmen. Das geschieht über das Session Initiation Protocol. Von beiden Protokollen wird das Session Description Protocol SDP zur Beschreibung der aktuellen Sitzung im Bezug auf Zeit, Multimediafähigkeit etc. benutzt.
SIP ist ein Client-Server-Protokoll, was im wesentlichen bedeutet, ein Client fordert einen Dienst an und diese Dienstanforderung wird von einem Server bearbeitet und der Dienst geliefert. Allerdings kann auf der Benutzerseite sowohl eine Dienstanforderung generiert als auch erhalten werden, das bedeutet, ein SIP-Endsystem beinhaltet immer einen Client (User Agent Client) und einen Server (User Agent Server).
Das Call Handling kann auf zwei unterschiedliche Arten geschehen, zum einem im Proxy Mode, zum anderen im Redirect Mode. In der ersten Variante fungiert der Proxy Server als Call Control, er erhält die Anfragen von den Endsystemen. Die Adressen werden dabei vom Location Server verwaltet. Im Redirect Mode erhält der SIP Server die Anforderung zum Lokalisieren eines gewünschten Gesprächspartners. Er leitet diese Anforderung jedoch nicht an den Gesuchten weiter, sondern sendet dessen Adresse an den Client, von dem die Anforderung kam.
Bei SIP gibt es nur zwei Message Typen, Request und Response. Die Anforderung enthält Methoden, die die geforderte Aktion kennzeichnen, die Antwort solche, die das Ergebnis der Anforderung beschreiben. Für den Request sind sechs Methoden definiert worden:63
- INVITE: Diese Methode lädt einen User zu einem Gespräch ein und baut eine neue Verbindung auf. Sie wird benutzt, um einen bestimmten Teilnehmer zu identifizieren und zu lokalisieren. Außerdem kann sie Anforderungen an die Verbindung enthalten.
- BYE: Hiermit wird die Verbindung zwischen zwei Teilnehmern beendet.
- OPTIONS: Hiermit werden Informationen über die benötigten Dienste oder Bandbreiten transportiert, die entweder direkt zwischen den Teilnehmern oder via SIP Server angewandt werden.
- ACK: Das ist der Acknowledge-Befehl zur Bestätigung oder Annahme einer Einladung.
- CANCEL: Diese Methode beendet die Suche nach einem Teilnehmer.
- REGISTER: Hiermit werden Informationen zum Aufenthaltsort der Teilnehmers zum SIP Server oder zum Location Server übermittelt.
Die Response Message hat eine ähnliche Struktur wie HTTP 1.0 und beinhaltet ebenfalls sechs Varianten:64
- 1xx: Request Received, die Anforderung wird weiter bearbeitet
- 2xx: Success, die Aktion wurde erfolgreich erhalten, verstanden und akzeptiert
- 3xx: Redirection, es sind weitere Aktionen für eine komplette Anforderung nötig
- 4xx: Client Error, Request enthält einen falschen Syntax oder kann vom Server nicht ausgeführt werden
- 5xx: Server Error, der Server war nicht in der Lage, den Request auszuführen.
- 6xx: Global Failure, der Request konnte auf keinem der Server ausgeführt werden
Die Teilnehmer werden über den SIP Uniform Ressource Locator (URL) adressiert, um SIP in den bereits vorhandenen Aufbau des Internets zu integrieren. Ein Domain Name Server (DNS) verbindet dann die Namen mit den IP-Adressen. Durch die Benennung der Endpoints wird jedoch eine hierarchische Struktur etabliert, durch die Schwierigkeiten z.B. beim LeastCost-Routing oder Usage-Based-Billing verursacht werden können.
Im folgenden soll nun ebenfalls der Verbindungsablauf für beide Modi kurz erläutert werden. Im Proxy Mode sendet der Teilnehmer 1 einen Verbindungswunsch (INVITE) an den entsprechenden Proxy. Dieser reicht die Anfrage nach dem Teilnehmer 2 an den Location Server weiter, der dessen Adresse an der Proxy zurückübermittelt. Von dort aus wird dann der Verbindungswunsch des Teilnehmers 1 an den zweiten Teilnehmer weitergeleitet. Der Teilnehmer 2 übermittelt dann mit dem Response Code 100 an den Proxy, dass er die Anforderung erhalten hat und weiter bearbeitet. Wenn der Verbindungsaufbau erfolgreich durchgeführt werden konnte, wird die Antwort Success übermittelt. Der Proxy leitet diese Antworten jeweils an den Teilnehmer 1 weiter. Dieser bestätigt den erfolgreichen Verbindungsaufbau dem Proxy gegenüber mit Acknowledge, was der Proxy wiederum an den Teilnehmer 2 weiterleitet. Ab diesem Zeitpunkt kann mit der Datenübermittlung begonnen werden.65 Im Bild 13 ist der Verbindungsaufbau im Proxy Mode zur grafischen Erläuterung dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 13: SIP - Verbindungsaufbau im Proxy Mode66
Im Redirect Mode wird die Verbindung ein wenig anders aufgebaut. Im Gegensatz zum Proxy Mode unterschiedet man hier 3 Sites voneinander, die beiden Teilnehmer (Site 1 und 3) und die Server (Site2). Der erste Teilnehmer (Endpoint1) sendet seinen Invite-Request an den Redirect-Server. Der fordert vom Location Server die Adresse des zweiten Teilnehmers an. Diese Adresse wird vom Redirect-Server an den ersten Teilnehmer übermittelt, der dies mit Acknowledge bestätigt. Danach sendet er seinen Verbindungswunsch direkt an den zweiten Teilnehmer, auch die folgenden Kommunikation findet lediglich zwischen den beiden Teilnehmern statt. Teilnehmer 2 bestätigt den Erhalt des Requests und sendet nach erfolgreichem Verbindungsaufbau eine Success-Meldung. Nach der Bestätigung von Teilnehmer 1 können die Daten übertragen werden. Auch diese Vorgänge werden mit einer Grafik verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 14: SIP - Verbindungsaufbau im Redirect Mode67
Bei SIP gibt es keinerlei Authentifizierungs-Prozeduren, wie etwa eine Status-Kontrolle durch die Server. Dies macht es sehr schwierig, bestimmte Dienste genau abzurechnen. Hier liegt eindeutig enormes Nachholpotential.68
Ein direkter Vergleich von H.323 und SIP ist nicht ganz einfach, da beide Protokolle völlig verschiedene Lösungen zu ein und demselben Problem darstellen. H.323 geht mehr vom traditionell leitungsvermittelten Netz aus, während SIP eine weniger komplizierte Lösung auf Basis von HTTP bietet. Es ist ein textbasiertes System, und daher viel einfacher zu codieren. Dafür bietet H.323 eine Vielfalt von Anruftypen (Call Cases), was theoretisch die Interoperabilität des Systems garantieren sollte und aufwendige Tests entfallen läßt. Man kann diesen Standard auch als Umbrella-Lösung bezeichnen, die viele Aspekte hinsichtlich Daten- Video- und Sprachkommunikation vereint. SIP betrachtet nur einige dieser Aspekte, ist aber ebenfalls in hohem Maße interoperabel, weil es sich hauptsächlich auf andere, bereits häufig eingesetzte Protokolle stützt.69 Die Einfachheit der Installation beruht auf diesem Bekanntheitsgrad und den komfortablen Design-Tools.
Im weiteren Vergleich kann man H.323 als ein Applikationsnetzwerk betrachten, das über ein Datennetz gelegt wurde, während SIP, das geschaffen wurde, um ins Internet zu integriert werden, mehr einen weiteren Dienst des Internets darstellt. Welches das jeweils richtige VoIP-Protokoll ist, hängt von den Leistungsansprüchen und der Art des Einsatzes ab. H.323 bietet weitere Kontrollmöglichkeiten, nicht nur im Bezug auf Authentizierung und Abrechnung, sondern auch hinsichtlich der Netzwerkarchitektur und Ressourcennutzung. SIP hingegen ist besser skalierbar, weil z.B. die SIP-Server mehr Call Setups bearbeiten können, weil sie nicht wie die H.323-Gatekeeper die Gesprächsstatus im System verfolgen. SIP ist in erster Linie sinnvoll, wenn es darum geht, alle Dienste eines Providers in ein System zu integrieren und es nicht auf die Abrechnung eines bestimmten Dienstes für einen Teilnehmer oder auf die Netzwerkkontrolle ankommt. SIP orientiert also mehr auf die Internet Service Provider, die bereits Webdienste anbieten. H.323 braucht keine vorhandene Basis, es entwickelt worden, um allein zu arbeiten. Es bietet daher eine ideale Lösung für Intranets und Corporate Networks, wo die Verbindung über Internet eine untergeordnete Rolle spielt. Man sollte SIP und H.323 nicht als konkurrierende Protokolle ansehen, sondern vielmehr als Lösungen für unterschiedliche Marktsegmente, die parallel eingesetzt werden und sogar über ein Border Gateway zusammenarbeiten können.
2.3.2 Tiphon
Tiphon ist kein weiterer Standard, sondern eher ein weiterer Architekturtyp, der allerdings auf H.323 beruht. Eigentlich wird so einen Arbeitsgruppe der ITU-T bezeichnet, die sich mit der Interoperabilität von Circuit Switched Networks und IP-Netzwerken beschäftigt. Diese Arbeitsgruppe beschrieb eine Reihe von technischen Problemen, die sich jedoch ausschließlich mit der Übertragung von Sprache befaßten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 15: Tiphon-Architektur70
Hierbei wurde das H.323-Gateway in drei funktionelle Einheiten unterteilt:
- Ein Signalisierungs-Gateway, das die Signalisierung zwischen IP und SCN-Netzen ermöglicht
- Ein Media Gateway, das die Datenströme verbindet und weiterleitet
- Einen Media Gateway Controller, der die H.323-Signalisierung übernimmt, der jedoch nur Kontrollfunktionalitäten für das Media Gateway erfüllt, er beinhaltet keine Call Control- Funktionalitäten
Das Tiphon-Modell ist in Grafik 15 dargestellt, in der Referenzpunkte bezeichnet sind. Die Punkte A bis C basieren auf dem Protokoll H.323, der Punkt D unterstützt darüber hinaus Funktionalitäten wie Call Signalling, Authentication und Accounting. Der Punkt N kennzeichnet die Verbindung zwischen Media Gateway und MGC . An diesem Punkt werden folgende Informationen ausgetauscht:
-Aufbau, Veränderung und Löschen von Datenverbindungen
-Spezifikationen von Medienformaten
-Einfügen von Tönen und Ansagen in die Datenströme
-Reporting von Eventanfragen innerhalb der Datenströme
Bezüglich der Abrechnung (Billing) bietet Tiphon gegenüber H.323 verbesserte Möglichkeiten, hierzu werden HTTP- oder XML-basierte Protokolle verwendet.
Insgesamt bietet Tiphon bei der Sprachübertragung über IP etwas erweiterte Möglichkeiten als H.323, baut jedoch grundsätzlich auf dieses System auf.
3 Praktische Umsetzung
3.1 Architektur von H.323-Netzwerken
Bereits im Kapitel 2.1 wurden die notwendigen Bestandteile eines Netzes erläutert, das nach dem Standard H.323 arbeitet. Die einzelnen Clients oder Endpoints sind mit einem Gatekeeper verbunden, der den Verbindungsaufbau überwacht und kontrolliert. Für den Aufbau und die Überwachung von Konferenzen ist zusätzlich eine Multipoint Control Unit notwendig. Über ein Gateway können Verbindungen von einem H.323-Netzwerk in das bestehende Telefonnetz durchgeschaltet werden, um mit Teilnehmer zu kommunizieren, die nicht mit VoIP arbeiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 16: Architektur eines H.323-Netzwerkes
Je mehr Gateways existieren, desto aufwendiger wird es, das richtige zu finden. Abhilfe soll hier das Gateway Location Protocol schaffen, das bereits in einigen Drafts existiert und den Austausch von Informationen zwischen den Gateways ermöglicht. Grundsätzlich funktioniert dieses Protokoll ähnlich wie die Routerprotokolle, dient also dazu, die Server innerhalb einer Domain auf dem aktuellen Stand zu halten.
Abhängig von der Anwendung und vom Hersteller können VoIP-Netzwerke ganz unterschiedlich aufgebaut sein. In den meisten Fällen sind sowohl zentralisierte als auch dezentralisierte Ansätze möglich. Bei den zentralisierten Systemen existiert eine Applikationsplattform, die sowohl mit dem IP-Netz als auch mit dem SCN verbunden ist.
Hier verwaltet der Server Nutzerinformationen und Nummernpläne, während das Gateway die Verbindung zu den klassischen Telefonnetzen darstellt. In dezentralisierten Aufbau ist an jedem Standort eine Serverplattform installiert. So kann die Flexibilität des Systems durch unterschiedlich Konfigurationen an den einzelnen Standorten erhöht werden.71 Die Server müssen daher ständig in Kontakt stehen, um Änderungen in den Datenbeständen oder Serverzustände miteinander abzugleichen. Die Gateways haben hier die Aufgabe, die Anrufe solange wie möglich im kostengünstigen IP-Netz zu halten und erst in der Zielregion ins klassische Netz zu wechseln.72
Durch die Vermischung von VoIP und Circuit Switched Networks entstehen verschiedene Varianten der IP-Telefonie:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 17: Varianten der IP-Telefonie73
Variante a) zeigt die Telefonie allein über den Computer (PC to PC). Diese Variante ist relativ einfach zu realisieren, sofern man nicht ins öffentliche Netz telefonieren möchte. Sie eignet sich aber für die Telefonie im LAN, in dem natürlich eine ausreichende Bandbreite zur Verfügung gestellt werden muss. Diese Bandbreite läßt sich jedoch planen, weil die Auslastung des eigenen Netzes bekannt ist. Der PC muss darüber hinaus über eine Soundkarte, ein Mikrophon und über die entsprechende Software verfügen. Das Wählen der Telefonnummer wird durch das Anklicken der IP-Adresse mit der Maus ersetzt. Die Varianten b) und c) stellen inhaltlich dasselbe dar: ein Teilnehmer telefoniert über ISDN, der andere über ein VoIP-Netz. Um diese Verbindung zu ermöglichen ist ein Gateway erforderlich, das die Adress- und Protokollumsetzung übernimmt.
In der letzten Variante verfügen beide Teilnehmer noch über eine ISDN-Strecke, die Kommunikation zwischen diesen beiden Strecken wird jedoch über ein VoIP-Netz abgewickelt. Hier sind jeweils zwischen den Netzübergängen Gateways notwendig.74 Grundsätzlich ist eine Unterscheidung in Voice over Intranet und Voice over Internet vorzunehmen. Die Quality of Service ist im Intranet weniger ein Problem, da hier, wie bereits oben beschrieben, das Netz und seine Bandbreite selbst überwacht werden kann. Im Internet ist eine Vereinheitlichung wesentlich schwerer möglich. Hier muss insbesondere auf die Kompatibilität der Software geachtet werden. Ein weiteres Problem stellen die ohnehin schon überlasteten Internetverbindungen dar. Eine Bandbreitenreservierung über RSVP dürfte aufgrund der Anzahl der beteiligten Unternehmen schwer bis gar nicht zu realisieren sein. Es müßten genaue Regeln formuliert werden, wer wann Bandbreite reservieren darf. Dies dürfte wohl zuletzt an den technischen Schwierigkeiten scheitern.75
3.2 Anwendungsmöglichkeiten
Angesichts der im Vorfeld geschilderten Schwierigkeiten von VoIP stellt sich die Frage nach geeigneten Anwendungsmöglichkeiten. Hier ist es selbstverständlich, dass VoIP Bewährtes abdecken muss. Darüber hinaus müssen aber auch neue Applikationen gefunden werden, die z.B. neue Märkte erschließen. Erst, wenn weitere überzeugende Möglichkeiten der Kommunikation gefunden wurden, wird sich VoIP durchsetzen können, da der Kostenfaktor, wie bereits erwähnt immer weiter an Bedeutung verliert.
Wie bereits erwähnt, hat sich VoIP hauptsächlich als Standard für Videokonferenzen entwickelt, wo auch ein Hauptanwendungsbereich zu sehen ist. Auf die einzelnen Arten von Konferenzen wurde dabei bereits in vorangegangenen Kapiteln eingegangen.
Ein breites Anwendungsspektrum wird im Bereich E-Commerce und Kundenservice über IP gesehen.76 Hier soll ein bessere Kundendienst bei Online-Angeboten erreicht werden, da Internet-Anfragen gleich mündlich bearbeitet werden können. Der Kunde kann über einen Call me-Button auf der Webseite in direkten Kontakt mit dem Call Center treten, sofern sein PC entsprechend ausgerüstet ist. Beim Betätigen des Buttons kann so z.B. über die bestehende Internetverbindung die entsprechende Software per Java Applet auf den Client heruntergeladen werden. So kann der Kunde ohne Kompatibilitätsprobleme eine Verbindung zum Call Center aufbauen. Außerdem ist die Telefonieapplikation durch die Realisierung per Java Applet unabhängig von der Client-Konfiguration.
Ein weiteres Anwendungsszenario stellt die Anbindung abgesetzter Unternehmensstandorte dar.77 Bei größeren abgesetzten Standorten bietet VoIP ein kostengünstige Alternative zu Multiservice-Backbone-Lösungen bei der Integration von Sprache und Daten. Hiermit wird eine effizientere Ausnutzung der zumeist gemieteten Bandbreite erreicht. Dabei werden die IP-Gateways als Schnittstelle zwischen dem TK-System und dem LAN eingesetzt. In einem nächsten Schritt können die Gateways dann in das TK-System integriert werden. Eine Least- Cost-Routing-Funktion stellt sicher, dass Gespräche im Normalfall über das IP-Netz geführt werden, nur bei Überlastung wird auf gebührenpflichtige öffentliche Netze ausgewichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 18: Zweigstellenlösung mit VoIP
Auch bei kleineren abgesetzten Standorten können VoIP-Lösungen durchaus sinnvoll sein. Hier muss nur noch eine Infrastruktur installiert werden, die außerdem auf standardisierten Plattformen aufbaut. So kann auch für kleinere Standorte eine wirtschaftliche Lösung geschaffen werden. Bisher ist hier jedoch die geringe Anzahl von Telefoniemerkmalen, die VoIP bisher unterstützt noch als Nachteil aufzuführen. Dies gilt ebenso für die geringere Ausfallsicherheit serverbasierter TK-Systeme gegenüber den bisherigen Plattformen.78 Aus Gründen, die hier nicht näher diskutiert werden sollen, erfreuen sich auch Heimarbeitsplätze (SOHO) immer größerer Beliebtheit. Sie unterliegen ebenfalls den Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und funktioneller Einbindung. Auch hier kann VoIP gute Einsatzmöglichkeiten bieten. Es werden sowohl Sprache als auch die Signalisierungsinformationen vom unternehmensinternen TK-System über das IP-Protokoll übertragen. Auf eine separate Verkabelungsinfrastruktur kann somit verzichtet werden. So entsteht aus der Sicht des TK-Systems kein Unterschied zwischen einem Teilnehmer im Unternehmen und z.B. einem Call-Center-Agenten, der zu Hause arbeitet.79
Für den Privatkundenmarkt werden VoIP-Lösungen derzeit schon von vielen Providern, z.B. Web.de geboten. Hier kann, sofern der PC entsprechend ausgerüstet ist, ein Verbindung zu einem anderen Teilnehmer aufgebaut werden. Da jedoch die meisten Hersteller nur über Verzeichnisse ihrer eigenen Kunden verfügen, gestaltet sich die Suche nach dem gewünschten Teilnehmer oft schwierig. Da die Wahl über IP-Adressen erfolgt, wird die Suche bei einer dynamischen Zuweisung derselben noch schwieriger. Die IETF will hier jedoch Abhilfe schaffen, indem zukünftig LDAP als Verzeichnisdienst genutzt werden soll. Bisher läßt bei solchen Verbindungen allerdings die Sprachqualität noch sehr zu wünschen übrig. Ein weiteres Problem bei der Kommunikation über de PC ist die Tatsache, dass PCs nicht immer online sind, im Gegensatz zum herkömmlichen Telefon sind somit Einschränkungen bei der Erreichbarkeit gegeben.
Nicht zu vernachlässigen sind die Vereinfachungen bei Umzügen von Unternehmen. Bisher konnte die Rufnummer nur im Rahmen des Ortsnetzes beibehalten werden. Außerdem war auch bei einem Umzug eines Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens ein gewisser programmiertechnischer Aufwand notwendig. Bei der Vernetzung über IP meldet sich der Nutzer nur wieder an dem entsprechenden Server an und kann wie gewohnt, Anrufe entgegennehmen.80 IP-Telefonanlagen können eine Reihe von speziellen Funktionen bieten, die auf bisherigen Nebenstellenanlagen unmöglich sind: Es können Tages- und Wochenprofile für die Steuerung von eingehenden Rufen verwendet werden, die sich zum Beispiel auf den individuellen Outlook-Terminkalender stützen.
Sobald sich der Nutzer an einem anderen Ort auf dem Server einloggt, können alle Anrufe auf das entsprechende Telefon weitergeleitet werden.
Dies sind nur zwei Beispiele, was solche Plattformen durch die Integration verschiedenster Datenbestände zu leisten vermögen. Im Gegensatz zu bisherigen Systemtelefonen, deren benutzerdefinierte Programmierung häufig der Hilfe eines Systemtechnikers bedarf, können die Oberflächen der Software-Clients individuell gestaltet werden. Der Nutzer kann so viele Zielwahlbutton anlegen, wie er benötigt und auf einfache Weise konfigurieren. VoIP sorgt somit für die Migration des Telefons zur Nachrichtenzentrale.81
3.3 Der Markt für VoIP
Mittlerweile hat jedes Unternehmen, das am IT-Markt bestehen will, Entwicklungen hinsichtlich VoIP in Gang gebracht. Die Netzanbieter erweitern ihre Infrastruktur, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen durch die IP-Telefonie gewachsen zu sein. Namhafte TK- Anbieter, wie Siemens, Ericsson oder Motorola entwickeln Plattformen und Endgeräte, die VoIP unterstützen. Ein Berliner Netzbetreiber will sein Netz bereits ausschließlich über IP aufbauen.
Es vergeht kein Tag, in dem nicht in einschlägigen Zeitschriften über dieses Thema und die neuesten Entwicklungen berichtet wird. Kein Unternehmen kann sich dieser Entwicklung entziehen, wenn es auch zukünftig am Markt Bestand haben will.
Zwar existiert momentan eine erhitzte Diskussion zwischen jenen, die VoIP bevorzugen und jenen, die die Zukunft in ATM sehen. ATM bietet hinsichtlich Quality of Services eine wesentliche bessere Ausgangsbasis als VoIP, wird aber von Kritikern wegen seiner Komplexität und den damit verbundenen hohen Kosten abgelehnt. Befürworter führen an, dass im Gegensatz zu den IP-Netzen ATM-Systeme eine Interoperabilität zwischen Komponenten verschiedener Hersteller ermöglichen. Auch sind Abrechnungsmodalitäten (Billing und Accounting) wesentlich einfacher zu handhaben.82 Da beide Techniken sowohl vor und Nachteile aufweisen, die die jeweils andere Technik kompensiert, gehen Experten von einer Koexistenz beider Varianten aus. Dies wird als Multiprotocol Label Switching (MPLS) bezeichnet. Die Interoperabilität soll über Open Call Control Layer sichergestellt werden. Detken geht davon aus, dass sich mittelfristig auf zwei Techniken konzentriert wird:
- Dense Wavelength Division Multiplex (DWDM) als Transportschicht mit IP bzw. STM als Grundlage von MPLS als Service-Layer und
- Eine Koexistenz von ATM, LAN-Emulation, Multiprotocol over ATM sowie GigabitEthernet mit Layer-3-Switching in Campus-Netzen83
Der Markt für VoIP ist da. Das Durchsetzungsvermögen dieser Technologie wird jedoch hauptsächlich von den Applikationen und der Ausfallsicherheit der Systeme abhängen.
Trotzdem rechnet man bereits im Jahr 2004 mit einem Weltmarktvolumen von 5,3 Milliarden US-Dollar. Außerdem wird erwartet, dass sich die Zahl der integrierten Sprach-/Datensysteme auf IP-Basis von gegenwärtig 20 Millionen bis 2003 weltweit verdoppeln wird. Dies führt dazu, dass der Bedarf an IP-Bandbreite stetig steigt. Für das Jahr 2005 rechnet man allein für die westlichen Staaten mit einem Bedarf von 51 Terrabit/s. Das ist annähernd das Fünffache des bisherigen Wertes.84
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 19: Marktvolumen für sprachgestützte Web-Services85 wächst bis 2004 auf 16 Mrd. US-Dollar
Die meisten Marktforschungsinstitute bescheinigen Voice-over-Paket-Diensten ein rasantes Wachstum. Frost & Sullivan geht davon aus, dass das Geschäftsvolumen für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika von 131 Millionen US-Dollar im Jahr 1999 auf 55,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2005 anwachsen wird.86
4 Ausblick
Auch wenn gegenwärtig VoIP noch zögerlich akzeptiert wird und es bisher erst eine kleine Reihe von Investitionsprojekten in diese Technologie gibt, so wird sie sich sicherlich durchsetzen. Standardisierungsgremien arbeiten an Lösungen, die die Integration von Basic Services wie gebührenfreie Nummern, Notruf etc. vereinfachen und die Sprachqualität verbessern sollen. Wichtig wird vor allem ein einheitliches Protokoll sein, um die Interoperabilität der einzelnen Netze zu sichern.
Neue Services, wie etwa die Integration von Sprache und Internet, also das Surfen im Internet via Sprachsteuerung läßt völlig neue Möglichkeiten der Interaktion von Nutzer und PC zu. Während VoIP in großen Konzernen durchaus zumindest Einzug in die Planung hält und viele Unternehmen auch gewillt sind, solche Systeme in naher Zukunft zu installieren, hinkt der mittelständische Markt diesem Trend noch hinterher. Selbst heute bereits einfach verfügbare IuK-Technologie wird hier nur langsam akzeptiert. Auch das Internet konnte sich in diesem Bereich noch nicht vollständig durchsetzen. Letztlich werden aber fallende Preise und der zunehmende Wettbewerbsdruck auch für den Einzug neuer Möglichkeiten, die VoIP mit sich bringt, sorgen.87
Das Fazit, dass sich in den meisten Fachartikeln finden läßt, ist eindeutig. Trotz der Skepsis, die viele Experten VoIP momentan noch entgegenbringen, wird allgemein davon ausgegangen, dass IP-basierten Netzen die Zukunft gehört und sich die Unternehmenskommunikation damit grundlegend ändern wird. Bis dahin werden IP-Netze die klassischen TK-Anlagen ergänzen.
5 Literaturverzeichnis
Anton, Karin: Kursunterlagen Voice over IP - Echtzeitdaten in Paketnetzen, Juni 2000 Arnoldt, Frank : Integratives Modell: IP-basierende Unternehmenskommunikation; in NetworkWorld 16/17, 11.August 2000, S. 26
Bause, Jan: VoIP: Echter Trend oder nur Publicity ?, in : DATACOM 9/99, S. 4-5
Bergmann, F., Gerhardt, H-J.: Taschenbuch der Telekommunikation, Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 1999
Brockhaus, Wolfgang: Sprache - die schönste Nebensache der Welt, in: DATACOM 11/9, S. 36-39
Computerwoche Verlag GmbH: Online-Lexikon der NetworkWorld: http://www.networkworld.de
Detken, Kai-Oliver: IP ist Hype, in: NetworkWorld 4/1999, 26.11.99
Detken, Kai-Oliver; Reder Bernd: Sprache häppchenweise; in: NetworkWorld 13/2000, 30.06.2000, S. 48-49
Dr. Stefan Satteler, CERTUS CONSULTING GOUP: Datenkommunikation und Voice over IP, Tutorial Ericsson "Datacom IP Launch Day" , 11.November 1998
Ebbinghaus, Dr. Ralf: Aller guten Dinge sind drei: Leitfaden IP-Telefonie Teil 2; in : NetworkWorld 20/2000, 06. Oktober 2000, S. 32-33
Ebbinghaus, Dr. Ralf: Zwei Welten wachsen zusammen: Leitfaden IP-Telefonie Teil 1; in : NetworkWorld 19/2000, 22.September 2000, S. 44-46
E-Online Kommunikationstechnik: Internet-Telefonie, http://www.e- online.de/sites/kom/0307041.htm
Ericsson GmbH: Seminarunterlagen Voice over IP, IP- beyond, 1999
Eriksson, G., Olin, B., Svanbro, K., Turina, D.: The challenges of voice-over-IP-over- wireless, in: Ericsson Review 1/2000, S. 20-31
Erler, J., Maass, T., Piske, T.: Whitepaper: Multiservice-Netzwerke - Voice over IP, Ericsson Business Networks GmbH 2000
Jockel, J., Matern, C. (u.a.): Corporate Networks: Voice over IP - Perspektiven; ZVEI Whitepaper 2000
Kafka, Gerhard: Zwischen den Welten, in: NetworkWorld 13/2000, 30.06.2000, S. 48-49 Kellerhoff, Cornelius: Die IP-Kommunikation setzt zum Überholen an, in: DATACOM 10/99, S. 14-16
Kissinger, Dirk: Auf die Komplettlösung kommt es an: Nur VoIP hilft den Unternehmen nicht weiter, in: DATACOM 6/2000, S. 52-53
Lundqvist, J., Svensson, B.: Messaging over IP - A network for messaging and information services, in: Ericsson Review 3/99 S. 142-147
Müller, Wolfgang: Status zu VoIP - Quality of Service als Knackpunkt, in: DATACOM 8/2000, S. 50-62
Munch, Bjarne: IP Telephony Signalling, Ericsson Inc. Australia, 8/99 Quellenverzeichnis
RadCom Academy: Voice over IP Technology Protocol Reference, http://www.protocols.com
Riedel, Petra: Das LAN wird zum Universalnetz, in NetworkWorld 3/2000 04.02.2000, S. 37
Riedel, Petra: Der Internet-Telefonie steht ein dynamisches Wachstum bevor, in NetworkWorld 3/2000 04.02.2000, S. 16
Schamal, Franz Xaver: IP-Telefonie in Business-Class-Qualität; Verstärktes Engagement von EBN in Richtung Konvergenz, in: DATACOM 9/2000, S. 76
Scharf, Achim: Getrennt packen, gemeinsam schicken in: NetworkWorld 8/2000, 20. 04.2000, S. 33-34
Shugart, T.: Whitepaper: Voice over IP Networks, http://www.analogic.com
Unbekannt: VoIP-Status in den USA, in DATACOM 10/99, S. 18-21
Van Maele, Jürgen: Voice over IP - Seminarunterlagen, Ericsson Competence Center Europe, September 2000
6 Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit an Eides statt, vorliegende Seminararbeit selbstständig und ohne Zuhilfenahme unzulässiger Hilfsmittel angefertigt zu haben. Wörtlich oder dem Sinn nach übernommene Ausführungen sind so gekennzeichnet, dass Missverständnisse über die geistige Urheberschaft ausgeschlossen sind.
7 Stichwortverzeichnis
A
Anbindung abgesetzter Unternehmensstandorte, 33
Anwendungsmöglichkeiten, 32
Architektur von H.323-Netzwerken, 30
ATM, 35
Ausblick, 37
B
Bandbreitenreservierung, 11
C
Call me-Button, 32
Centralized Multipoint Conferences, 21
comfort noise, 19
D
Decentralized Multipoint Conference, 21
dezentralisierte VoIP-Netze, 30
E
Echtzeitanwendung, 10
E-Commerce, 32
G
G.711, 17
G.721, 18
Gatekeeper, 15
Gateway, 15
Gateway Location Protocol, 30
Gesprächsverlauf, 19
H
H.225, 17
H.235, 18
H.245, 17
H.246, 18
H.26x, 17
H.323, 14
H.323 Netzbestandteile, 14
H.323 Subprotokolle, 17
H.323, Entwicklung, 14
H.323-Konferenz, 16
H.450, 18
Heimarbeitsplätze, 33
I
IP-Pakete, Aufbau, 9
IP-Protokoll, 8
Ipv6, 9
J
Jitter, 12
Jitter-Buffer, 13
K
Klassische Sprachübertragung, 5
Kommunikationsablauf über H.323, 18
Konferenzen, 21
Konvergenz, 6
Kosten, 7
L
Laufzeit, 11
M
Markt für VoIP, 35
Mehrpunkt-Verbindung, 15
mittelständischer Markt, 37
Multipoint Control Unit, 15
O
Overhead, 18
P
Paketverluste, 13
PCM, 5
Privatkunden, 34
Protokolle und Verfahren, 14
Q
Q.931, 17
QoS, 9
Quality of Service, 32
Quality of Services, 10
R
RAS, 17
Real Time Transport Control Protocol, 11
Real Time Transport Protocol, 11
Real Time Transport Streaming Protocol, 11
Redirect Mode, 23
Ressource Reservation Protocol, 11
Routing, 10
S
Schwachstellen, 8
Session Description Protocol, 23
Session Initiation Protocol, 23
SIP, 22
Message Typen, 24
Methoden, 24
Response Message, 24
Verbindungsablauf, 25
SIP Proxy Mode, 23
Software-Clients, 35
Sprachqualität, 10, 11
T
TCP, 9, 10
Tiphon, 27
Tiphon-Architektur, 28
U
UDP, 9, 10
V
Varianten der IP-Telefonie, 31
Verbindungsablauf
Proxy Mode, 25
Redirect Mode, 26
Verbindungsaufbau, 19
Vergleich von H.323 und SIP, 26
Voice Activity Detection, 19
Voice over Internet, 32
Voice over Intranet, 32
Vorteile von VoIP, 8
W
Weltmarktvolumen, 36
Z
zentralisierte VoIP-Netze, 30
Zusatzdienste, 18
[...]
1 Anton 2000
2 Anton 2000
3 Bergmann, Gerhardt 1999
4 Anton 2000
5 Anton 2000
6 Ericsson 2000
7 van Maele 2000
8 Anton 2000
9 Jockel/Matern 2000
10 Erler, Maas, Piske 2000
11 van Maele 2000
12 Anton 2000
13 van Maele 2000
14 Networkworld-Lexikon 2000
15 Mobilfunknetze, ÖffentlicheNetze, VPN oder Enterprise Networks
16 Anton 2000
17 Anton 2000
18 Anton 2000
19 Computerwoche Verlag 2000
20 Anton 2000
21 Computerwoche Verlag 2000
22 Anton 2000
23 Anton 2000
24 Computerwoche Verlag 2000
25 Jockel/Matern 2000, S. 14
26 Jockel/Matern 2000, S.14
27 Anton 2000, S. 5-11
28 RadCom Academy 2000
29 RadCom Academy 2000
30 Jockel/Matern 2000
31 RadCom Academy 2000
32 E-Online 2000
33 Anton 2000
34 Van Maele 2000
35 Van Maele 2000
36 Van Maele 2000
37 Anton 2000
38 Anton 2000
39 Erler, Maas, Piske 2000
40 Anton 2000
41 Anton 2000
42 Anton 2000
43 Anton 2000
44 Computerwoche Verlag 2000
45 Van Maele 2000
46 Van Maele 2000
47 Van Maele 2000
48 Anton 2000
49 Munch 1999
50 Jockel/Matern 2000
51 Anton 2000
52 Anton 2000
53 RadCom Academy 2000
54 Master-Slave-System
55 RadCom Acedemy
56 Anton 2000
57 Anton 2000
58 Van Maele 2000
59 user@domain oder user@IP-Adress
60 Van Maele 2000
61 Munch 1999
62 Session Announcement Protocol
63 Munch 1999
64 Munch 1999
65 RadCom Academy 2000
66 RadCom Academy 2000
67 Radcom Academy 2000
68 Munch 1999
69 Munch 1999
70 Munch 1999
71 Arnoldt 2000
72 Ebbinghaus 2000 (2)
73 Kellerhoff 1999
74 Anton 2000
75 Anton 2000
76 Maas 2000
77 Erler, Maas, Piske 2000
78 Erler, Maas, Piske 2000
79 Erler, Maas, Piske 2000
80 Jockel, Matern 2000
81 Ebbinghaus 2000 (2)
82 Detken 1999
83 Detken 1999
84 Ebbinghaus 2000
85 Darunter versteht man Dienste, die mit Hilfe von Sprachsteuerungen Internet-Dienste abrufen
86 Ebbinghaus 2000 (2)
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument behandelt Voice over IP (VoIP), untersucht dessen Grundlagen, Protokolle, praktische Umsetzung, Anwendungsbereiche und Marktentwicklung.
Welche klassischen Sprachübertragungstechnologien werden erwähnt?
Das Dokument geht auf klassische Sprachnetze ein, die hauptsächlich digital sind, wobei Teilnehmerzugänge häufig noch analog sind. Es werden Festnetze, Virtual Private Networks und Enterprise Networks erwähnt.
Welche Vorteile und Probleme werden im Zusammenhang mit der Konvergenz von Sprach- und Datennetzen diskutiert?
Die Vorteile umfassen eine einheitliche Infrastruktur, Kosteneinsparungen und die Möglichkeit neuer Anwendungen. Als Probleme werden die Robustheit der klassischen Netze, mangelnde Interoperabilität und Schwierigkeiten bei der Abrechnung genannt.
Was ist das IP-Protokoll und wie funktioniert es im Kontext von VoIP?
Das IP-Protokoll ist die Grundlage für VoIP, wobei Datenpakete von Routern weitergeleitet werden. Es bietet keine garantierte Antwortzeit oder Datensicherheit auf Netzwerkebene, was zusätzliche Mechanismen erfordert.
Was sind Quality of Services (QoS) und warum sind sie für VoIP wichtig?
QoS bezieht sich auf die Anforderungen an ein Sprachnetz, wie Echtzeitverhalten, minimale Verzögerungszeiten und korrekte Paketreihenfolge. Zusätzliche Mechanismen sind erforderlich, um diese Dienstgüte zu gewährleisten.
Welche Protokolle und Verfahren werden für VoIP behandelt?
Das Dokument konzentriert sich hauptsächlich auf H.323 und dessen Subprotokolle, erwähnt aber auch alternative Protokolle wie SIP und Tiphon.
Was ist H.323 und welche Komponenten und Subprotokolle sind damit verbunden?
H.323 ist eine Sammlung von Standards für Multimedia-Konferenzen im LAN, die Verbindung, Codierung, Sicherheit und Zusatzdienste regeln. Zu den Komponenten gehören Terminals, Gateways, Gatekeeper und MCUs (Multipoint Control Units). Zu den Subprotokollen gehören RAS, Q.931 und H.245.
Wie funktioniert die Übertragung und der Kommunikationsablauf über H.323?
H.323 verwendet sowohl gesicherte (TCP) als auch ungesicherte (UDP) Kanäle zur Kommunikation. Der Verbindungsaufbau umfasst mehrere Schritte, einschließlich Anfragen beim Gatekeeper, Signalisierung und Aushandlung von Parametern.
Was ist SIP und wie unterscheidet es sich von H.323?
SIP (Session Initiation Protocol) ist ein alternatives Protokoll, das einfacher und textbasiert ist. Es ist auf Sprach- und Videoanwendungen sowie mobile Kommunikation ausgelegt.
Was ist Tiphon und wie hängt es mit H.323 zusammen?
Tiphon ist kein weiterer Standard, sondern ein Architekturtyp, der auf H.323 beruht. Es unterteilt das H.323-Gateway in drei funktionelle Einheiten: Signalisierungs-Gateway, Media Gateway und Media Gateway Controller.
Wie sieht die praktische Umsetzung von H.323-Netzwerken aus?
H.323-Netzwerke bestehen aus Clients/Endpoints, die mit einem Gatekeeper verbunden sind. Für Konferenzen ist eine MCU erforderlich. Über ein Gateway können Verbindungen zum bestehenden Telefonnetz hergestellt werden.
Welche Anwendungsmöglichkeiten für VoIP werden erwähnt?
Zu den Anwendungsmöglichkeiten gehören Videokonferenzen, E-Commerce, Kundenservice, Anbindung abgesetzter Unternehmensstandorte und Heimarbeitsplätze.
Wie sieht der Markt für VoIP aus?
Der Markt für VoIP wächst rasant, mit einer steigenden Anzahl von Unternehmen, die Entwicklungen in diesem Bereich vorantreiben. Es wird erwartet, dass der Markt in den kommenden Jahren erheblich wachsen wird.
Welchen Ausblick gibt das Dokument für die Zukunft von VoIP?
Es wird erwartet, dass sich VoIP durchsetzen wird, wobei Standardisierungsgremien an Lösungen arbeiten, um die Integration von Diensten und die Sprachqualität zu verbessern. Neue Services und fallende Preise werden voraussichtlich die Akzeptanz fördern.
- Quote paper
- Anja Michel (Author), 2001, Voice over IP. Ausarbeitung über die Notwendigkeit der Suche nach alternativen Möglichkeiten der Übertragung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101632