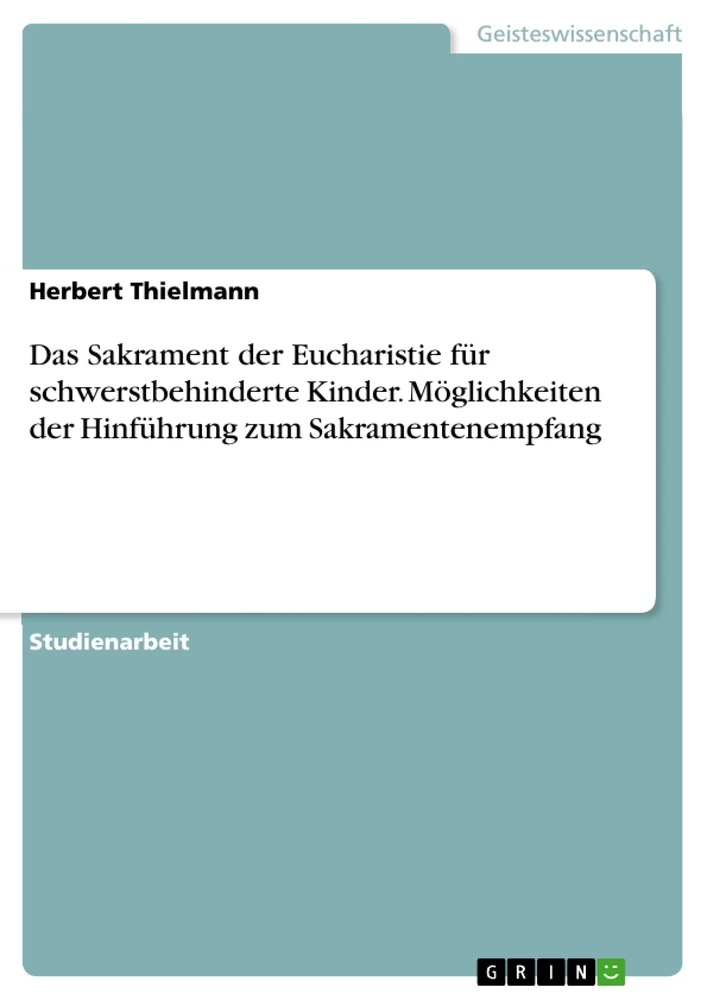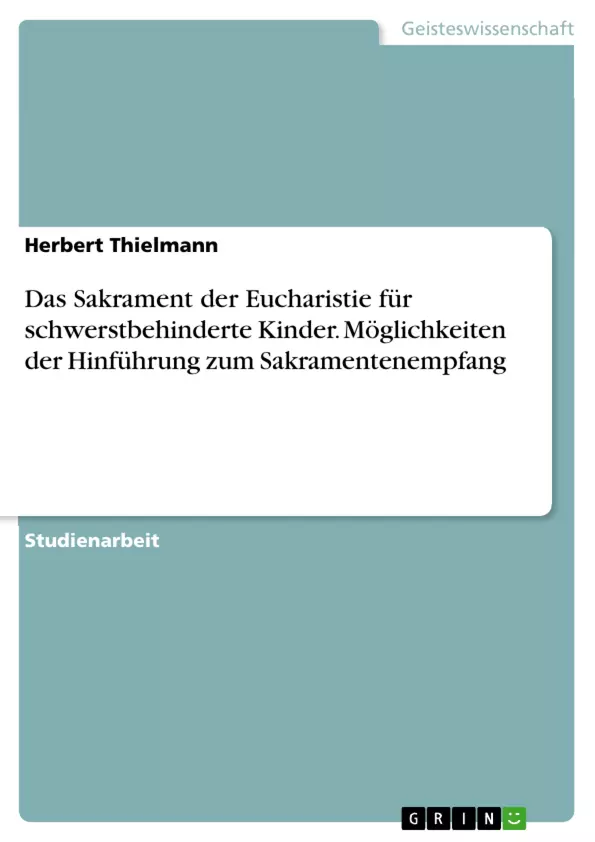Stell dir vor, die strahlenden Augen eines Kindes, das die Welt auf einzigartige Weise erlebt. Kann die heilige Kommunion wirklich für Kinder mit schwersten Behinderungen zugänglich sein? Diese tiefgründige Auseinandersetzung wagt es, diese Frage nicht nur zu stellen, sondern sie mit Herz und Verstand zu beantworten. Entdecke einen ergreifenden Weg, wie gerade Kinder, die oft am Rande der Gesellschaft stehen, die unendliche Liebe Gottes erfahren können. Die Reise beginnt mit einer einfühlsamen Betrachtung der Eucharistie als Zeichen der Realpräsenz Jesu, gefolgt von einer bewegenden Erkundung der individuellen Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse schwerstbehinderter Kinder. Anhand von praxisnahen Beispielen, methodischen Hinweisen und berührenden Erfahrungen wird ein umfassendes Konzept zur Vorbereitung und Durchführung der Ersten Heiligen Kommunion vorgestellt. Erfahren Sie, wie durch den Einsatz von Symbolen, Ritualen und einer achtsamen Begleitung eine Brücke zu einer tieferen spirituellen Erfahrung gebaut werden kann. Von der Gestaltung kindgerechter Gottesdienste bis hin zur Einbeziehung der Familie und der Gemeinde – dieses Buch bietet wertvolle Impulse für alle, die sich für Inklusion, Religionspädagogik und die spirituelle Begleitung von Menschen mit Behinderungen engagieren. Lassen Sie sich von den bewegenden Geschichten der Kinder Kristof, Christian, Sebastian, Marco, Sandra, Daniel, Ema, Katrin und Kay-Uwe inspirieren und entdecken Sie, wie die Feier der Eucharistie zu einem unvergesslichen Fest der Begegnung und der göttlichen Liebe werden kann. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Glaube keine Grenzen kennt und die Botschaft der Nächstenliebe in ihrer reinsten Form erfahrbar wird. Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine inklusive Kirche, die jedem Menschen, unabhängig von seinen Fähigkeiten, die Teilhabe an den Sakramenten ermöglicht und die Würde jedes Einzelnen achtet. Es ist eine Einladung, Vorurteile abzubauen, neue Perspektiven zu gewinnen und die unendliche Weite der göttlichen Barmherzigkeit zu entdecken.
Gliederung
1. Einleitung
2. Eucharistie - Zeichen der Realpräsenz Jesu
3. Eucharistie für schwerstbehinderte Kinder?
4. Durchführung
4.1. Zur Zielgruppe
4.1.1 Definition
4.1.2 Individuelle Lernvoraussetzungen
4.2. Die Vorbereitung
4.2.1. Ich bin das Licht der Welt
4.2.2. Ich entdecke die Kirche
4.2.3. Ich bin
4.2.4. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft in der Kommuniongruppe
4.2.5. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft mit Jesus
4.2.6. Wasser ist Leben
4.2.7. Ich habe einen Namen und ich bin getauft
4.2.8. Ich entdecke die Kirche (Teil 2)
4.2.9. Ich entdecke die Kirche (Teil 3)
4.2.10. Wir feiern ein Fest
4.3. Die Feier der Ersten Heiligen Kommunion
5. Nachbetrachtung
6. Literaturangaben
7. Anhang
1. Einleitung
„Der Religionsunterricht soll, darf und kann vermitteln, was zentraler Inhalt der christlichen Botschaft ist: dass nämlich jeder Mensch, ob stark oder schwach, arm oder reich, alt oder jung, einen einzigartigen und unverwechselbaren Wert besitzt.“ ( Hemel, Ulrich, DDr. In: unterwegs, Deutscher Katechetenverein, Nr. 4, 2000) Immer wieder werde ich als Religionslehrer schwerstbehinderter Kinder von deren Eltern darauf angesprochen, ob es nicht möglich sei, innerhalb des Religionsunterrichts die Kinder auf den Empfang der Ersten Heiligen Kommunion vorzubereiten. Eltern machen häufig die Erfahrung, dass eine Vorbereitung innerhalb der Gemeinden an den Bedürfnissen der Kinder vorbeigeht, diese mehr oder weniger nur geduldet, oder im Extremfall sogar von diesem Sakrament ausgeschlossen werden. Obwohl ich der Meinung bin, dass der Ort des Empfangs der ersten Heiligen Kommunion die Heimatgemeinde der Kinder sein soll, konnte ich den Wunsch dieser Eltern nachvollziehen und begann mich mit diesem Gedanken auseinanderzusetzen.
Sakramente sind Zeichen der Liebe Gottes an uns Menschen, Zeichen seiner allumfassenden Liebe. Warum sollten also Kinder, die wegen der Schwere ihrer Behinderung in besonderer Weise auf die Zuwendung anderer Menschen angewiesen sind, vom Sakrament der Eucharistie ausgeschlossen werden?
In der vorliegenden Hausarbeit werde ich begründen, warum gerade die Feier der Ersten Heiligen Kommunion für diesen Personenkreis angeboten werden muss und zusätzlich die Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion und die Durchführung der Feier beschreiben.
Danken möchte ich an dieser Stelle den Kindern Kristof, Christian, Sebastian, Marco, Sandra, Daniel, Ema, Katrin und Kay-Uwe. Bei der Vorbereitung und Feier ihrer Ersten Heiligen Kommunion ist mir die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in besonderer Weise nahe gebracht worden.
2. Eucharistie - Zeichen der Realpräsenz Jesu
„(...) bringen wir die Wahrheit der kirchlichen Sakramente für die leichtere Unterrichtung sowohl der jetzigen als auch der künftigen Armenier selbst auf folgende knappste Formel. Es gibt sieben Sakramente des Neuen Bundes, (...), die sich sehr von den Sakramenten des Alten Bundes unterscheiden. Diese nämlich bewirken die Gnade nicht, sondern zeigen nur an, daß sie durch das Leiden Christi gegeben werde sollte; diese unsrigen aber enthalten die Gnade und verleihen sie denen, die sie würdig empfangen.“ (DH 1310)
In diesem Text aus dem Jahre 1439 wird schon deutlich, Sakramente sind Gnadenbeweise Gottes an uns Menschen.
Von den insgesamt sieben Sakramenten der Kirche, sind die der Taufe, der Firmung und der Eucharistie die sogenannten Initiationssakramente. Der Eucharistie kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil sie „Quelle und Höhepunkt des Lebens unsere Kirche und jeder Gemeinde ist. Sie ist das große Vermächtnis des Herrn, das er uns am Abend vor seinem Leiden und Sterben hinterlassen hat. Sie ist das Kostbarste, was wir als Kirche haben.“ (Kasper, Walter, Bischof von RottenburgStuttgart: Die Feier der Eucharistie, KABI 9, Bd. 45)
Im Johannesevangelium heißt es: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“(Joh1,14). Gott hat seinen Sohn Mensch werden lassen und hat somit
Teilhabe am menschlichen Leben. Gott wurde durch die Menschwerdung seines Sohnes selbst Mensch, er wurde berührbar, so wie er Menschen berührte. Wenn Sakramente Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen sind, so ist Jesus durch seine Geburt, vor allem aber durch Tod und Auferstehung zum ‚Ursakrament‘ geworden, zum größten und wirksamsten Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen. In der Eucharistie nimmt der gläubige Christ Anteil an Christi Tod und Auferstehung.
„In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, „vollzieht sich“ „das Werk unserer Erlösung“, und so trägt sie im höchsten Maße dazu bei, daß das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird(..)“ (SC2)
3. Eucharistie für schwerstbehinderte Kinder?
Als die Anfrage an mich herangetragen wurde schwerstbehinderte Kinder auf die Erste Heilige Kommunion vorzubereiten, musste ich mich intensiv mit der Frage, ob diese Kinder überhaupt fähig sind, an der Eucharistie teilzunehmen, beschäftigen. Erfordert sie nicht ein gewisses Maß an sakramentalem Verständnis, was bei diesen Kindern nicht unbedingt vorausgesetzt werden kann?
Wie muss die Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion bei einem Personenkreis, wo das Wort nicht unbedingt aufgenommen und verstanden werden kann, aussehen?
„Gott ist Liebe“(1Joh4,8) Dieser Spitzensatz des Neuen Testaments führte mich schließlich zu der Erkenntnis, dass gerade die Eucharistie das Sakrament ist, das schwerstbehinderten Menschen nicht verwehrt werden darf, weil sich in ihr die göttliche Heilswirkung in besonderer Weise zeigt.
Beziehungen von Menschen untereinander leben durch Worte aber auch durch Handlungen und Zeichen. Letztere sind aber da wo Worte nicht verstanden werden können, also zum Beispiel bei Kindern mit schwersten Behinderungen, von besonderer Bedeutung. Was für die Beziehung von Mensch zu Mensch gilt, muss in besonderer Weise aber auch für die Beziehung von Gott zu uns Menschen gelten. Sakramente sind Zeichen der Nähe Gottes zu uns Menschen. Also gilt auch hier in der Beziehung von Gott zu schwerstbehinderten Menschen: Wo das Wort den Menschen nicht erreichen kann, müssen in besonderer Weise Zeichen der Nähe gegeben werden. Wo könnte dies besser geschehen als in der Eucharistie, dem einzigen Initiationssakrament, das der gläubige Christ regelmäßig empfangen kann.
Die „(...) Begriffe Real-(Personal-)Präsenz und Aktualpräsenz wollen deutlich machen, daß in der Feier der Eucharistie nicht nur die Gegenwart Jesu gegeben ist, sondern seine durch ihn gewirkte Heilstat, die in der Hingabe am Kreuz für uns und um unseres Heiles willen kulminiert.“(Adam, Adolf: Grundriss Liturgie, S.133) Das 2. Vatikanische Konzil führt dazu aus: „Die Sakramente sind hingeordnet auf die Heiligung des Menschen, den Aufbau des Leibes Christi (...)(SC59) Wie auch die anderen Sakramente, so erfährt der gläubige Christ besonders durch das Sakrament der Eucharistie „(..)in Christus die Heiligung der Menschen(...)“(SC10). Das Geheimnis der Eucharistie erschließt sich aber nicht nur im Empfang der Kommunion, sondern in der Mitfeier der gesamten Liturgie. „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“(Mt18,20) Dabei kommt dem gesamten Rahmen der Liturgie Bedeutung zu. Jeder einzelne Teil der Liturgie ist Teil des Sakraments. Durch die gläubige Mitfeier erschließt sich dem Christen das Geheimnis der Eucharistie, erfährt er Heiligung und Stärkung.
Es ist meines Erachtens unerheblich, ob sich die gläubige Mitfeier der Eucharistie des einzelnen Christen Außenstehenden erschließt. Das Empfinden schwerstbehinderter Menschen kann selbst von Menschen, die am Umgang mit ihnen gewöhnt sind, nicht unbedingt beurteilt werden. Geraden diesen Personenkreis von der Eucharistie auszuschließen hieße, ihm die Heilswirkung Gottes zu entziehen.
4. Durchführung
Die Vorbereitung von schwerstbehinderten Menschen auf die Erste Heilige Kommunion muss anders geschehen, als bei anderen Kindern. In der Didaktik des Faches Religion wird schon seit einigen Jahren Wert auf die Symboldidaktik gelegt (vgl. Hubertus Halbfas). Durch den Einsatz von Symbolen werden den Kindern Glaubenserfahrungen ermöglicht, bzw. sie dazu angeregt, diese zu erkennen. Was sich also in der Arbeit mit nichtbehinderten Kindern bewährt hat, muss in besonderer Weise bei der Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern berücksichtigt werden, da sie sowohl hinsichtlich ihres kommunikativen Verhaltens, als auch hinsichtlich ihrer Wahrnehmungsfähigkeit nicht mit nichtbehinderten Kindern verglichen werden können.
Die Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern lebt davon, dass versucht wird, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen, die weniger durch das Wort, als vielmehr durch die Vermittlung von Empfindungen geprägt ist. Daher kann ein Vorbereitungskurs nicht geprägt sein von „Lernzielen“ im klassischen Sinne. Die Lernziele müssen von den Katecheten vorgelebt werden, ihre Empfindungen, ihr Glaube spielt dabei m. E. eine entscheidende Rolle. Die intensive und ganz persönliche Auseinandersetzung mit Glaubenserfahrungen des Katecheten ist unabdingbare Voraussetzung um den Kindern unseren Glauben zu vermitteln. Diesem Gedanken tragen auch die deutschen Bischöfe Rechnung. „Vom Religionslehrer wird deshalb nicht nur Fachkompetenz erwartet. Er soll sich mit seiner ganzen Person, d.h. auch mit seiner Glaubensexistenz ‚ins Spiel‘ bringen.“ (Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz: „Zur Spiritualität der Religionslehrer, Bonn 1987)
Aber auch das Umfeld spielt eine größere Rolle, als bei anderen Kindern. Wichtig ist, dass besonders das Elternhaus sich intensiv mit Glaubensfragen auseinandersetzt. Die Vorbereitung auf die Kommunion muss auch vom Elternhaus begleitet werden. Da wo Worte und Erklärungen nicht, oder nur bedingt aufgenommen werden können, ist das Beispiel der Familie, der gelebte und verinnerlichte Glaube vielfach der einzige Weg, um den Kindern eine Beziehung zu Gott und der Kirche zu eröffnen.
4.1.Zur Zielgruppe
4.1.1. Definition
Als schwerstbehindert gelten Kindern, „(...)deren Behinderung auf der Grundlage einer geistigen Behinderung, einer Körperbehinderung (...) erheblich über die üblichen Erscheinungsformen hinausgeht (...)( Verordnung über die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Entscheidung über den schulischen Förderort; §8)
In den entsprechenden Richtlinien heißt es: „Schwerstbehinderung ist in der Regel Mehrfachbehinderung, die stets die gesamte Person betrifft.“ (Richtlinien und Hinweise für den Unterricht, Düsseldorf 1985, S.6)
Folgende Merkmale des Lernverhaltens werden definiert:
„Das Lernverhalten ist gekennzeichnet durch Beeinträchtigungen der Aufnahme,
Verarbeitungs- und Speicherprozesse sowie der Ausdrucksmöglichkeit.“
(Richtlinien, S.6)
Dabei wird eine große Spannbreite von keinem beobachtbarem Interesse bis hin zu Lernintresse auf vitale Bedürfnisse definiert.
4.1.2 Individuelle Lernvoraussetzungen
Folgende tabellarische Übersicht gibt einen Überblick über die Voraussetzungen, die die einzelnen Kinder mitbrachten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kb= körperbehindert Gb= geistigbehindert
Das nur bedingte Vorhandensein des Sprachverständnisses und der aktiven Sprache bedeutet, dass alle so bezeichneten Schülerinnen und Schüler über einen nicht altersentsprechenden aktiven und passiven Wortschatz verfügen. Ihr aktiver Wortschatz beschränkt sich meist auf einige wenige schon fast stereotypen Äußerungen. Es kann nicht immer sicher beurteilt werden, ob die Kinder das, was sie artikulieren auch verstanden haben. Allen ist gemein, dass sie ihre Vitalbedürfnisse artikulieren können.
Alle Schülerinnen und Schüler sind sehr empfänglich für Musik.
4.2.Die Vorbereitung
Die Vorbereitung der Kinder auf die Erste Heilige Kommunion erfolgte gemeinsam mit einer Kollegin der Christy - Brown - Schule, dem Pfarrer, der für unsere Schule zuständigen Pfarrgemeinde, und in enger Zusammenarbeit mit den Eltern und den Heimatpfarreien der Kinder.
In einem ersten Schritt wurden die Eltern der in Frage kommenden Schuljahrgänge über die Möglichkeit der Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion an der Christy-Brown-Schule informiert. Es meldeten sich zunächst 15 Eltern. In einem ersten Elternabend wurde über die Vorstellungen und Bedürfnisse der einzelnen Familien nachgedacht. Nach diesem Elternabend meldeten die Eltern der Kinder, die letztendlich an der Vorbereitung teilnahmen ihre Kinder verbindlich an.
Zu dem nun stattfindenden Elternabend, wurden sowohl die Eltern, als auch die Pastöre bzw. Gemeindereferentinnen und -referenten eingeladen. Bis auf eine Ausnahme waren alle Heimatpfarreien durch eine Person vertreten.
An diesem Elternabend stellten meine Kollegin und ich den Eltern unser Konzept vor. Wir stellten unsere Vorbereitung unter das Bibelwort: „Ich bin das Licht der Welt“Joh8,12. Den Kindern sollte auf möglichst vielfältige Weise dieses Jesuswort nahe gebracht werden.
Am ersten Elternabend gestalteten die Eltern mit Hilfe von Wachsplatten eine große Kerze, die immer dann brennen sollte, wenn die Kinder sich zur Kommuniongruppe trafen, oder einen Gottesdienst feierten. Sie sollte aber auch für die Eltern zum Symbol für die Erste Heilige Kommunion ihrer Kinder werden. So erzählten wir die Geschichte „Die Halle der Welt mit Licht erfüllen“ (Hoffsümmer, Kurzgeschichten IV 160) und entzündeten dabei die Gruppenkerze.
Den Abschluss dieses Elternabends bildete ein Schreibgespräch zum Thema: „Licht in meinem Leben“ und die Bitte an die anwesenden Vertreter der Heimatpfarreien die Vorbereitung der Kinder auf die Erste Heilige Kommunion im Gebet und durch Kontakte zu den beteiligten Familien zu begleiten.
Da die Gruppe aus einer großen Anzahl von Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern besteht, wurden die Eltern und zusätzlich Kinder aus anderen Klassen gebeten, uns nach Möglichkeit bei den Gruppenstunden zu begleiten.
Die Eltern wurden aufgefordert auch innerhalb der Familie vermehrt darauf zu achten, dass ihre Kinder sie als gläubige Menschen erfahren (Besuch der Sonntagsgottesdienste, Bezeichnen der Kinder mit dem Kreuzzeichen u.ä.) Neben den eigentlichen Gruppenstunden waren insgesamt zwei Schulgottesdienste vorgesehen, von denen einer die Kommunionkinder in den Vordergrund stellte und als „Vorstellungsgottesdienst“ gesehen werden kann.
Wichtig war uns, dass die Schülerinnen und Schüler die Kirche entdecken, in der auch das Fest stattfinden sollte. Sie sollten sie als einen Raum erfahren, in dem sie außerhalb der gewohnten Umgebung Schule/Klassenraum Ruhe und Angenommensein erfahren können. So fanden die meisten Gruppenstunden in der Kirche statt. Die Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen lebt sehr von Ritualen, daher sollten folgende Rituale die Kinder auf den Beginn der Stunde einstimmen.
- Bezeichnung mit dem Kreuzzeichen
- Entzünden der Gruppenkerze
- Kurzer meditativer Einstieg · Lied
Die Kinder sollten erfahren, dass die Vorbereitungstreffen sich vom üblichen Schulgeschehen abheben. Daher sollten sich die Gruppenstunden, auch wenn sie nicht in der Schule stattfanden, deutlich vom Alltag der Kinder unterscheiden. Es sollte immer versucht werden eine Atmosphäre der Ruhe und Entspannung zu schaffen.
Den Abschluss einer jeden Gruppenstunde bildete das Vaterunser, wobei sich die Schülerinnen und Schüler an die Hand nahmen, um so die Gemeinschaft zu spüren und ein Schlusslied. Bei den Gruppenstunden, die in der Kirche stattfanden, versammelten sich die Kinder zum Schlussritual vor dem Altar.
Nachfolgend sind die einzelnen Gruppenstunden inhaltlich kurz skizziert.
4.2.1. Ich bin das Licht der Welt
Die Schülerinnen und Schüler sollten Dunkelheit erleben und dabei erfahren, dass Licht in der Dunkelheit Trost spenden und Sicherheit geben kann.
Folgende Handlungsschritte wurden gewählt:
- Eingangsritual
- Aufsuchen des Snoezelenraumes, eines Raumes, der vollständig verdunkelt werden kann.
- Die Kinder erfahren die Dunkelheit, erleben aber auch durch die Ansprache der Lehrerin und des Lehrers, dass sie nicht allein sind. · Text: Es ist dunkel, ich kann nichts sehen. Ich bin aber nicht allein. Frau Dornebusch ist hier, Herr Thielmann ist hier, Kay-Uwe ist hier, (alle Kinder mit Namen nennen. Obwohl es etwas unheimlich ist, spüre ich doch, ich bin nicht allein.
- Entzünden der Gruppenkerze. Text: Da ist ein Licht, sein Schein dringt bis in die hinterste Ecke des Raumes. ( Mit der Kerze von Kind zu Kind gehen.)
- Weitere Kerzen entzünden und vor jedes Kind stellen. Text: Das Licht der Kerze entzündet immer mehr Kerzen. Sie geben Licht und Wärme. Jesus sagt: „Ich bin das Licht der Welt.“ Er sagt uns, er lässt uns nicht allein, wir müssen keine Angst haben. Er ist bei uns.
- Schlussritual
4.2.2 Ich entdecke die Kirche
In dieser Stunden sollten die Schülerinnen und Schüler die Kirche als Ort der Ruhe erfahren.
- Die Kirche ist groß: umgehen/umfahren des Gebäudes
- Betreten der Kirche: Hinweis auf Weihwasserbecken/ Kreuzzeichen /
Segnung der Kinder mit Weihwasser
- Den Innenraum erfahren: Stille spüren
- Gang zum Altar: Entzünden der Gruppenkerze
- Lied: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind
- Lehrer: Hier in der Kirche sind wir Gott ganz nahe. Er ist bei uns. Hier werden wir bald das Fest der ersten Heiligen Kommunion feiern. Dann wird Jesus uns im Heiligen Brot ganz nahe sein. Er ist dann in uns. Es wird ein schönes Fest.
- Fragen der Kinder zulassen: Was fällt euch auf, was kennt ihr schon? · Schlussritual
4.2. Ich bin
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich als Person erfahren und angenommen fühlen. Gang zur Kirche. Handlungsschritte:
- Eingangsritual: Du hast uns deine Welt geschenkt
- Portraitsfotos der Kinder werden gezeigt. Sebastian, Kathrin, Daniel,
Kay-Uwe und Ema sollen die einzelnen Fotos den Kindern zuordnen.
- Lehrer zeigt jedem einzelnen Kind sein Foto. Text: Name, du bist auf dem Bild. Gott hat dich lieb.
- Schlussritual
4.2.3 Ich bin ein Teil der Gemeinschaft in der Kommuniongruppe
Diese Gruppenstunde fand in der Schule statt.
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich als Teil einer Gruppe empfinden. Handlungsschritte:
- Eingnagsritual
- Betrachten eines Gruppenfotos, benennen der einzelnen Kinder.
- Daniel, Ema, Sebastian und Kathrin beschreiben abwechselnd die einzelnen Kinder der Gruppe. Die anderen Kinder versuchen zu erraten, um wen es sich handelt.
- Gestalten einer Collage mit den Portraitsfotos der einzelnen Kinder. Jedes Kind hinterlässt auf dem Plakat einen Handabdruck.
- Schlussritual
Wenige Tage nach dieser Gruppenstunde fand ein Schulgottesdienst statt, in dem die einzelnen Kommunionkinder der Schulgemeinde vorgestellt wurden. Das in der Gruppenstunde erstellte Plakat hing während des Gottesdienstes in der Kirche. Anschließend wurde es in der Pausenhalle der Schule ausgestellt.
4.2.4 Ich bin Teil der Gemeinschaft mit Jesus
In dieser Stunde sollten sich die Schülerinnen und Schüler als Teil der Gemeinschaft mit Jesus erfahren.
Gang zur Kirche.
Handlungsschritte:
- Eingangsritual
- Lehrer: Heute wollen wir etwas von Jesus hören. Er ist der Sohn Gottes. Bald wird er sich uns im Heiligen Brot schenken. Er ist dann in uns.
- Frage an die Kinder, ob sie Jesus in der Kirche entdecken. Hinweis auf das Kreuz.
- Jesus sagt: „Ich bin mitten unter euch.“ Erzählen von Mt18,20.
- Gestalten einer Mitte: Kerze, Kreuz, Kinder schmücken Mitte mit Blumen und Schmucksteinen.
- Schlussritual
4.2.5 Wasser ist Leben
Die Kinder sollten Wasser sinnhaft erleben. Dieses Treffen fand in der Schule statt.
Gestalten einer Mitte mit einer Schale Wasser, Rose von Jericho, Blüten Handlungsschritte:
- Eingangsritual
- Kinder mit Wasser spielen lassen, über die Hände gießen, vorsichtig mit Wasser benetzen.
- Daniel, Ema, Christian, Katrin und Kay-Uwe erzählen lassen, wo Wasser gebraucht wird. Angenehme Empfindungen wecken:
Baden/Schwimmen/warmes Wasser tut gut und entspannt mich.
- Rose von Jericho in Wasser legen, Geschehen kommentieren, dazu leise Musik (Komm mit zur Quelle; Krenzer, Rolf)
- Kinder mit Wasser segnen.
- Schlussritual
4.2.6. Ich habe einen Namen und ich bin getauft
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich, soweit möglich an ihre Taufe erinnern.
Handlungsschritte:
- Gang zur Kirche · Eingangsritual
- Betrachten des Taufbrunnens
- Betrachten von Bildern mit Täuflingen
- Bezeichnung der Kinder mit Weihwasser. Lehrer: Name, Gott hat dich in deiner Taufe bei deinem Namen gerufen. Er hat dich lieb
- Schlussritual
4.2.7. Ich entdecke die Kirche (Teil 2)
Handlungsschritte:
- Eingangsritual
- Den Kirchenraum wirken lassen
- Einspielen von Musik
- An verschiedenen Orten (Marienaltar, Altar usw.) singen.
- Schlussritual
4.2.7. Ich entdecke die Kirche (Teil 3)
In dieser Gruppenstunde sollten die Kinder die Sakristei kennenlernen. Der Pfarrer zeigte ihnen die liturgischen Geräte und die Messgewänder, ließ sie die Stoffe fühlen.
Am Altar : Lehrer: „Bald werdet ihr an diesem Tisch, dem Altar das Heilige Brot empfangen, eure Eltern, Geschwister, Oma und Opa, eure Freunde und Lehrerinnen und Lehrer werden dabei sein. Es wird ein schönes Fest Schlussritual
4.2.8. Wir feiern ein Fest
Diese Gruppenstunde fand wieder in der Schule statt. Es soll als festliches Frühstück mit den Müttern der Kinder stattfinden. Die Kinder sollen noch einmal vor der Kommunionfeier gemeinsam mit dem Pastor und den beiden Katecheten sich als Gemeinschaft erfahren. Wie jede Gruppenstunde, so wurde auch diese Stunde mit dem für die Kinder bekannten Ritualen begonnen und beendet. Gemeinsam mit ihren Müttern gestalteten sie zum Abschluss ihre eigene Kommunionkerze.
4.3.Die Feier der Ersten Heiligen Kommunion
Bei der Feier der ersten Heiligen Kommunion war uns wichtig, dass die Kinder die wesentlichen Elemente der Liturgie sinnlich erfahren konnten. So wurde sehr viel Wert auf die Musik gelegt. Wie schon bei der Beschreibung der Kindergruppe erwähnt, sind alle Kinder sehr empfänglich für Musik.
Auf einige Besonderheiten des Kommuniongottesdienstes soll an dieser Stelle besonders verwiesen werden.
Uns war es wichtig, dass den Kindern verdeutlicht werden sollten, dass heute ein besonderer Tag für sie sein sollte, in dessen Mittelpunkt die Kinder selbst, aber auch der Empfang der Kommunion als ganz besonderes Geschenk für sie stehen sollte. Wie bereits erwähnt, kann nicht bei allen Kindern mit Sicherheit angenommen werden, dass Worte von ihnen verstanden werden. Wie die gesamte Vorbereitung, so sollten auch im Kommuniongottesdienst Zeichen gesetzt werden, die den Kindern verdeutlichen sollten, dass sie so wie sie sind von Gott angenommen werden. So wählten wir an Stelle der in der Liturgie zur Feier der Ersten Heiligen Kommunion üblichen Erneuerung des Taufversprechens, die das Sakrament der Krankensalbung. Dieses Zeichen war uns besonders wichtig, weil bei einigen Kindern nicht sicher war, ob sie die Heilige Kommunion in der Messe empfangen würden, weil sich die Nahrungsaufnahme bei ihnen besonders schwierig gestaltete. Besonders Christian nimmt seine Mahlzeiten nur unter Berücksichtigung fester Rituale ein, die innerhalb des Gottesdienstes nicht eingesetzt werden konnten. Seine Familie wollte am Tag nach der Erstkommunion innerhalb eines Hausgottesdienstes den Empfang der Kommunion mit Christian nachholen. Kristof verweigert ebenfalls häufig die Nahrungsaufnahme, ihm sollte seine Mutter die Kommunion reichen. Wichtig war uns auch eine umfangreiche Einbeziehung der Bezugspersonen der Kinder. Als Messdiener fungierten Geschwister, die Fürbitten wurden von Eltern, Lehrern und Geschwistern gesprochen.
Nachfolgend ist der Ablauf des Gottesdienstes zur Feier der Ersten Heiligen Kommunion kurz skizziert.
Einzug:
Du hast uns deine Welt geschenkt (Krenzer/Jöker)
Liturgische Begrüßung
Begrüßung der Kommunionkinder mit dem Lied: „Du hast uns deine Welt geschenkt
Name und Name,
du hast uns deine Welt geschenkt. Herr wir danken dir.“
Bei der Nennung der Kindernamen wurden die entsprechenden Kinder von den Katecheten berührt.
Kyrie:
1-0
Antwortruf: Hal 12
PR: Jesus, du bist der Freund der Kinder.
PR: Jesus, du bist für uns gestorben und auferstanden
PR: Jesus, du bist das Brot, von dem wir leben und rufst uns an deinen Tisch.
PR: Jesus ist unser Freund und Bruder. Er erbarmt sich unser, er verzeiht uns unsere Sünden und hilft uns gut zu sein.
Zwischengesang: Halleluja (Hal 25, 1-4) Evangelium: Joh8,12
Predigt
Tauferneuerung/Krankensalbung
Eltern oder Pate entzünden Kommunionkerze an der Osterkerze, Priester segnet Kinder mit Weihwasser und nimmt die Krankensalbung vor (Anmerkung: nach der Konstitution des II. Vatikanums über die heilige Liturgie ist die Krankensalbung bei Kindern möglich, wenn sie durch dieses Sakrament Stärkung erfahren können. Vgl. Adam: Grundriss Liturgie, S. 184)
Dazu: Tauflied
Fürbitten:
Eltern: Schenke unseren Kindern viel Freude, wenn du im heiligen Brot zu ihnen kommst.
Lehrer: Hilf uns Seelsorgern, Eltern und Erziehern, den Kindern das zu geben, was sie zum Leben für Leib und Seele brauchen.
Geschwisterkind: Für unsere Eltern, Paten und Erzieher: Du siehst all das Gute, was sie für uns tun. Bewahre sie in deiner Liebe.
Lehrer: Für alle Menschen unserer Gemeinden: Lass sie immer für die Belange der Kinder offen sein, besonders auch für Kinder mit Behinderungen.
Geschwisterkind: Lass uns alle erkennen, wie kostbar Brot ist und gib allen Menschen täglich das Brot, das sie zum Leben brauchen.
Priester: Herr, bewahre deine Kinder, die du uns gegeben hast. Lass sie dir und den Menschen zur Freude werden.
Gabenbereitung
Priester erklärt die Bedeutung von Brot und Wein
Dazwischen jeweils zwei Strophen : Wir bringen gläubig Brot und Wein (Hal30)
Sanctus: Unser Lied nun erklingt...
Vaterunser (Hal45)
Friedensgruß
Kommunion der Kinder in Stille (der Priester geht zu den Kindern, reicht ihnen, falls dies möglich ist die Kommunion, ansonsten Kommunion der Eltern)
Anschließend Kommunion der Gemeinde
Dankgebet
Lied: Laudato si (Hal92)
1-1
Entlassung und Segen
Lied zum Auszug: Großer Gott wir loben dich (1-4)
5. Nachbetrachtung
Für meine Kollegin und mich, aber auch den Pfarrer der für unsere Schule zuständigen Gemeinde, war die Vorbereitung von schwerstbehinderten Kindern auf die Erste Heilige Kommunion Neuland. Im Verlaufe der Vorbereitung wurden wir mit vielen theologischen Fragen konfrontiert, mit denen wir uns bisher nicht auseinandergesetzt haben. Immer wieder kamen Zweifel auf, ob wir den richtigen Weg beschritten. Die Reaktionen der Kinder zeigte uns schließlich, der Weg war richtig. Wir konnten beobachten, dass sie im Verlaufe der Vorbereitung immer ruhiger und entspannter wurden. Kinder, die uns als besonders problematisch erschienen, zeigten plötzlich eine Wachheit und Offenheit, die wir nie für möglich gehalten hätten.
Besonders die Einbeziehung des Elternhauses zeigte sich als sehr sinnvoll. Einige Mütter nahmen recht regelmäßig an den Vorbereitungstreffen teil und erzählten uns, dass sie durch die Vorbereitung ihrer Kinder selbst wieder Zugänge zum Glauben gefunden haben.
Auch die Einbeziehung anderer Schülerinnen und Schüler der Schule erwies sich als hilfreich. Sie waren ja zunächst nur als Hilfspersonal eingesetzt, um den Weg zur Kirche bewältigen zu können. Sie brachten aber durch ihre Anwesenheit und ihre Fragestellungen eine Lebendigkeit in die Gruppe, die wir alleine so nicht hätten erzielen können
Die theoretische Auseinandersetzung und die vielen Gespräche innerhalb des Vorbereitungsteams führten zu einer Auseinandersetzung mit unserem eigenen Glauben, der uns ein ganz neues Verständnis für die Liturgie eröffnete. Heute kann ich die Frage, die ich in der Einleitung zu dieser Hausarbeit gestellt habe, ob nämlich die Eucharistie mit und für schwerstbehinderte Menschen möglich und sinnvoll ist, mit einem klaren und deutlichen JA beantworten.
6. Literaturangaben
Denzinger, Hünermann: Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Freiburg im Breisgau 1991
Konstitution des II. Vatikanums über die heilige Liturgie, 4.12.1963
Lumen Gentium, Dogmatische Konstitution über die Kirche, 21.11.1964 Adam, Adolf: Grundriss Liturgie, Freiburg im Breisgau 1998
Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Grundlagenplan für den katholischen Religionsunterricht an Schulen für Geistigbehinderte, München 1999
Kultusministerium NRW (Hrsg.): Richtlinien und Hinweise für den Unterricht: Förderung schwerstbehinderter Schüler, Düsseldorf 1985
MSWWF: Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften, Düsseldorf 1999
Deutscher Katechetenverein: unterwegs, Heft 4, 2000
Homepage der Pfarre St. Josef: http//www.stjosef.at
Halbfas, Hubertus: Lehrerhandbuch Religion, Stuttgart 1996
Bistum Essen (Hrsg.): Halleluja: Lieder auf dem Weg des Glaubens, 1995
Krenzer, Rolf: Komm mit zur Quelle: Musikalische Meditationen für Kinder, Impulse Musikverlag, 1989
7. Anhang
Die Halle der Welt mit Licht füllen
Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu seinem Nachfolger bestellen. Er versammelte die Weisen seines Landes und rief seine beiden Söhne herbei. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und sagte: "Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloß bis zum Abend füllen. Womit, das ist eure Sache." Die Weisen sagten: "Das ist eine gute Aufgabe."
Der ältere Sohn ging davon und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter dabei waren, das Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen. Das ausgepreßte Zuckerrohr lag nutzlos umher. Er dachte sich: "Das ist eine gute Gelegenheit, mit diesem nutzlosen Zeug die Halle meines Vaters zu füllen." Mit dem Aufseher der Arbeiter wurde er einig, und sie schafften bis zum späten Nachmittag das ausgedroschene Zuckerrohr in die Halle. Als sie gefüllt war, ging er zu seinem Vater und sagte: "Ich habe deine Aufgabe erfüllt. Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem Nachfolger." Der Vater antwortete: "Es ist noch nicht Abend. Ich werde warten."
Bald darauf kam auch der jüngere Sohn. Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein.
Der Vater sagte: "Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht erfüllt. Du hast sie mit dem gefüllt, was die Menschen brauchen."
aus den Philippinen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Vorbereitung und Durchführung der Ersten Heiligen Kommunion für schwerstbehinderte Kinder. Sie argumentiert, warum die Eucharistie gerade für diesen Personenkreis angeboten werden muss und beschreibt den Ablauf der Vorbereitung und der Feier.
Warum ist die Eucharistie für schwerstbehinderte Kinder wichtig?
Die Eucharistie ist ein Zeichen der Nähe Gottes zu den Menschen. Da schwerstbehinderte Kinder oft in besonderer Weise auf die Zuwendung anderer angewiesen sind und verbale Kommunikation eingeschränkt sein kann, kommt der symbolischen Bedeutung der Sakramente eine besondere Rolle zu. Die Eucharistie, als Zeichen der Realpräsenz Jesu, sollte diesen Kindern nicht verwehrt werden.
Wie unterscheidet sich die Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion für schwerstbehinderte Kinder von der Vorbereitung anderer Kinder?
Die Vorbereitung setzt auf Symbole, Rituale und die Schaffung einer Atmosphäre der Ruhe und Entspannung. Sie ist weniger auf verbale Wissensvermittlung ausgerichtet, sondern auf die Vermittlung von Empfindungen und Glaubenserfahrungen. Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Elternhaus ist entscheidend.
Was sind die wichtigsten Elemente der Vorbereitung?
Die Vorbereitung umfasst unter anderem die Auseinandersetzung mit dem Thema Licht (Jesus als das Licht der Welt), die Entdeckung der Kirche als Ort der Ruhe, die Erfahrung der eigenen Person und der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft (Kommuniongruppe), das sinnliche Erleben von Wasser und die Auseinandersetzung mit der Taufe.
Wie lief die Feier der Ersten Heiligen Kommunion ab?
Die Feier der Ersten Heiligen Kommunion legte Wert auf die sinnliche Erfahrung der Liturgie, insbesondere durch Musik. Es gab Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse der Kinder, wie z.B. die Möglichkeit der Krankensalbung anstelle der Tauferneuerung. Die Einbeziehung der Bezugspersonen der Kinder (Eltern, Geschwister, Lehrer) war von großer Bedeutung.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der Vorbereitung?
Die Eltern spielen eine entscheidende Rolle. Sie sollten sich intensiv mit Glaubensfragen auseinandersetzen und ihren Kindern ihren eigenen Glauben vorleben. Sie begleiten die Kinder bei den Vorbereitungstreffen und sorgen für eine unterstützende Atmosphäre zu Hause.
Welche Erfahrungen wurden bei der Vorbereitung und Durchführung gemacht?
Die Vorbereitung und Durchführung der Ersten Heiligen Kommunion für schwerstbehinderte Kinder war für alle Beteiligten Neuland. Es zeigte sich, dass die Kinder im Verlaufe der Vorbereitung ruhiger und entspannter wurden. Die Einbeziehung der Eltern und anderer Schüler erwies sich als sehr sinnvoll. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben führte zu einem neuen Verständnis für die Liturgie.
Welche Definition von Schwerstbehinderung wird in der Hausarbeit verwendet?
Als schwerstbehindert gelten Kinder, deren Behinderung auf der Grundlage einer geistigen Behinderung, einer Körperbehinderung erheblich über die üblichen Erscheinungsformen hinausgeht. In der Regel handelt es sich um eine Mehrfachbehinderung, die die gesamte Person betrifft. Das Lernverhalten ist gekennzeichnet durch Beeinträchtigungen der Aufnahme, Verarbeitungs- und Speicherprozesse sowie der Ausdrucksmöglichkeit.
- Quote paper
- Herbert Thielmann (Author), 2001, Das Sakrament der Eucharistie für schwerstbehinderte Kinder. Möglichkeiten der Hinführung zum Sakramentenempfang, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101682