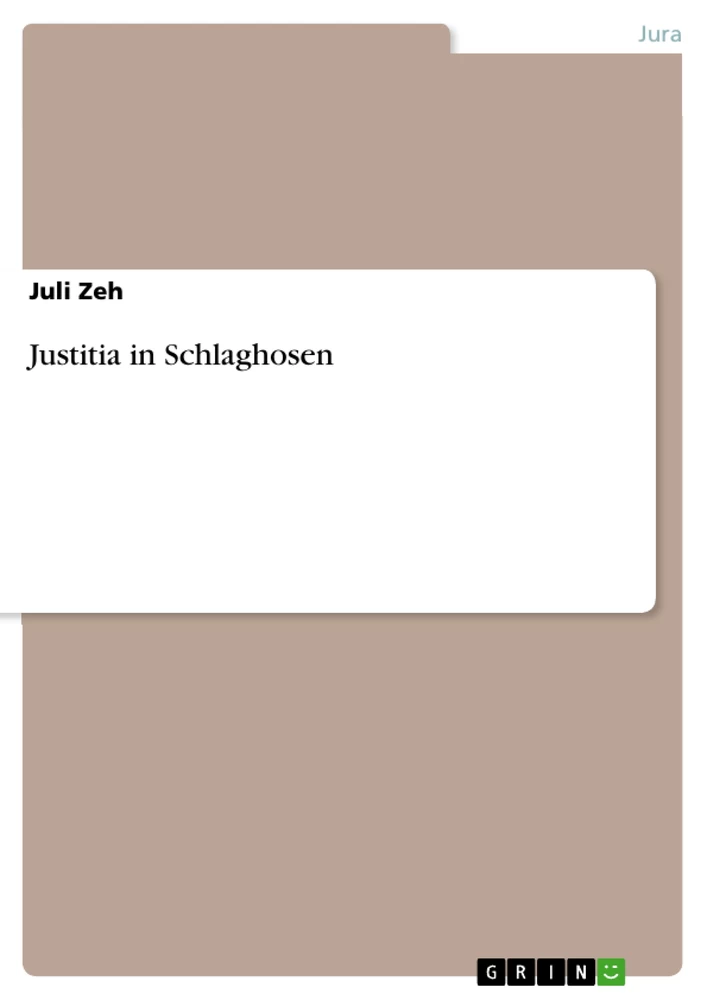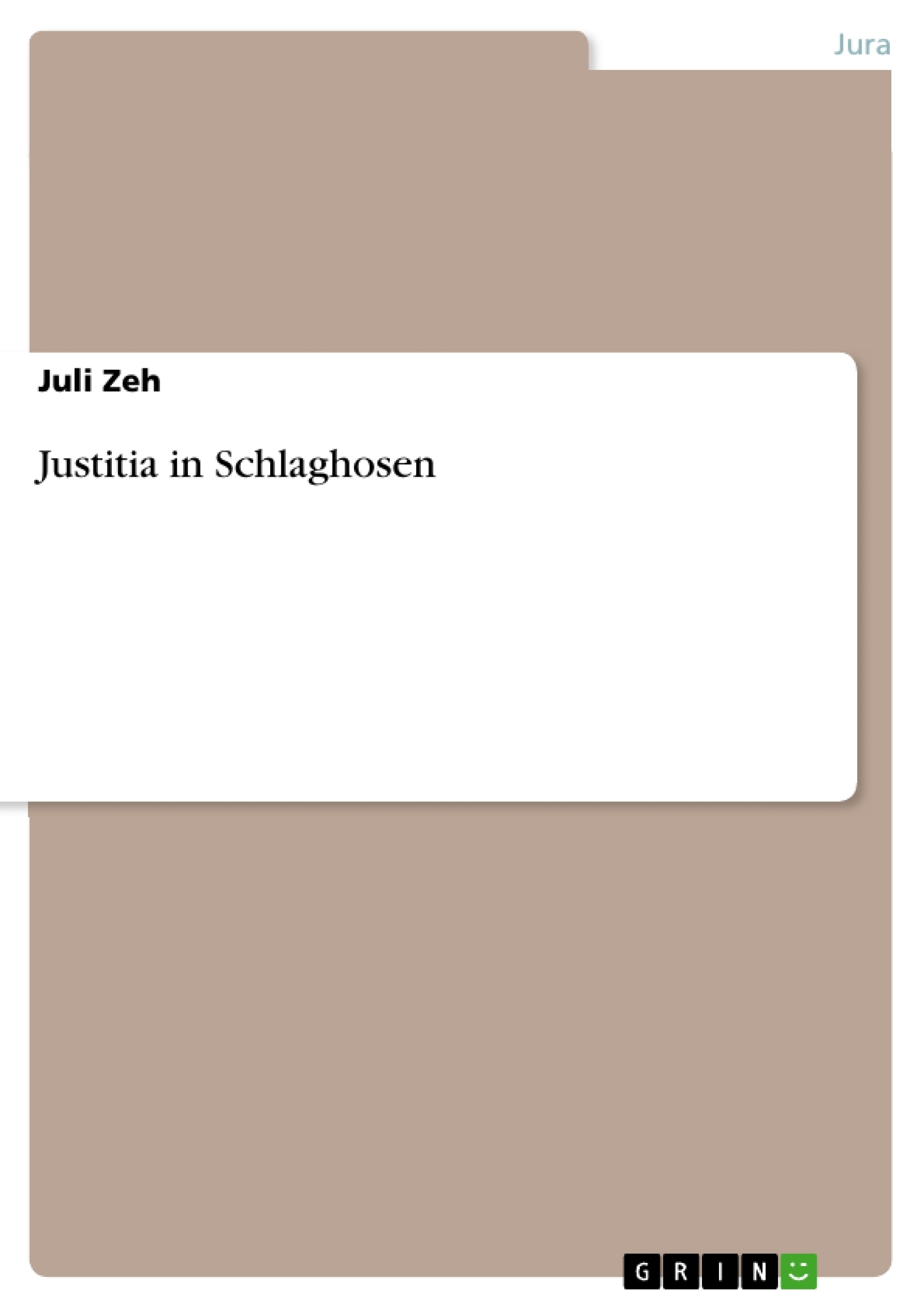Justitia in Schlaghosen - Zur Frage nach Statik und Dynamik des modernen Rechts
,,Warum hast du dir eigentlich die Haare abgeschnitten, kürzer als deine Fingernägel?" fragte mich neulich ein Kollege. Ich schaute ihn eine Weile an und überlegte, was er eigentlich wissen wollte, denn zur Frisur einer Frau kann man äußern ,,schön" oder ,,nicht schön", aber - warum ,,warum"? Ich antwortete: ,,Weil es mir so gefiel."
Die Antwort befriedigte ihn nicht, man sah es am zögerlichen Nicken. Vielleicht sagte er noch etwas wie: ,,Naja, schlecht sieht es nicht aus." Als er gegangen war, wurde mir klar, was er eigentlich wissen wollte. Nämlich: ,,Kann man mit solchen Haaren noch Juristin sein?"
Nach Abschluss meines Ersten Staatsexamens lag vielen Bekannten eine ähnliche Frage auf der Zunge, und manche äußerten sie im Scherz: ,,Wie kann man denn mit einem Ring in der Nase und Schlaghose so gute Klausuren schreiben?" Man kann. Quod erat demonstrandum. Das wissen sie selber, die Kollegen, und dennoch kommt ihnen die Frage auf merkwürdige Art berechtigt vor.
Juristen sind konservativ. Das klingt wie ein Vorurteil; es ist ein Klischee, man könnte aber auch sagen: Erfahrungswert. Ein wenig Feldforschung in der juristischen Bibliothek ergibt: Jedenfalls kleiden sie sich konservativ. Keine Punks, keine Ökolatschen, kein Grunge und kein Techno, höchstens ein paar gebremste Girlies unter den jüngeren Semestern. Da sehe man sich mal zum Vergleich, sagen wir, die Soziologen an. Als ich mein Studium aufnahm in Passau, wunderte ich mich sehr darüber, warum fast alle Kollegen gerade geschnittene Jacken mit grüner Wachsbeschichtung trugen. Ich wusste noch nicht, was eine Barbour-Jacke ist. Zwar ist es hierzulande anders als im ritualbewussten Großbritannien nicht Pflicht, sich vor Betreten des Gerichtssaals eine gepuderte Zopfperücke über den Kopf zu stülpen, es bleibt uns aber die traditionelle Robe, unter der sich in den meisten Fällen ein klassisch geschnittenes Kostüm, respektive der Anzug verbirgt. Mit Krawatte. Statusbewusstsein? Standesdünkel? Oder einfach weil die Mandanten besser zuhören, wenn der Rechtsberater in feines Tuch gehüllt ist? Der Maßanzug verleiht nicht nur den Eindruck von Autorität, er verkörpert sie geradezu - die Autorität, die dem Recht selbst innewohnt, als dessen Vertreter wir Juristen uns begreifen. So könnte man es sehen: Alle sind wir Angestellte der selben FirmaJustitia, wir sind im ersten Semester schon Kollegen, während alle anderen noch lausige Kommilitonen sind, und gekleidet sind wir, wie es dercorporate identityunseres Unternehmens entspricht. Von Anfang an.
Professor G. äußerste in L. einmal beiläufig in seiner Vorlesung: ,,Das Recht ist immer konservativ." Das blieb mir im Ohr. Er hätte genauso gut sagen können: ,,Das Recht selbst trägt eine Barbour-Jacke, darunter einen gut sitzenden Anzug, und wenn es nach Großbritannien fährt, eine gepuderte Perücke." Sollte die Darstellung der engelsgleichen Justitia Ergebnis einer Fehleinschätzung sein?
Das Recht an sich, wollte der Professor sagen, ist in der Konstruktion statisch, in der Zielsetzung bewahrend ausgerichtet. Das Recht nämlich muss immer schon dasein, bevor sich der Sachverhalt ereignet, der daran gemessen werden soll. Ohne dass auf rein demokratisch verankerte Grundsätze wie das staatliche Willkür vermeidende Prinzip der Rechtssicherheit rekurriert werden müsste, lässt sich diese Feststellung sozusagen aus der ,,Natur der Sache" erklären: eine Regel ist sinnlos, wenn es nicht möglich ist, sie zu befolgen, und die Möglichkeit desFolgens, mit der Nebenbedeutung vonGehorchen, besteht nur, wenn die Regel erstens schon vorher existierte und zweitens für einen gewissen Zeitraum besteht, da der Adressat andernfalls sein Verhalten nicht anpassen kann. Im Interesse der Effektivität einer Regel liegt es zunächst einmal, dass der Zeitraum ihres Bestehens nicht zu kurz ist: sie iständerungsfeindlich. Ein System also, innerhalb dessen wechselnde, immer neue Ereignisse mit Hilfe eines (zum Teil buchstäblich seit Jahrhunderten) bestehenden Instrumentariums bewertet werden sollen, ist notwendigerweise dem Hauptstrom seiner Wirkungsrichtung nach bewahrend: konservativ.
Die Welt verändert sich, die Regel bleibt. Das Leben, rasch und dynamisch voranschreitend in seiner unendlichen Vielfalt zieht an seinen Füßen den statischen Betonklotz rechtlichen Regelwerks mit sich und wird so auf ein erträgliches Tempo gebremst. Bestenfalls mit erheblicher Verspätung ist bei heftigem Ziehen in eine bestimmte Richtung ein graduelles Mitschleppen der Fessel möglich, ein geringes Gewinnen von Spielraum: da wird das Faktische so lange normativ tätig, bis auch das geschriebene Recht nicht mehr ausweichen kann und sich zu einer Änderung bequemt. Widerwillig. Ja, ganz bestimmt. Und Frauen mit fingernagelkurzen Haaren können keine guten Juristinnen sein.
Betrachtet man den aufRegelund(Be-)Folgenreduzierten Vorgang rechtlichen Wirkens mit eher semantischem Blick, drängt sich eine völlig andere Vorstellung auf. DasBefolgte, das immer schon Zuvorgekommene, müsste als etwas Voranschreitendes betrachtet werden, als Träger einer leitenden, richtungsweisenden Funktion. Dem BegriffFolgenwohnt das Vorausgegangensein eines innovativen Impulses inne. Recht also als die visionär-normative Ausformulierung einer zukunftsweisenden Idee, als ein nie ganz erreichbares Ideal, dem es zu folgengilt, als die ewige Wurst vor der Nase des Hundes? Naja. Und ein gutes Examen verlangt notwendig Schlaghosen.
Die Aussicht von der Warte zweier forcierter Extrempositionen legt nahe, was auch ein Blick auf die Wirklichkeit ergeben hätte: so einfach ist das nicht. Man ist schon daran gewöhnt: nie gibt es das eine noch das andere, sondern nur das Zusammenspiel zweier gegensätzlich wirkender Kräfte. Das hieße also, dass eine Bestandsaufnahme mit dem Ziel, die Bedeutung des Rechts fürEntwicklungsprozessein der heutigen Gesellschaft herauszufinden, nur zu einer graduellen Festlegung auf einer Skala zwischen ,,statisch" und ,,dynamisch" führen kann. Und gute Juristinnen haben ebenmehr oder wenigerkurze...
Schnitt. Untersuchen wir in einer flüchtigen historischen Rückschau die Funktion, besser: die Stellung des Rechts in einem Moment hochgradig verdichteter politischer, sozialer und kultureller Dynamik: im Moment der Umwälzung, der Revolte. Wir blicken, beispielhaft, auf die revolutionären Ereignisse von 1789. Das Recht ist zu diesem Zeitpunkt ein monarchisches Regelsystem, innerhalb dessen eine Vielheit von Rechtsunterworfenen einem einzelnen, personalen Rechtsschöpfer gegenübersteht. Es dient gemeinsam mit dem christlichen Dogma der Sicherung und Erhaltung von staatlicher Macht. Die Revolution richtet sich, immer stark vereinfachend gesprochen, zwar nicht direkt und in erster Linie gegen das geltende Recht; jenes steht ihr aber auf Seite der staatlichen Macht antagonistisch gegenüber. Hier treffen das Recht als rein statische Kraft und eine eskalierende soziale Dynamik aufeinander; es siegt der Stärkere - im Beispielsfall zumindest teilweise die Revolution -, und das Recht verliert mit der Beseitigung des Hoheitsträgers vorübergehend Geltungsgrund und Wirkung. Ein anarchischer Zustand tritt ein. Im Anschluss an eine Kräfteneuverteilung im Zuge der Revolutionswirren erhält das Recht jedoch die entgegengesetzte Rolle: durch die Einführung von Menschen- und Bürgerrechten erlangt eine politisch-philosophische Idee ihre Verankerung, ohne dass in der gesellschaftlichen Realität bereits umfassend eine Entsprechung im soziokulturellen Bewusstsein vorhanden wäre. Normen werden an den Anfang einer angestrebten Entwicklung gesetzt und sollen regulativ verändernd auf die Gesellschaft einwirken. Man beobachtet also, wie das Recht im Verlauf eines gesellschaftlichen Umbruchs zwei ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Ähnliche Vorgänge zeigen sich während und im Umkreis jedes revolutionierenden Geschehens.
Diese Betrachtung lässt vermuten, dass sich eine Einstufung von Normen auf der Skala statischbisdynamischnicht anhand eines allgemein feststellbaren Charakterzugs des >Rechts an sich< vornehmen lässt. Damit wäre Professor G widerlegt (Recht ist nichtimmer konservativ) und müsste verwiesen werden auf die altbewährte Formel, die jeder guten juristischen Antwort vorausgeht: Es kommt darauf an. Aber worauf kommt es an? Vielleicht darauf, wo´s herkommt. Oder auch: Ist die Inhaberschaft vonRechtsmacht(hier gebraucht im Sinne von originärerRechtsschaffungsbefugnis) sowie das Verfahren der Rechtssetzung verantwortlich für den Gesamtcharakter eines Rechtssystems?
Rechtssetzungsbefugnis ist Teil der staatlichen Gewalt, so verschieden auch die denkbaren staatlichen Systeme sonst organisiert sein mögen. Imdemokratischen Systemgeht diese Gewalt vom Volk aus; auch die Rechtsmacht liegt demnach originär beim Volk, kompetenziell wird sie auf Repräsentativorgane umgeleitet. Im Rechtssetzungsverfahren werden die Anliegen von Interessengruppen mit- und gegeneinander ausgeglichen und abgewogen, bis eine Kräfteverteilung erreicht ist, die eine parlamentarische Mehrheitsentscheidung möglich macht. Ein solches Verfahren ist einerseits in hohem Maße durchlässig für gesellschaftliche Entwicklungen und die sich daraus ergebenden Interessenbildungen und -änderungen; andererseits ist es behäbig in seiner Arbeitsweise und hat retardierenden Effekt. Damit ist das zentraleParadoxonbenannt, dass die Rechtsschaffung im modernen demokratischen Staat beherrscht. Eine von immer komplexeren Interessenstrukturen durchdrungene und von überproportional ansteigendem Wandlungstempo beherrschte Gesellschaft verlangt nach einem Recht, das erstens sämtliche dynamischen Impulse in sich aufnimmt, zweitens in der Lage ist, diese in entwicklungsfördernder Geschwindigkeit umzusetzen und drittens dabei die unhandliche Wischiwaschi-Erscheinung schnell festgeklopfter Kompromisse vermeidet. Das sind gleich drei Wünsche auf einmal. Deshalb steht dem Ruf nach einem dynamischeren Recht an erster Stelle nicht die bewahrende Natur eines änderungsfeindlichen Regelsystems entgegen, sondern die demokratische Idee selbst, die von pluraler Interessenbildung und deren Vertretung ausgeht. Und sich der Gefahr aussetzt, die Entscheidungsfindung bis zur Perversion zu verkomplizieren: bis zum Stillstand. Niemand ist in den Disziplinen >Schnelles Recht< und >Eindeutiges Recht< so erfolgreich wie ein rechtssetzender Tyrann; er sagt einfach: ,,Gute Idee, und folgendermaßen wird's gemacht." Gleichzeitig ist aber nichts unempfindlicher gegenüber dynamischen gesellschaftlichen Entwicklungen als eine solche Ein-Mann-Legislative, die immer nur ein Interessen vertreten kann: das persönliche Machterhaltungsinteresse.
Um Rast zu halten und das Panorama zu genießen, ziehen wir uns auf ein hügelförmiges Zwischenergebnis zurück. Es lautet: Wenn die Rechtsmacht originär bei der größtmöglichen Personenmehrheit liegt, entspringt das Recht zwar einem hoch dynamischen Ausgangspunkt, erhält aber Statik durch ein Verfahren, in dem durch absorbierendes Kräftegleichgewicht die überschießende, effektiv verändernd wirkende Kraftmenge sehr klein ist. Liegt die Rechtsmacht hingegen bei einer einzelnen Person, ist zwar eine große Kraftmenge frei, die hoch dynamische Prozesse möglich machen würde - der Ausgangspunkt ist aber ein in sich ruhender, statischer, so dass es an entsprechenden Impulsen fehlt.
Beim Rundblick fragen wir uns: Würden also beide Modelle scheitern, wenn wir versuchen wollten, unser gegenwärtiges Rechtssystem der zunehmenden Wandlungsgeschwindigkeit unserer Gesellschaft anzupassen? Das hieße: Nicht mehr Demokratie, aber auch nicht weniger? Am Horizont bewegt sich was, wir kneifen die Augen zusammen und sehen: Es ist die Europäische Union (EU). Wir sehen deutlich, dass nur eine relativ kleine Gruppe von Menschen dort bei der Arbeit ist, und daran erkennen wir, dass sie für die Konstruktion des europäischen Hausesdie zweite Alternative probieren: Weniger Demokratie. Das Haus wächst schnell.
Der Integrationsprozess in Europa stellt sich hauptsächlich als ein Werk der Regierungen dar, parlamentarische Beteiligung spielt eine untergeordnete Rolle. Das Zustandekommen einer Rechtsnorm hängt deshalb von der Mitwirkung einer vergleichsweise geringen Anzahl von Personen ab. Dieser Mangel an demokratischer Legitimierung von EU-Normen hindert selbstverständlich nicht das Entstehen eines Rechtssystems. Deshalb wollen wir nicht vom Hügel schreien: ,,Je weniger Demokratie desto auf jeden Fall schlechter!" Vielmehr soll eine Überprüfung stattfinden, ob im Rahmen des (tendenziell undemokratischen) Integrationsvorgangs schnelles Recht für eine schnelle Gesellschaft geschaffen wird. Anerkanntermaßen bilden die europäischen Normen inzwischen eine selbständige Rechtsordnung eigener Art; die Auswirkungen sind nicht nur im ökonomischen Sektor immens. Diese Rechtsordnung entsteht auf folgendem Weg: Kompetenzen werden zur freien Verfügung paketweise im Abstand einiger Jahre auf die EU übertragen. Diese Übertragungsakte (Änderungen des EU-Vertrags) müssen das schwerfällige parlamentarische Verfahren in den einzelnen Mitgliedstaaten durchlaufen. In den Zwischenzeiten aber sind die rechtssetzenden Entscheidungen der EU-Kommission weder an die nationalen Parlamente noch in mehr als geringfügigem Ausmaß an das europäische Parlament gebunden. Auf diese Weise wird eine gemessen an der Bedeutung des Prozesses geradezu rasante Beschleunigung der integrativen Entwicklung ermöglicht. Man kann es ruhig laut aussprechen: Nicht eine der innerhalb der letzten zwanzig Jahre erlassenen Richtlinien wäre verabschiedet worden, wenn sie von der Zustimmung der nationalen Parlamente abhängig gewesen wäre. Wir definieren das Ziel ,,Europäische Integration" als ein durch die ökonomische Globalisierung entstandenes gesellschaftliches Bedürfnis nach Wandel in eine bestimmte Richtung und stellen fest: Das beschriebene rechtliche Verfahren ist zu einer dynamischen Realisierung im positiven Sinn geeignet. Ein kleines Gedankenspiel zur Verallgemeinerungsfähigkeit dieses Prinzips führt zu der allerdings ungewohnten Vorstellung, man würde innerhalb eines Staats, zum Beispiel in Deutschland, in einem bestimmten Rhythmus, alle zwei oder drei oder vier Jahre, gewisse Rahmenkompetenzen auf die Bundesregierung übertragen, die dann während der darauffolgenden Periode in diesem Bereich nach Belieben Gesetze erlassen kann: ,,Die Bundesregierung erläßt nach flüchtiger Anhörung des Parlaments ein Gesetz zur Anhebung der Einkommenssteuer auf 70 Prozent" - eine Variation auf den EU-Vertrag. Nicht ohne Grund jagt diese Vorstellung kalte Schauer den Rücken hinauf und hinunter. Aber aus welchem Grund? Was ist anders am Europarecht, warum darf es so dynamisch sein? Das Europarecht ist eine neuartige Erscheinung in Bezug auf die Anbindung der Rechtsmacht. War bisher in allen staatlichen Systemen die Rechtsetzungsbefugnis Teil der staatlichen Gewalt, so haben wir hier ein System, das zwar als supra-staatlich zu charakterisieren ist, selbst aber keine Staatsqualität besitzt. Die erlassenen Regeln sind nicht solche der Vereinigten Staaten von Europa. Die gibt es nicht. Seit aber das Europarecht vom Europäischen Gerichtshof und den nationalen Verfassungsgerichten als eigene Rechtsordnung anerkannt wird,ist es auch nicht mehr, wie normales Völkerrecht, als Recht der Mitgliedstaaten anzusehen. Es ist also, streng genommen,kein staatliches Recht.Und das, ohne Privatrecht zu sein. Hier eröffnet sich eine Kategorie, die geradezu unwirklich erscheinen muss: die juristische vierte Dimension. Entsprechend wird die momentane Gestalt des Europarechts auch nur als ein Übergangsstadium begriffen, während dessen es sich auf den Fluchtpunkt der EU-Eigenstaatlichkeit zubewegt. Das Recht dient hierbei naturgemäß nicht zur Bewahrung einer (nicht existenten) staatlichen Gewalt, sondern allein zu deren Erlangung; es ist einIntegrationsrechtund damit von Grund auf dynamisch ausgerichtet. Im Moment der Begründung von Staatlichkeit, in dem das europäischeStaatsvolkauf dem Staatsgebieteiner europäischenStaatssouveränitätunterworfen würde (diese drei Kriterien definieren nach klassischer Ansicht den Staatsbegriff), hätten die integrationsfreundlichen, dynamischen Rechtssetzungskonzepte ausgedient. Das Staatsvolk, so die demokratische Idee, lässt sich nur sich selbst unterwerfen und muss bekommen, was des Volkes ist, und zwar durch Mitwirkungs- und Repräsentationsverfahren. Was auf europäischer Ebene zu beobachten ist, muss als einzeitlich begrenzterZustand gedacht werden.
Wie gerne würden wir nun eine These formulieren: ,,Dynamisches Recht ist nicht-staatliches Recht". Vorher drehen wir uns noch einmal auf unserem Aussichtspunkt um uns selbst und spähen ins Land auf der Suche nach einem weiteren Beispiel... Wo bewegt sich was, wo bewegt es sich im nicht traditionell staatlich verregelten Bereich...
Inzwischen weiß jeder, dass http.www. nicht das Geräusch bezeichnet, das man von sich gibt, während man Mitte Januar an einer ungeschützten Bushaltestelle steht. Manche wissen, das www. World Wide Web heißt. Die Juristen wissen, dass das Internet zu den wenigen rechtsfreienRäumen gehört, ein weißer Fleck ist auf der Landkarte der Verregelung. Warum eigentlich? Nun, es ist schwer zu erfassen, irgendwiechaotisch.
Chaos ist das dem Internet zugrundeliegende Konzept. Entwickelt wurde es vom Amerikanischen Verteidigungsministerium als Hilfe bei der Übermittlung, Speicherung und Sicherung von Daten, wobei das Chaosprinzip das hauseigene Intra-Netz vor gezielter Zerstörung sichern sollte. Das Unterbrechen einer Verbindung oder das Zerstören eines der beteiligten Computer hinterließe immer mannigfaltige Verbindungen als Ausweichmöglichkeit und eine Anzahl von Computern, die ebenso schlau sind wie der ausgefallene. Ein chaotischer Zustand, regelfrei und doch friedlich: paradiesisch? Es gibt Bestrebungen, diesen Zustand zu beenden, durch Internetgesetze aus gewohnter Rechtsquelle (Parlament). Wie weiterführend es sein kann, einglobalesSystem durch nationaleGesetzgebung erfassen zu wollen, mag hier dahingestellt bleiben. Hier soll behauptet werden: es gibt bereits Recht im Internet, nur kommt es nicht aus staatlicher Quelle. Die Beweisführung ist schwierig, gerade wegen des Chaos´. Erst einmal soll zwischen zwei unterschiedlichen Funktionen des Internets unterschieden werden. Das Internet ist zum einen, technisch gesehen sogar ausschließlich, einKommunikationsmedium.Als solches erfüllt es eine dem Telephonnetz vergleichbare Funktion. In der Diskussion um die Regelungsbedürftigkeit des Internets geht es in diesem Bereich meist um den Erlass oder die Änderung strafrechtlicher Normen, die zum Beispiel den Vertrieb von illegaler pornographischer Ware über das Internet eindämmen sollen. Derartige Regelungen würden aber gar nicht das Internet an sich betreffen, sondern Verhaltensweisen, die schon immer strafbar waren und auch ohne Internet durchführbar sind. Der zu ordnende Bereich ist hier gar nicht das Internet selbst, sondern enthält nichts anderes als andere Gebiete der Verbrechensbekämpfung auch und soll deshalb in dieser Untersuchung vernachlässigt werden.
Es gibt aber eine zweite Funktion des Netzes: alsgesellschaftlicher Lebensraum. Durch zunehmende mehrdimensionale Vernetzung hat das Internet inzwischen einen Kommunikationsstandard erreicht, der dem sozialen Miteinander innerhalb anderer Diskurssysteme an Komplexität kaum nachsteht. So wie es einen Wirtschaftsverkehr gibt, einen Straßenverkehr, eine politische oder kulturelle oder wissenschaftliche Dimension gesellschaftlichen Lebens, so gibt es nun auch den Internetverkehr oder die Internetdimension, deren Besonderheit ist, dass sie Teile oder besser: Abbildungen sämtlicher sozialer Dimensionen in sich aufgenommen hat. Die Regelungsbedürftigkeit jedes dieser Lebensbereiche ergibt sich aus der Konfliktträchtigkeit menschlichen Miteinanders (auch im Netz kann man sich belügen, betrügen, beleidigen und so fort) und dem daraus entstehenden Bedürfnis nach übergreifenden (staatlichen) Verhaltensgeboten und -verboten. Der soziale Umgang im Internet hat sich bislang frei von solchen Handlungsanweisungen entwickelt. Was hier zu beobachten ist, könnte verglichen werden mit einer Gesellschaft im vorrechtlichen Zustand. Dies kann man leichthin als anarchisch bezeichnen. Man kann aber auch danach fragen, ob nicht Ansätze zu einer Rechtsentwicklung auf ungewohntem Weg zu verzeichnen sind.
Der menschliche Kontakt auf virtuellem Weg ist rein interessengeleitet und gewissermaßen frei von Nebenwirkungen. Der Teilnehmer am Internetdiskurs betritt diesen nicht mit seiner natürlichen, widersprüchlichen und widerständigen Identität, sondern ausschließlich mit einem spezifizierten Interesse, welches ihn ohne Reibungspunkte zu bereits bestehenden oder gerade entstehenden Interessenbündelungen leitet, innerhalb derer es allein um eine entsprechende Bedürfnisbefriedigung geht. Konflikteinnerhalbeiner Interessengruppe sind nicht denkbar, da ein abweichendes Bedürfnis nur zum Verlassen, einer Aufspaltung oder Neugründung der Bündelung führen kann. Entstehende Differenzen werden also selbstregulativgelöst.Zwischenden Interessengruppen sind antagonistische Bestrebungen eher denkbar, aber weniger häufig und leichter beizulegen als im nicht-virtuellen Leben. Erstgenanntes liegt daran, dass es im Internet um den Austausch, die Bereitstellung und Vermittlung von beliebig zu vervielfältigenden Informationen, nicht hingegen um den Umgang mit gegenständlichen und deshalb verbrauchbaren Gütern und Ressourcen geht. Und die Streitschlichtung wird erleichtert durch körperliche Abwesenheit sämtlicher Teilnehmer. Es reduzieren sich psychologische und emotionale Komponenten von Konflikten; körperliche Zwangseinwirkung ist ausgeschlossen, so dass es auch nicht zu entsprechenden Bedrohungen und dadurch ausgelösten Ängsten kommen kann. Vielmehr kann ein Interessengleichgewicht sich ungestört herstellen. Selbstregulierung ist also theoretisch möglich. Findet sie statt? Als Regelbedarf auslösende Konfliktbeziehungen werden gerne folgende populären Internet- Antagonismen zitiert: der Softwarehersteller gegen den Raubkopierer und der digitale Geheimnisträger gegen den Hacker.
Im ersten Fall hat sich ein Verfahren herausgebildet, in dem das ,,Opfer" den ,,Täter" für seine Zwecke benutzt: Zunehmend setzen Unternehmen auf die durch Vervielfältigung und private Weitergabe im Internet erreichte größtmögliche Verbreitung ihres Produkts und den damit erreichten Werbeeffekt. Die Haupteinnahmequelle liegt im Verkauf großer Softwarepakete an größere Betriebe, für die das Produkt individuell umgestaltet wird. Manche Softwarefirmen gehen sogar dazu über, die Produkte kostenlos an Privatkunden abzugeben beziehungsweise das Kopieren ausdrücklich zu gestatten. Eine lohnende Verdienstmöglichkeit besteht dann in den zum Programm gehörenden Servicedienstleistungen (Einführung in das Programm, Wartung, Fehlerbehebung), die aufgrund der Legalisierung der Programmbenutzung von sämtlichen Usern bedenkenlos in Anspruch genommen werden können. Insgesamt kann festgestellt werden, dass keine einzige Softwarefirma bisher an der unlizenzierten Verbreitung ihrer Produkte Pleite gegangen ist.
Nächstes Beispiel. Dem Hacker-Phänomen wurde bisher auf zwei Arten begegnet. Zum einen wurde ein eigener leistungsfähiger Server als ,,Spielwiese" für Hacker eingerichtet. Die dort installierten Firewalls gelten als mindestens so schwer zu bewältigen wie die des Pentagons und absorbieren einen großen Teil datengefährdender Ambitionen. Der typische Hacker hat keine finanziellen oder inhaltlichen Interessen (andernfalls hätte er auch niemals die Zeit gefunden, so brillant zu werden im Programmieren und Überlisten von Programmen), sondern wird von der Herausforderung angezogen. Ebenfalls nicht ohne einen gewissen Humor präsentiert sich die zweite Methode: Hat ein Hacker die Sicherheitsbarrieren überwunden, wird er sofort von der betroffenen Stelle engagiert, um im folgenden seine Fertigkeiten in den Dienst eines besseren Schutzes zu stellen.
Ohne Zweifel wirken solche Maßnahmen ungewöhnlich und unernst. Die beschriebenen Prozesse der Selbstregulierung bergen aber in sich die Möglichkeit, durch dauernde Übung zu einer Kodex-Bildung und schließlich zum Herauskristallisieren von Regeln zu führen. Das wäre dann: Internet-Gewohnheitsrecht.
Nun zeigt sich, was das Internet mit der europa- und völkerrechtlichen Dimension gemeinsam hat: Beide kennen dassoft law, also ein Recht mit herabgemilderter Verbindlichkeit. Im Völkerrecht weisen die Implementierungsstatistiken kaum einen Unterschied auf bezüglich rechtswirksam geschlossener völkerrechtlicher Verträge einerseits und aus Deklarationen und Übung entstandener, nicht durch Repressionen durchsetzbarer ,,weicher" Regeln andererseits. Die rechtliche Qualität dernicht aus staatlicher gesetzgebender Tätigkeithervorgegangenen Regeln des soft law ist inzwischen weitgehend anerkannt. DerenFestschreibungbleibt zudem immer möglich.
Wir stellen uns einen neuen Paragraphen vor: ,,Software ist nicht urheberrechtlich geschützt. An Software kann kein Eigentum entstehen; sie kann nicht Gegenstand entgeltlicher Veräußerungsgeschäfte sein". Eine solche Norm würde mit Sicherheit nicht aus einem üblichen Gesetzgebungsverfahren hervorgehen. Eventuell könnte eine solche Regel aber aus einer Fortentwicklung der oben aufgezeigten Tendenzen entstehen, und möglicherweise wäre sie dann tatsächlich die am besten auf die gegebenen Verhältnisse passende. Auch im Internet erscheint (und das gilt identisch im Völkerrecht) dieDurchsetzbarkeitjeder Norm von vornherein wegen der globalen Dimension äußerst fraglich; auch hier könnte (wie im Völkerrecht) durch ein Nachgeben bei der Strenge in der Handhabung des dem Rechtsbegriff eigentlich immanenten Merkmals derVerbindlichkeitein neuer Weg der Rechtsbildung eröffnet werden. Die so entstehenden Regeln entwickeln sich unmittelbar aus dem gesellschaftlichen Leben, sind sozusagen in einer Eins-zu-Eins-Abbildung Spiegel dieses Lebens selbst und somit in identischem Maß dynamisch. Bis zum Tag ihrer (staatlichen) Festschreibung, möglicherweise.
Wir haben genug gesehen und überlegen, noch heute ins Tal der Erkenntnis aufzubrechen. Vorher eine kleine Bestandsaufnahme gesammelter Eindrü>Erstens: Das Statische am Recht ist seine Staatlichkeit. Zweitens: Es gibt eine Kategorie neben-staatlichen Rechts. Drittens: Dieser Kategorie wohnt die höchstmögliche Dynamik inne. Viertens: Bei einem wünschenswerten Verlauf strebt diese Dynamik immer dem Zustand ihrer Festschreibung (Verbindlichkeit durch Verstaatlichung) entgegen. Fünftens: Deshalb kann dieser Zustand nur als vorübergehend gedacht werden. Sechstens: Das ist gut so. Siebtens: Der Zustand sollte nicht vorschnell künstlich beendet, sondern als erwünscht und notwendig gedacht werden. Achtens: Vom Völkerrecht kann man viel lernen. Letzteres wussten wir schon.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Justitia in Schlaghosen - Zur Frage nach Statik und Dynamik des modernen Rechts"?
Der Text untersucht das Spannungsverhältnis zwischen der vermeintlichen Statik des Rechts und der Dynamik des modernen Lebens. Er hinterfragt, ob das Recht, wie oft behauptet, konservativ ist und wie es sich zu gesellschaftlichen Veränderungen verhält.
Ist das Recht immer konservativ?
Der Autor argumentiert, dass die Aussage von Professor G. ("Das Recht ist immer konservativ") so nicht stimmt. Das Recht kann je nach Kontext und Ursprung sowohl statische als auch dynamische Funktionen erfüllen. Es kommt darauf an.
Welche Rolle spielt die Demokratie bei der Rechtssetzung?
Im demokratischen System, in dem die Rechtsmacht vom Volk ausgeht, kann der Rechtsetzungsprozess durch die Interessenvielfalt und die notwendigen Kompromisse behäbig und verzögernd wirken. Das zentrale Paradoxon ist, dass eine dynamische Gesellschaft schnelles, eindeutiges Recht verlangt, was durch demokratische Prozesse erschwert wird.
Wie wird die Europäische Union (EU) als Beispiel für dynamische Rechtssetzung betrachtet?
Die EU wird als Beispiel für ein System angeführt, in dem die Rechtssetzung aufgrund der geringeren parlamentarischen Beteiligung schneller erfolgen kann. Kompetenzen werden an die EU übertragen, und die EU-Kommission kann Entscheidungen treffen, die nicht direkt von nationalen Parlamenten abhängig sind. Dies ermöglicht eine rasche Integration, wird aber auch kritisch im Hinblick auf die demokratische Legitimation gesehen.
Was ist "nicht-staatliches Recht" und wie manifestiert es sich im Internet?
Der Text argumentiert, dass neben dem staatlichen Recht eine Kategorie "nicht-staatlichen Rechts" existiert, die im Internet beobachtet werden kann. Im Internet entwickeln sich aufgrund der Selbstregulierung innerhalb von Interessengruppen Regeln und Gewohnheiten, die als eine Art "Internet-Gewohnheitsrecht" betrachtet werden können.
Wie funktioniert die Selbstregulierung im Internet in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen und Hacker?
In Bezug auf Urheberrechtsverletzungen im Softwarebereich setzen Unternehmen zunehmend auf die Verbreitung ihrer Produkte durch Raubkopien, da dies einen Werbeeffekt erzeugt. Sie generieren Einnahmen durch den Verkauf von Softwarepaketen an Unternehmen und durch Serviceleistungen. Hacker werden entweder in einer kontrollierten Umgebung ("Spielwiese") beschäftigt oder nach erfolgreichen Angriffen engagiert, um die Sicherheit zu verbessern. Dies sind Beispiele für Selbstregulierung.
Was ist "Soft Law" und welche Bedeutung hat es im Kontext von Internet-Recht und Völkerrecht?
"Soft Law" bezeichnet Regeln mit herabgemilderter Verbindlichkeit, die nicht durch staatliche Gesetzgebung entstanden sind. Im Völkerrecht und im Internet entwickeln sich solche Regeln durch Übung und Deklarationen. Sie können eine wichtige Rolle bei der Rechtsbildung spielen, auch wenn ihre Durchsetzbarkeit begrenzt ist.
Welche Schlussfolgerungen zieht der Autor bezüglich der Dynamik des Rechts?
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass das Statische am Recht seine Staatlichkeit ist und dass neben dem staatlichen Recht eine Kategorie nicht-staatlichen Rechts existiert, die höchstmögliche Dynamik aufweist. Diese Dynamik strebt idealerweise dem Zustand der Festschreibung durch Verstaatlichung entgegen, sollte aber nicht vorschnell beendet werden, da sie für die Anpassung des Rechts an gesellschaftliche Veränderungen wichtig ist.
- Citation du texte
- Juli Zeh (Auteur), 2000, Justitia in Schlaghosen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/101941