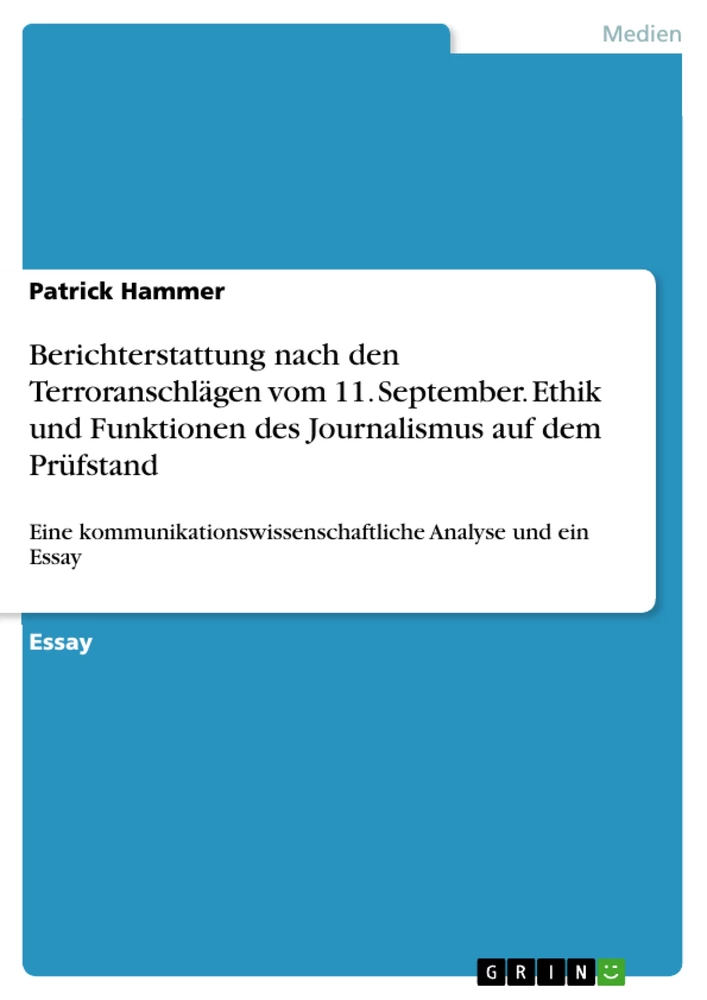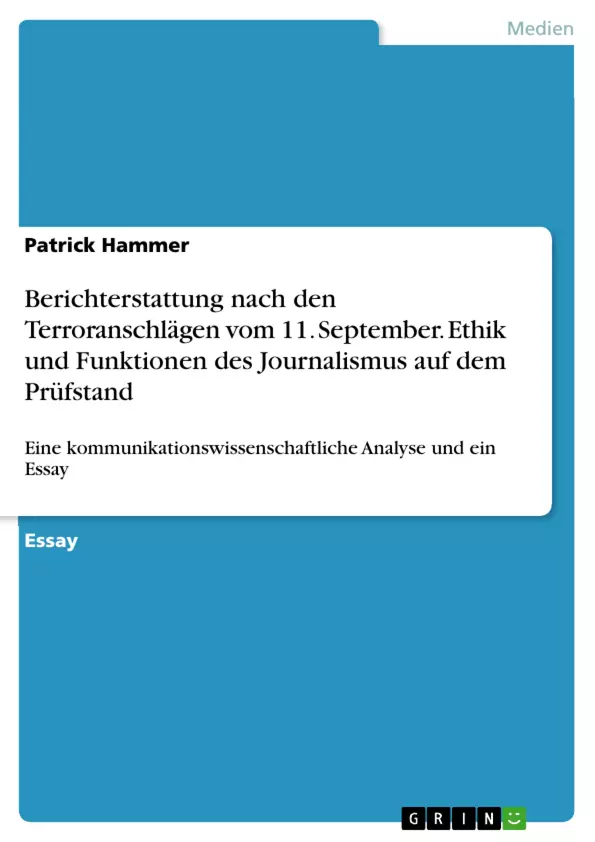Die Terror-Anschläge vom 11. September 2001, als zwei Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Center in New York und ein weiteres in das Pentagon in Washington geflogen wurden - eine der größten Katastrophen innerhalb der USA - führten zu einem nie zuvor da gewesenen Medieninteresse. Nur acht Minuten, nachdem das erste Flugzeug in einen der Türme einschlug, meldete die AP (Associated Press) von der Katastrophe. Nur wenig später sendete der deutsche Nachrichtensender n-tv Live-Bilder des US-Nachrichtensenders CNN. Erstmals konnten auch die Online-Medien ihre Stärken, wie die fortlaufende Aktualisierung unter Beweis stellen. Das große Medieninteresse ist aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht auch damit zu erklären, dass auf die Katastrophe besonders viele "Nachrichtenfaktoren" zutrafen, also Merkmale, die ein Ereignis aufweisen muss, um zur Nachricht zu werden, wie in diesem Falle Außergewöhnlichkeit, Ereignisentwicklung, Eindeutigkeit, Bedeutsamkeit, Überraschung, Elitenationen, Personalisierung (eine Katastrophe, die jeden von uns hätte treffen können), Negativität. Acht der zwölf von Ruhrmann vorgeschlagenen Nachrichtenfaktoren trafen auf die Katastrophe eindeutig zu. So lief nur wenige Stunden nach dem Ereignis auf fast allen TV-Sendern eine einheitliche Berichterstattung, reguläre Programme wurden unterbrochen. Die Konsequenzen des Terror-Anschlags waren in den ersten Tagen noch nicht absehbar, sogar ein dritter Weltkrieg wurde befürchtet. Michel Friedman meinte zu diesem Thema bei einer DJV-Tagung: Anhand des Extremfalls kann auf die Funktionalität des Mediensystems im Normalfall geschlossen werden, der Journalismus stand durch diese Ereignisse auf dem Prüfstand.
Inhaltsverzeichnis
- I. Kommunikationswissenschaftliche Analyse auf Basis der Medienethik
- Einleitung
- Steuerungs- und Reflexionsfunktion der Medienethik
- Medienethische Bewertung
- 1. Individualethik
- 2. Mediensystemethik
- 3. Kollektive Publikumsethik
- II. Essay: Berichterstattung nach dem 11. September
- Einleitung
- Wenn aus Aktualitätsdruck Aktualitätszwang wird...
- Die Macht der Bilder.....
- Terminologie......
- Selbstzensur und Solidarität ...
- Fazit .....
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Berichterstattung der deutschen Medien nach dem 11. September 2001 aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht und beleuchtet die ethischen Herausforderungen des Journalismus in Krisensituationen. Der Essay befasst sich mit der Frage, ob die Medien ihre Aufgabe im Kontext der Terroranschläge erfüllen konnten.
- Medienethik und ihre Bedeutung für den Journalismus
- Ethische Herausforderungen der Berichterstattung in Krisensituationen
- Aktualitätsdruck und Aktualitätszwang in der Medienlandschaft
- Die Rolle von Bildern in der Berichterstattung
- Selbstzensur und Solidarität im Kontext von Terroranschlägen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Kommunikationswissenschaftliche Analyse auf Basis der Medienethik
Der erste Teil des Textes analysiert die Berichterstattung nach dem 11. September 2001 im Lichte der Medienethik. Dabei wird die Steuerungs- und Reflexionsfunktion der Medienethik erläutert und deren Bedeutung für die Bewertung von journalistischen Entscheidungen hervorgehoben. Die Analyse konzentriert sich auf drei Ebenen der Medienethik: Individualethik, Mediensystemethik und kollektive Publikumsethik.
1. Individualethik
Die Individualethik befasst sich mit den ethischen Entscheidungen, die der einzelne Journalist im Rahmen seiner Berichterstattung trifft. Der Text beleuchtet die Herausforderungen des Aktualitätszwangs in den ersten Stunden nach dem Attentat, die Gefahr der Sensationalisierung und die problematische Vorverurteilung in der Berichterstattung. Zudem werden die ethischen Implikationen der Zensur und Propaganda durch die Kriegsparteien diskutiert.
2. Mediensystemethik
Der zweite Abschnitt widmet sich der ethischen Verantwortung des Mediensystems als Ganzes. Der Text beleuchtet die Rolle des Mediensystems als Korrektiv für ethische Fehlleistungen des einzelnen Journalisten und als eigenständige ethische Instanz. Zudem werden die Reaktionen der deutschen Medien auf die Anschläge, wie beispielsweise Solidaritätsbekundungen und Schweigeminuten, sowie die problematische Selbstzensur in den USA im Kontext von übertriebenem Patriotismus thematisiert.
3. Kollektive Publikumsethik
Der dritte Teil des Kapitels behandelt die Rolle des Publikums in der ethischen Bewertung der Berichterstattung. Der Text betont die Wichtigkeit eines kritischen Umgangs mit den Medien und deren Inhalten. Es wird jedoch auch die Schwierigkeit einer kritischen Meinungsbildung aufgrund der gleichförmigen Berichterstattung in der ersten Zeit nach dem Attentat angesprochen.
Schlüsselwörter
Der Text fokussiert auf die Themen Medienethik, Journalismus, Berichterstattung, Terrorismus, 11. September, Aktualitätsdruck, Sensationalismus, Vorverurteilung, Selbstzensur, Solidarität, Kritik, Kontrolle, Publikumsethik und Medienverweigerung.
- Citation du texte
- Patrick Hammer (Auteur), 2001, Berichterstattung nach den Terroranschlägen vom 11. September. Ethik und Funktionen des Journalismus auf dem Prüfstand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1019