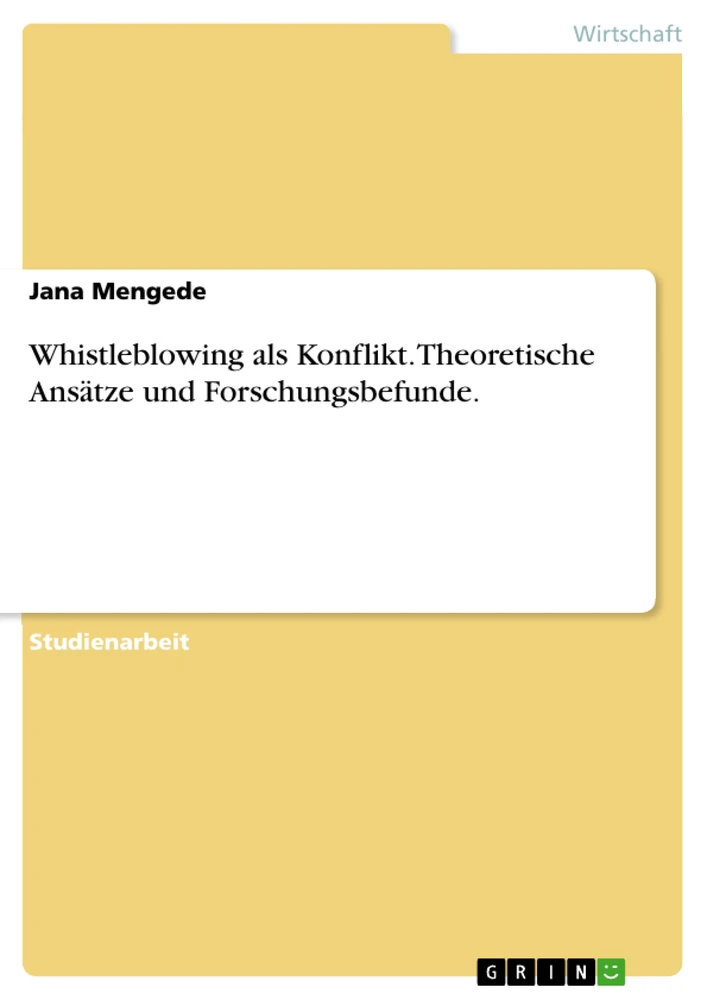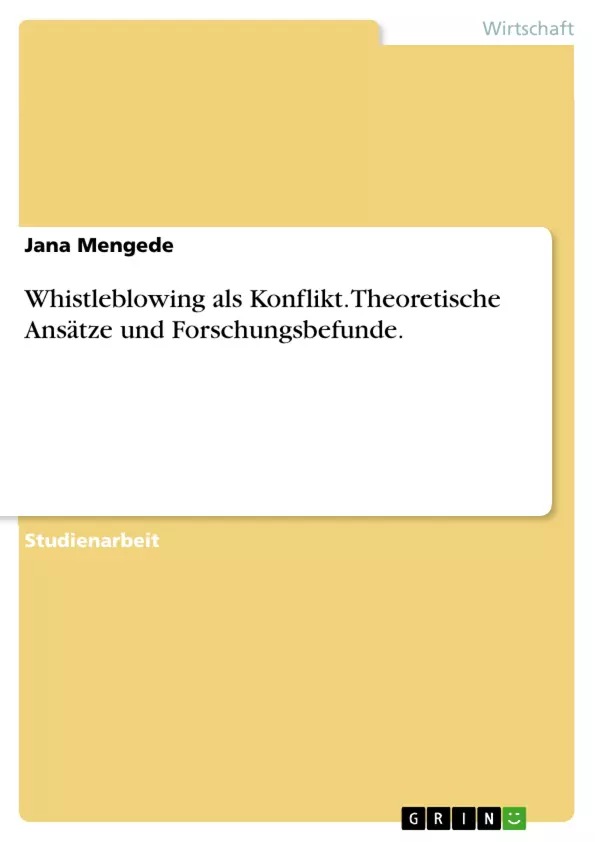Die Hausarbeit beschäftigt sich mit theoretischen Ansätzen und Forschungsbefunden zum Thema Whistleblowing. Sie beschreibt und bewertet, inwieweit die aktuellen Erkenntnisse der Wissenschaft von Unternehmen und Führungskräften dazu genutzt werden können, Whistleblowing zu beeinflussen.
Der Theologe und Ökonom Oswald von Nell-Breuning wies bereits im Jahr 1958 in einer seiner zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema Wirtschaftsethik darauf hin, dass die Wirtschaft neben den materiellen auch die immateriellen Bedürfnisse der Marktteilnehmenden zu befriedigen und dabei die menschliche Würde zu beachten hat. Der Mensch dürfe nicht "zum Diener der größtmöglichen Reichtumsvermehrung gemacht" werden.
Eine funktionierende Wirtschaftsethik kann es demnach nur dann geben, wenn das Handeln aller Marktteilnehmer ethisch ist und Antworten auf die zentralen Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit und den Umgang mit sozialer Ungleichheit gefunden werden. Im Zuge der Globalisierung steht die Wirtschaftsethik dabei allerdings vor der Herausforderung, dass sie das gesamte wirtschaftliche Handlungsfeld reflektieren muss und zwar sowohl geografisch als auch interkulturell. Inwiefern ist dieser Anspruch also überhaupt umsetzbar?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsbefunde
- 2.1 Wirtschaftsethik - Einführung zum aktuellen Diskussionsstand
- 2.2 Whistleblowing
- 2.2.1 Begriffsdefinition
- 2.2.2 Determinanten
- 2.2.3 Wertekonflikt: Gerechtigkeit vs. Loyalität
- 2.2.4 Handlungsempfehlungen der Ethics & Compliance Initiative
- 3. Whistleblowing-Systeme in der Praxis
- 3.1 Begriffsdefinition: Compliance
- 3.2 Elemente eines Compliance-Programms
- 3.3 Funktionale Parameter eines Whistleblowing-Systems
- 3.3.1 Einbezogener Personenkreis
- 3.3.2 Verortung der Whistleblowing-Stelle
- 3.3.3 Vertraulichkeit, Anonymität und Schutz vor Vergeltung
- 3.3.4 Kommunikationsmittel des Whistleblowing-Systems
- 3.3.5 Definition und Kommunikation einer Whistleblowing-Policy
- 3.3.6 Ablauf der Prüfung von Hinweisen
- 3.4 Exkurs: Kritische Loyalität
- 4. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Whistleblowing im Kontext von Unternehmensethik und Compliance. Sie analysiert die theoretischen Ansätze und Forschungsbefunde zu Whistleblowing und untersucht die Funktionsweise von Whistleblowing-Systemen in der Praxis.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Whistleblowing
- Wertekonflikte im Zusammenhang mit Whistleblowing
- Determinanten von Whistleblowing-Verhalten
- Gestaltung und Funktion von Whistleblowing-Systemen in Unternehmen
- Compliance-Management und Whistleblowing
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Edward Snowden als prominenten Whistleblower und führt in das Thema Whistleblowing ein. Kapitel 2 beleuchtet den aktuellen Stand der Diskussion in der Wirtschaftsethik und definiert den Begriff Whistleblowing. Es analysiert die Determinanten von Whistleblowing-Verhalten und den Wertekonflikt zwischen Gerechtigkeit und Loyalität. Kapitel 3 befasst sich mit Whistleblowing-Systemen in der Praxis. Es definiert den Begriff Compliance, beschreibt Elemente eines Compliance-Programms und analysiert die funktionalen Parameter eines Whistleblowing-Systems. Der Exkurs behandelt das Konzept der kritischen Loyalität.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der vorliegenden Hausarbeit sind Whistleblowing, Wirtschaftsethik, Compliance, Wertekonflikt, Determinanten, Loyalität, Gerechtigkeit, Compliance-Management, Whistleblowing-Systeme, Anonymität, Vertraulichkeit, Schutz vor Vergeltung, kritische Loyalität.
- Citar trabajo
- Jana Mengede (Autor), 2020, Whistleblowing als Konflikt. Theoretische Ansätze und Forschungsbefunde., Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020313