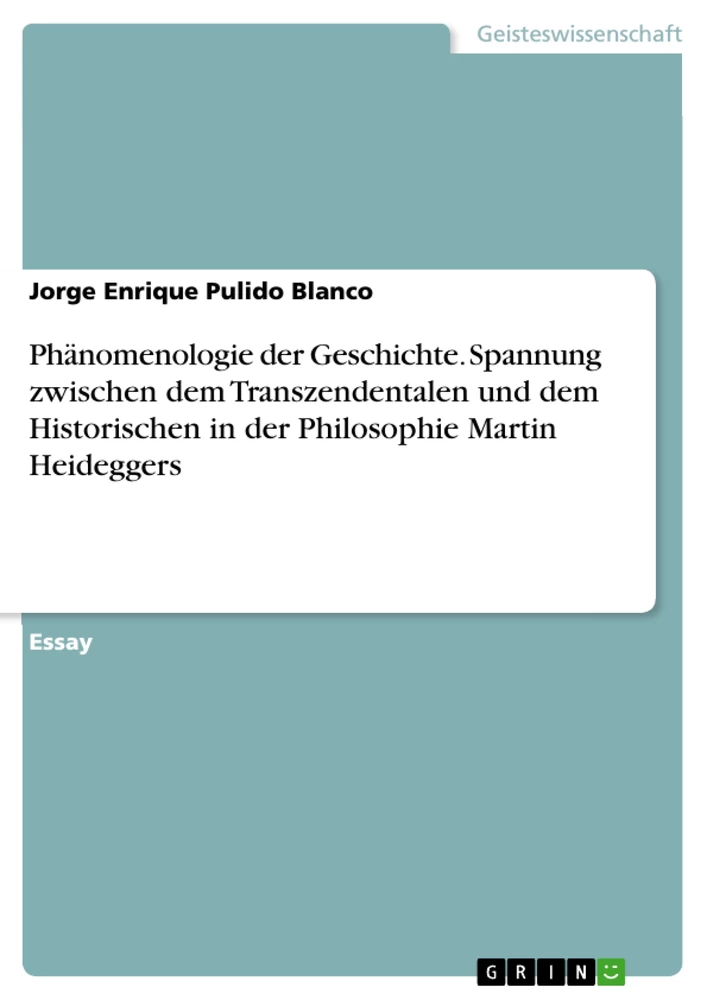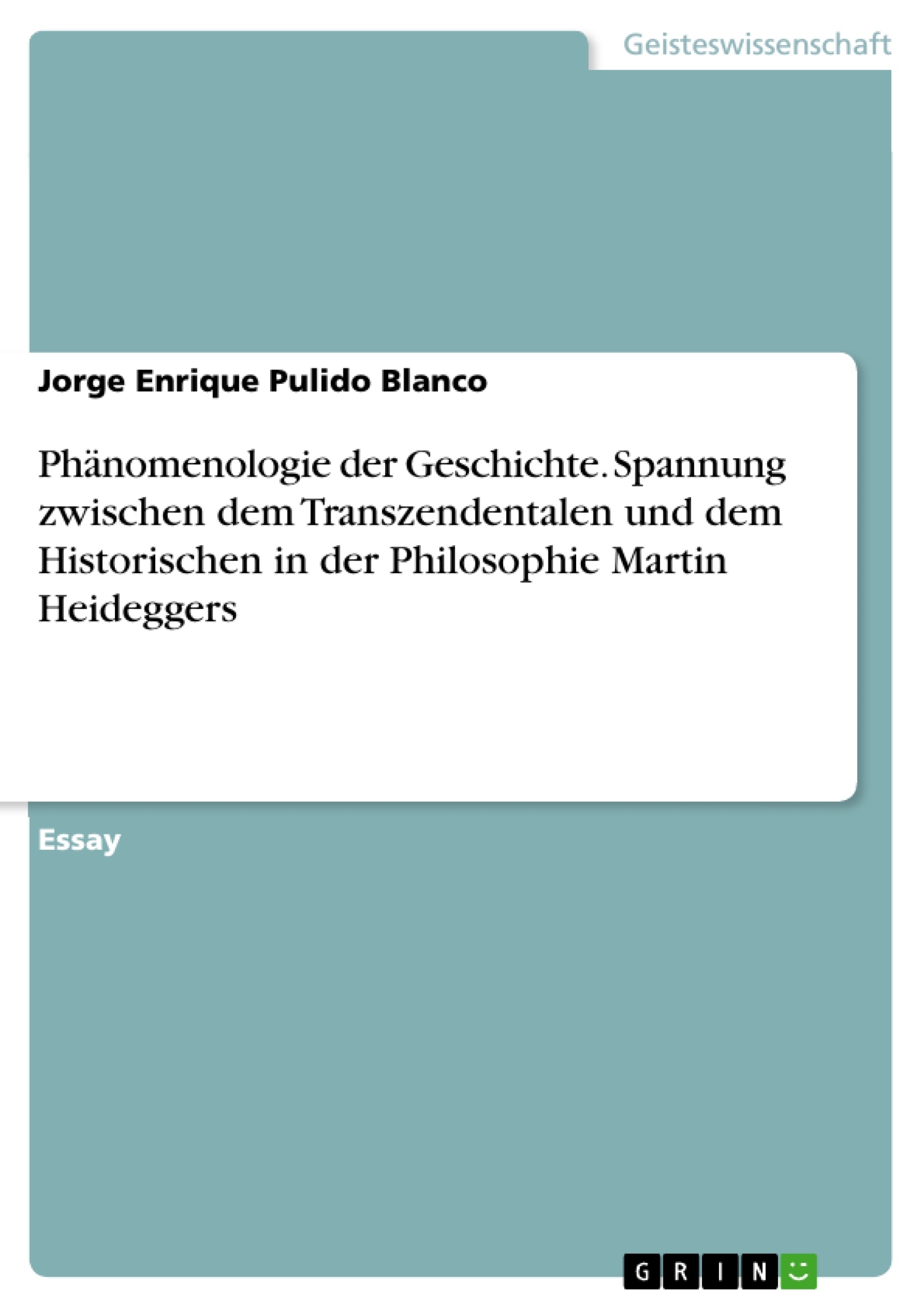Diese Arbeit thematisiert die Phänomenologie der Geschichte. Sie untersucht die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in der Philosophie Martin Heideggers. Tatsächlich fasst Heidegger in "Sein und Zeit" das Phänomen als "das Sichzeigende" von dem, was sich selbst zeigt, auf. Das Phänomen ist reine Aufweisung. In diesem Sinne setzen Verstellung, Verbergung beziehungsweise Schein nicht nur das Phänomen voraus, sondern sind ferner privative Arten, die durch die Struktur vom Sich-an-ihm-selbst-zeigen ermöglicht werden. Daraus ergibt sich also, dass Schein die privative Modifikation von Phänomen ist.
Wir verstehen die Aufschrift "Phänomenologie" in einem provisorischen Sinn, das heißt, als etwas, womit wir uns ausstatten, um mit dem Ansatz dieses Vorschlages einer philosophischen Forschung zu beginnen; als etwas, was in der eigentlichen Entwicklung der Argumentation Objekt einer berechtigenden Überprüfung werden soll, und schließlich als Hinweis, der auf jeden Fall uns den Vorschuss einer vorherigen Richtung des Weges, den wir einschlagen werden, vorgibt.
Wir glauben damit der Seite des allgemeinen Sinnes der Auslegung, die Heidegger während der Jahre 1920-1930 von der von Edmunds Husserl geöffneten Perspektive gemacht hat, zu entsprechen. Sein Opus Magnum sowie die Unmöglichkeit und Widerstand, auf den seine Redensart in der Suche nach einem Phänomenologiebegriff stößt, fügen sich in diesen provisorischen Charakter der Phänomenologie. Diese andere Seite, das heißt, die Kehrseite von Heideggers Auslegung der Phänomenologie befindet sich in der Dynamik von Verdeckung in der Aufweisung, das heißt, in der Umkehrung von dem Begründungsverhältnis zwischen Phänomen und Schein.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung: Darlegung des Untersuchungsproblems im Licht einer Auseinandersetzung mit der Fachliteratur. Darstellung des Arbeitsplanes.
- Erster Teil: Begründung und Reichweite einer Phänomenologie der Geschichte.
- Erstes Kapitel: Kant und Heidegger über den Begriff des Transzendentalen. Analyse des von Heidegger mit Kant auf der Suche der Umstellungen geführten Dialogs, denen jener die kantische Perspektive unterzieht. Solche Umstellungen zeigen die Notwendigkeit, den Zeitbegriff in eine ursprünglichere Richtung zu verstehen: die Richtung einer Phänomenologie der Geschichte.
- Zweites Kapitel: Das phänomenologische Projekt einer Umwandlung des transzendentalen Horizontes der Seinsfrage in einen historischen Horizont und die Durchführung der Daseinsanalytik. Ich versuche, die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in Bezug auf die Phänomenologie der Geschichte zu analysieren, indem ich den Standpunkt von Heidegger einnehme.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in der Philosophie Martin Heideggers im Hinblick auf eine Phänomenologie der Geschichte zu erforschen. Die Untersuchung betrachtet das Fragmentarische von Heideggers Werk „Sein und Zeit“ und die Bedeutung dieses Fragmentes für die Entwicklung einer phänomenologischen Betrachtung der Geschichte.
- Die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in Heideggers Werk
- Die Rolle von „Sein und Zeit“ als Prolog zur Phänomenologie der Geschichte
- Die historische Umwandlung des transzendentalen Horizontes der Seinsfrage
- Die Bedeutung der esoterischen Verträge Heideggers für eine phänomenologische Analyse der Geschichte
- Die Geschichte des Seyns und die Rolle der Anfangsdenker
Zusammenfassung der Kapitel
Erster Teil: Begründung und Reichweite einer Phänomenologie der Geschichte
Erstes Kapitel: Kant und Heidegger über den Begriff des Transzendentalen
Dieses Kapitel analysiert den Dialog zwischen Heidegger und Kant im Hinblick auf den Begriff des Transzendentalen. Heidegger unterzieht Kants Perspektive einer Reihe von Umstellungen, die auf die Notwendigkeit einer ursprünglichen Betrachtungsweise des Zeitbegriffs hindeuten: die Richtung einer Phänomenologie der Geschichte.Zweites Kapitel: Das phänomenologische Projekt einer Umwandlung des transzendentalen Horizontes der Seinsfrage in einen historischen Horizont und die Durchführung der Daseinsanalytik
Dieses Kapitel befasst sich mit Heideggers philosophisches Projekt einer Transformation des transzendentalen Horizonts der Seinsfrage in einen historischen Horizont. Es analysiert die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen im Kontext der Daseinsanalytik und zeigt auf, wie dieses Spannungsverhältnis in Bezug auf die Phänomenologie der Geschichte zu betrachten ist.Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Philosophie Martin Heideggers, insbesondere der Phänomenologie, der Ontologie, der Geschichte, der Zeit, des Transzendentalen und des Historischen. Weiterhin spielen wichtige Begriffe wie Dasein, Ereignis, Seyn, Anfangsdenker und Metaphysik eine entscheidende Rolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser philosophischen Untersuchung?
Die Arbeit thematisiert die Phänomenologie der Geschichte und untersucht die Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in der Philosophie von Martin Heidegger.
Wie definiert Heidegger den Begriff „Phänomen“ in „Sein und Zeit“?
Heidegger fasst das Phänomen als „das Sichzeigende“ auf, also das, was sich selbst zeigt. Es wird als reine Aufweisung verstanden.
Welche Rolle spielt Immanuel Kant in Heideggers Geschichtsphilosophie?
Die Arbeit analysiert einen Dialog zwischen Heidegger und Kant, in dem Heidegger Kants Transzendentalbegriff umstellt, um den Zeitbegriff in Richtung einer Phänomenologie der Geschichte zu entwickeln.
Was wird unter der „Daseinsanalytik“ in diesem Kontext verstanden?
Die Daseinsanalytik dient dazu, den transzendentalen Horizont der Seinsfrage in einen historischen Horizont umzuwandeln und so die Geschichte des Daseins zu erschließen.
Was bedeuten die Begriffe „Seyn“ und „Anfangsdenker“ in der Arbeit?
Diese Begriffe beziehen sich auf Heideggers spätere Philosophie und die Suche nach einem ursprünglichen Verständnis von Geschichte jenseits der klassischen Metaphysik.
- Citar trabajo
- Jorge Enrique Pulido Blanco (Autor), 2019, Phänomenologie der Geschichte. Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen in der Philosophie Martin Heideggers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021023