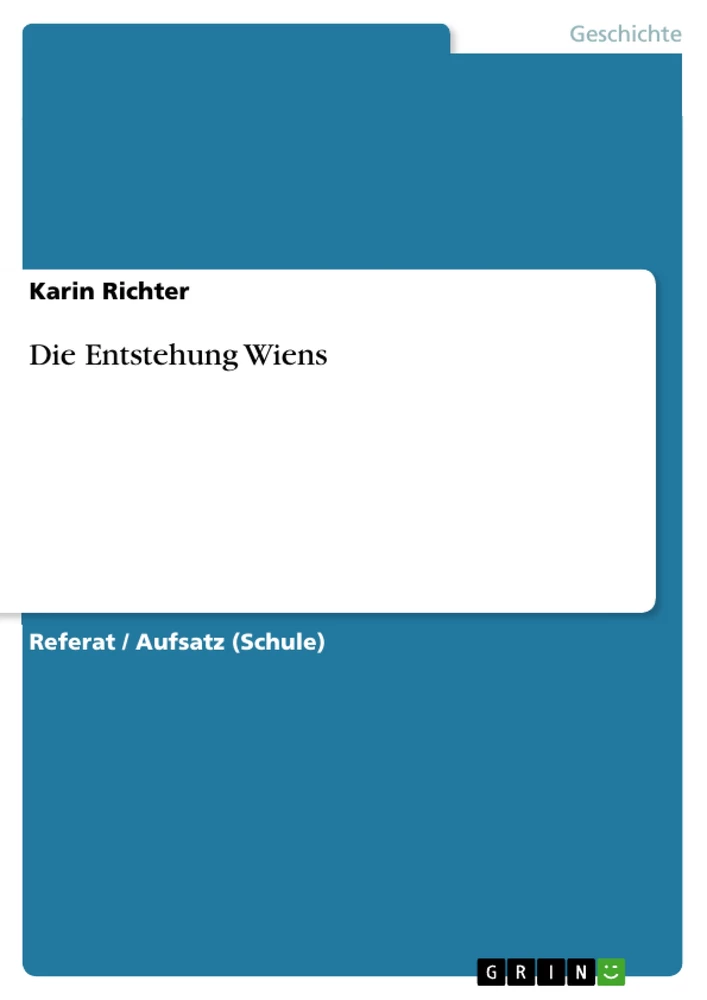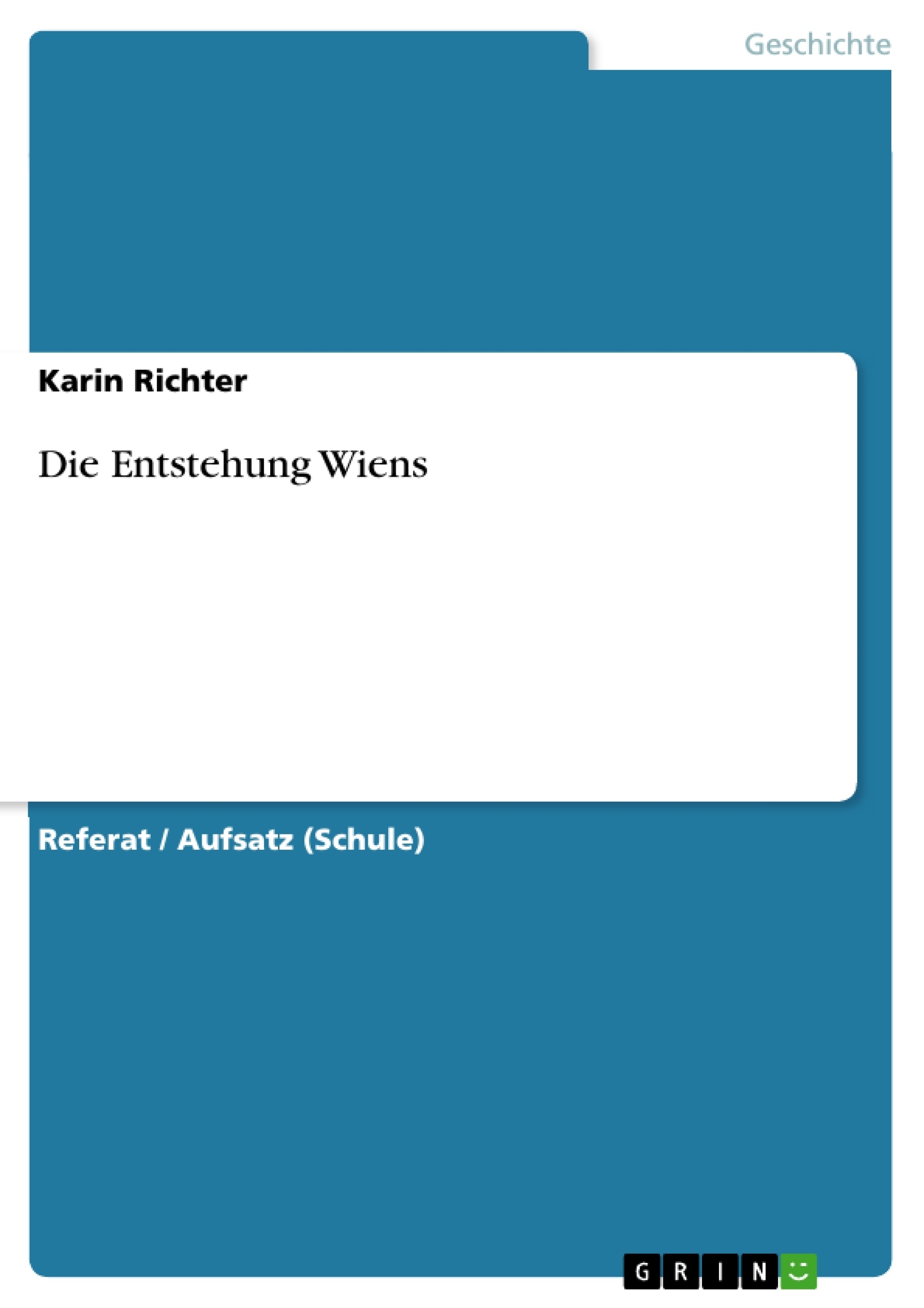Entstehung Wiens
Der Wiener Raum gehörte im vorchristlichen Jahrhundert zum Gebiet des keltischen Stammes der Boier. Nach einer Niederlage gegen die Daker wanderten die Boier teilweise ab, sodass wohl eine Siedlungsverdünnung eintrat. Im 1. Jahrhundert n. Chr. kam es hier zur Anlage eines römischen Militärlagers namens ,,VINDOBONA" -> keltischen Ursprungs. Kaiser Trajan kann als eigentlicher Gründer des Kastells von Vindobona gelten. Ein Grund für die Römer das sie Vindobona errichteten waren die wichtigen Handelswege: Bernsteinstraße, Donau. Von allen Anfang an wurde das Lager in Steinbauweise errichtet. Bis heute hat sich der Umriss der Außenmauern des Lagers erhalten (Graben, Naglergasse, Tiefer Graben, Front am Donaukanal oberhalb des Salzgries, Rotgasse, Kramergasse). Der Bau des Lagers machte noch andere Anlagen, wie Wach- und Signaltürme und wahrscheinlich sogar einen Brückenkopf, erforderlich. Das Straßennetz, dessen Hauptverkehrsadern schon unmittelbar nach der Besetzung entstanden sein müssen, erfuhr jetzt einen weitere Ausgestaltung. Die entlang der Donau verlaufende Limesstraße wurde mit dem neuen Lager so verbunden, dass dessen Hauptstraße einen Teil davon bildet. (heutige: Simmeringer- Landstraßer Hauptsraße, Sensengasse, Währingerstr., Votivkirche). Die Tatsache, dass Vindobona Legionärslager wurde, bedingte der Entstehung der Lagervorstadt (Schottenkreuzung) und gab der Entwicklung der Zivilstadt(3.Bez) einen starken Auftrieb. Der Wohlstand wuchs und führte nicht nur zur Ausgestaltung der Stadt, sondern auch zu ihrer Ausdehnung. Zu den Neubauten die nun entstanden, zählte der große, mit einer ansehnlichen Badeanlage versehenen Gebäudekomplex zur Neustadt gehörenden Häuser (Rennweg, Oberzellergasse, Landstraßer Hauptstr. anderseits Rennwegkaserne). Ab den 4. und 5. Jahrhundert begann für Vindobona ein markanter Niedergang. Durch einen Brandkatastrophe im Legerareal zu beginn des 5. Jahrhunderts war das Ende des Römischen Reiches.
Der Schutz der noch bis ins 13. Jahrhundert fortbestehenden Reste der Lagerbefestigung der Antike wurde weiterhin genutzt. Von einer Stadt oder auch städtischen Strukturen kann keine Rede sein. Für Wien, das noch bis ins 12. Jh. An der Ungargrenze lag begann ein allgemeiner Aufschwung. Um 1200 wurde die ,,Wiener Stadtmauer" (äußeres Zeichen jeder mittelalterlichen Stadt) errichtet und man sprach von Wien als eine der bedeutendsten Städte des Reichsgebietes. Auch die außerhalb der Mauer gelegene Vorstadtzone wurde nun zunehmend verbaut, wobei die Ausfallsstraßen gleichsam die Arterien der Entwicklung darstellten.
Die wirtschaftliche Basis der Stadt lag zum einen in den Handelsbeziehungen, zum anderen im Weinbau. Wein war das wichtigste Exportgut.
1529 standen sodann die Türken vor Wien. Obwohl die Belagerung erfolglos blieb, hatte sie doch tiefgreifende bauliche Veränderungen für Wien zur Folge. Die mittelalterlichen Stadtmauern wurden durch Basteien ersetzt. Das Baugeschehen in der Stadt konzentrierte sich auf Befestigungsbau, zu dem auch die Anlage einer breiten unverbauten Zone rings um die Stadt (Glacis) gehörte. Wien hatte großstädtischen Charakter mit hohen Häusern, engen Gassen und einen pulsierenden städtischen Leben. Im 17. und 18 Jh. kamen viele bedeutende Gebäude hinzu wie Schönbrunn, Hofburg und in den Vororten unzählige Palais und Sommerresidenzen. Durch die Zweite Türkenbelagerung wurde die Stadtmauer und einzelne Gebäude der Innenstadt schwer beschädigt. Die Vorstädte waren ein Trümmerfeld. Das Volk lernte aus diesen Angriff und errichtete den sogenannten ,,Linienwall" um die Vorstädte. Immer noch hielt man am Fortbestand der Stadtmauern fest, obwohl in den anderen europäischen Städten eine wahre ,,Entfestigungswelle" eingesetzt hatte. Im Bereich der Hofburg ließ man damals ein neues Stadttor errichten, dass heute noch das letzte bestehende Denkmal der frühen Begebenheiten ist. Gerade in den Jahrzehnten des sogenannten ,,Vormärz" begann eine Modernisierung der baulichen und infrastrukturellen Gegebenheiten. Diese Epoche war von einer rasant einsetzenden Industrialisierungswelle, verbunden mit gravierenden sozialen Problemen (z.B. Kinderarbeit), und die Erkenntnis einer höchst mangelhafter Infrastruktur (z.B. Wasserleitungen, Kanalisation) geprägt.
Ringstraßen-Ära
1850 kam es zur ersten Erweiterung der Stadt, wobei im wesentlichen die innerhalb des Linienwalls gelegene vorstädtische Zone eingemeindet und in Bezirke gegliedert wurde.1857 fiel der Entschluss zur Auflassung der städtischen Befestigung. Das nunmehr freiwerdende Bauland wurde sofort in die Planungen einbezogen. Es handelte sich dabei ja nicht nur um den Ort der Stadtmauern selbst, einbezogen wurde vielmehr der gesamte alte militärische Bereich der Befestigung, somit en breiter Gürtel rings um die Innenstadt. Bis heute verbindet man den Namen Wiens international mit den Begriff der ,,Ringstraße", der damals auf diesen Gebiet angelegten Prachtstraße, an der einen Reihe öffentlicher Gebäude entstanden. Geprägt von den damals neuen Baustil des ,,Historismus", entstanden hier Ministerien, Museen, die heutige Staatsoper, das Reichsratsgebäude, in dem heute das österreichische Parlament seinen Sitz hat, die neue Universität und vieles mehr. Bis in die 1780er Jahre hatte man einen größeren Bereich an der Ringstraße weiterhin für militärische Zwecke als Exerzier- und Paradeplatz genutzt.
Bereits in den 1850er Jahren wurde Gas für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung herangezogen, sollte aber erst ab der Jahrhundertwende nach und nach von der neuen Energiequelle Elektrizität abgelöst werden. Eines der Wiener Landschaft am nachhaltigsten beeinflussenden Bauprojekte war ohne Zweifel die 1869-1875 durchgeführte Donauregulierung. Der Fluss hatte im Wiener Raum ein weitverzweigtes System von verschiedenen Wasserläufen gebildet, das erst seit dem späten Mittelalter auf einer Reihe von miteinander kommunizierenden Brücken überquert werden konnte. Die Schifffahrt verfügte mit dem Norden an der Innenstadt vorbeiführenden Arm über eine Anbindung an die Stadt. Nun wurde ein völlige Neues Flussbett gegraben, von dem der Stadtarm als regulierter Donaukanal abzweigte. Die Schifffahrt verlief fortan über den Hauptstrom, kam damit nicht mehr unmittelbar an die Stadt heran, was in der Folge dem Bereich zwischen Donaukanal und Hauptstrom steigende wirtschaftlicher Bedeutung sicherte. Die völlig unzureichende Trinkwasserversorgung der enorm gewachsenen Bevölkerung wurde ebenfalls in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts grundlegend neu gestaltet, indem die erste Wiener Hochquellenwasserleitung, der dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine zweite errichtet wurde. Damit wurde aus einer Entfernung von mehr als 100 km aus dem Voralpengebiet an der Grenze zwischen Niederösterreich und der Steiermark südlich von Wien frisches Quellwasser herangeführt.
Das erste öffentliche Verkehrsmittel war geboren: die Pferdestraßenbahnen. Sie wurde bald für weite Kreise der Bevölkerung unverzichtbar. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann auch die sogenannte Stadtbahn mit um die Vorstädte geführten Linien gebaut. Allgemein kann man in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts von einer deutlichen Baukonjunktur in Wien sprechen. Der Mieter war in stärkster Weise vom privaten Hausherrn abhängig, was zu gravierenden Missständen führte. Kein eigener Wasseranschluss nur am Hausflur, und Bad und Toiletten waren nicht vorhanden. Mit den extremen Höhen der Mieten hing auch das soziale Phänomen der ,,Bettgeher" zusammen. Diese Wohnungssituation war vor allem für den Bereich der Wiener Vorstädte gekennzeichnet und nicht selten bestehen diese Häuser bis heute fort. Dabei gab und gibt es unter diesen Bezirken solche, die von allem Anfang an eher der Oberschicht vorbehalten waren. Hier ist etwa an den Bereich des 4. Bezirks (wieden) mit seiner Massierung an ausländischen Botschaften oder auch an den 8. Bezirk (josefstadt) mit einer wohlhabenderen Bevölkerung, Notaren, Anwälten wie auch höheren Beamten, zu erinnern. Außerhalb der Stadt, in den Vororten trifft man dagegen schon seit der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts regelrechte Villenviertel an. Immer mehr wuchsen Stadtgebiet und Vororte zusammen, viele Probleme konnten von den damals noch zu Niederösterreich gehörenden Gemeinden aufgrund ihres geringeren Steueraufkommens nicht oder nur schwer im Alleingang gelöst werden. Konsequenz aus dieser zunehmend als höchst ungünstig erkannten Situation sollte sodann 1890/92 einen weitere Eingemeindung sein, wobei die Vororte südlich der Donau zu Wien kamen. Im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts (1904) schließlich wurde dann auch das nördlich des Stroms gelegen Floridsdorf, das im Zusammenhang mit der dort vorhandenen Maschinenindustrie einen großen Aufschwung genommen hatte, nach Wien eingemeindet. Die Bevölkerungszahlen Wiens waren weiterhin rasant angestiegen, und das nicht nur als Folge der genannten Eingemeindungen, sondern auch in Folge einer starken Zuwanderung in die Metropole der österreichisch-ungarischen Monarchie.
In den zwanziger und dreißiger Jahren versuchte die sozialdemokratische Regierung die Hauptprobleme der Epoche zu bekämpfen. Im Vordergrund stand dabei die Schaffung von mit Wasser und Toiletten ausgestatteten, lichtdurchfluteten Wohnungen bei denen auch hinsichtlich der gesamten Wohnbauanlage Wert auf entsprechende Grünflächen damit die Verfügbarkeit von Erholungsraum gelegt wurde. Daneben wurden vor allem in den wirtschaftlich so schweren Jahren unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg auch Siedlungsmaßnahmen an den Stadträndern forciert, wobei man nicht zuletzt auch die Möglichkeit der Selbstversorgung aus den kleinen Gärten bei diesen Siedlungshäusern im Auge hatte. Bereits im Oktober 1938 war es zu einer umfassenden Gebietserweiterung von Wien gekommen, wobei man Vorbildern, wie etwa Groß-Hamburg, folgte. 97 niederösterreichische Gemeinden kamen damals zu Wien, die Zahl der städtischen Bezirke (bisher 21) stieg auf 26, die Erweiterung reichte in alle Himmelsrichtungen tief in bisher niederösterreichisches Gebiet hinein, das Stadtgebiet hatte sich verdreifacht. Doch es kam der Zweite Weltkrieg und Wien war zum größten Teil zerstört. Mehr als 20 Prozent des Hausbestandes waren ganz oder teilweise zerstört, beinahe 87.000 Wohnungen unbewohnbar.
Im Stadtgebiet wurden mehr als 3.000 Bombentrichter gezählt, zahlreiche Brücken lagen in Trümmern, Kanäle, Gas- und Wasserleitungen hatten schwere Schäden erlitten. Bereits 1946 beschloss man das sogenannte "Gebietsänderungsgesetz", das die Stadterweiterung von 1938 weitgehend wieder rückgängig machen sollte. Seither umfasst das Stadtgebiet 23 Bezirke, wobei gegenüber der Ära vor 1938 der 22. Bezirk nördlich der Donau und der 23. Bezirk im äußersten Süden des Stadtgebietes nunmehr endgültig zu Wien kamen. Ab den frühen sechziger Jahren erfolgte im städtischen Budget eine deutliche Neuorientierung auf die Förderung des Ausbaus öffentlicher Verkehrsmittel wie auch sozialer Einrichtungen, vor allem solcher auf dem Sektor des Gesundheitswesens. 1966 fasste der Wiener Gemeinderat den Beschluss zur Errichtung einer U-Bahn, von der 1978 eine erste Linie in nord-südlicher Richtung verwirklicht wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das Wiener U-Bahn-Netz bereits stark ausgebaut, verbindet das nördliche Donauufer mit dem südlichen Stadtrand und weist auch schon eine leistungsfähige West-Ost-Verbindung quer durch die Stadt auf. Im Bereich des Krankenhausbaus ist vor allem auf den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses hinzuweisen. Die medizinische Versorgung der nördlich der Donau gelegenen Stadtteile ist seit der erst in den 1990er Jahren erfolgte Fertigstellung eines weiteren Krankenhauses, des "Sozialmedizinischen Zentrums Ost (SMZ-Ost)" deutlich verbessert worden. Große Bauvorhaben, die in den Jahrzehnten seit 1945/55 verwirklicht worden sind, sind als für die Stadtentwicklung wesentlich ebenfalls anzuführen: Dabei ist vor allem die tiefgreifende Umgestaltung des Donauraumes zu erwähnen, der ja 1875 eine erste radikale Veränderung erfahren hatte. Beinahe hundert Jahre danach, 1972, begann man mit neuen Baumaßnahmen. Dabei wurde im sogenannten "Überschwemmungsgebiet", dem breiten Uferstreifen am nördlichen Flussufer, ein neues Flussbett gegraben und zugleich eine Insel, die "Donauinsel", aufgeschüttet. Damit gelang es nicht nur, die stets vorhandene Bedrohung durch Hochwassergefahr zu bannen, man gewann damit auch ein völlig neues Erholungsgebiet für die städtische Bevölkerung. Mit dieser Neugestaltung untrennbar verbunden ist auch die Errichtung der UNO-City am Nordufer der Donau. Bereits seit den fünfziger Jahren war es zur Niederlassung internationaler Organisationen in Wien gekommen (1956: Internationale Atomenergiekommission/IAEO; 1965: Organization of Petrol exporting Countries/OPEC; 1967: UNIDO). Mit der Eröffnung des UNO-Gebäudes am nördlichen Donauufer im Jahre 1979, wenig später auch des Internationalen Konferenzzentrums, wurde Wien neben New York und Genf zur dritten UNO-Stadt der Welt. Die zur Zeit des Bestehens des "Eisernen Vorhangs" stets gegebene Funktion der Stadt als Brücke aus dem Westen in die kommunistischen Länder Osteuropas hat sich seit 1989 überlebt, Wien hat hier einiges an Bedeutung eingebüßt, es muß nun versuchen, sich im Wettstreit mit starken Konkurrenten (etwa Prag oder Budapest) zu behaupten. Andererseits hat sich seit 1994/95 mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ein neues Tor geöffnet, die Eingliederung des Landes, aber eben auch Wiens in die anfangs wirtschaftliche, jetzt zunehmend aber auch politische Gemeinschaft Europas.
Jetzt zu aktuellen Daten von Wien.
Lage
Österreichs Hauptstadt liegt im Nordosten des Landes. Das Stadtgebiet erstreckt sich beiderseits der Donau, zum Größten Teil jedoch auf dem rechten Ufer. Die Grenze im Westen bildet der Wienerwald, der letzte Ausläufer der Ostalpen, im Süden der wiederaufgeforstete Hügelrücken das Laaer Berges. Nach Nordosten zur Donau hin läuft das Terrain terrassenförmig aus.
Klima
Wien liegt in einer Übergangszone zwischen kontinentalem und ozeanischen Klima, wobei der Westen der Stadt eher ozeanisch geprägt ist d.h. mildes Klima mit häufigen Niederschlägen, der Osten dagegen extremere Temperaturen und geringere Niederschläge aufweist.
Durchschnittstemperaturen: im Winter -1,4 C° im Sommer 20C° ständig weht ein leichter Wind.
Stadtbezirke
Wien besteht aus 23 nummerierten Bezirken, die sich spiralförmig um den 1. Bezirk, die Innere Stadt, gruppieren. Jeder Bezirk hat seine Besonderheiten. So gilt etwa der Dritte Bezirk als Botschaftsviertel, der 9. als Mediziner- und Spitalsviertel, der 12. und 15.Bezirk als Stadtteil der Arbeiter und Rentner. Der 1. Bezirk, von der Ringstraße umgeben, die im 19.Jahrhundert auf der alten Wallanlage errichtet wurde, entspricht der Altstadt. Hier befinden sich die wichtigsten Amtsgebäude und Kulturstätten. Zwischen dem Ring und dem parallel verlaufenden Gürtel liegen die Innenbezirke(3-9), die sich aus den ehemaligen Vorstädten entwickelt haben. Als Außenbezirke (weil außerhalb des Gürtels gelegen) bezeichnet man die Bezirke 10-23, die ehemaligen Vororte.
Bevölkerung
Heute leben 1,65 Mio. Menschen in der österreichischen Hauptstadt. Zur Gründerzeit waren es och 2,1 Mio. Die rückläufigen Bevölkerungszahlen seit dem Ersten Weltkrieg durch Auswanderung und Geburtenrückgang(seit dem 2. Weltkrieg) werden heute durch Zuwanderer aus den Umland vor allem aus Osteuropa und der Türkei zum Teil ausgeglichen (mittlerweile ca. 20% Ausländer)
Wirtschaft
Wien ist das größte Wirtschaftszentrum Österreichs. Mit zahlreichen Banken und Versicherungen(28% des BIP werden hier erarbeitet) nur 16% der hier produzierten Waren stammen aus der Industrie. Stattdessen blühen Handwerk und Gaststättengewerbe: Im Handwerk gibt es vorwiegend(90%) kleine Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten, häufig auch Familienbetriebe. Mehr als 2/3 aller unselbstständig Beschäftigten arbeiten im Dienstleistungssektor.
Verkehr
Ein bedeutender Verkehrsweg war für Wien schon immer die Donau. Seit der Eröffnung des Rhein- Main- Donaukanals verfügt die Stadt nun über den Zugang zu 2 Meeren. Die Häfen wurden bereits ausgebaut.
17km südöstlich des Zentrums liegt der internationale Flughafen Wien- Schwechat ( jährliches Passagieraufkommen: rund 8.5 Mio.)
Drei Hauptbahnhöfe, ein sehr gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz(6 U-Bahnlinien, eine Schnellbahn sowie zahlreiche Straßenbahn- und Autobuslinien) stellen die Beförderung aus der Umgebung und den Verkehrsfluss in der Stadt sicher.
Tourismus
Ca. 7 Mio. Übernachtungen im Jahr, davon 6,2 Mio. Ausländer (Deutsche (23%) Italiener, Amerikaner, Japaner). Insgesamt verfügt die Stadt über 37.000 Gästebetten in rund 400 Hotels, Pensionen und Appartements. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Touristen beträgt 2,5 Tage.
Kultur
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ursprung des Namens "Wien" und wie entstand die Stadt?
Der Wiener Raum war ursprünglich von dem keltischen Stamm der Boier besiedelt. Im 1. Jahrhundert n. Chr. errichteten die Römer hier ein Militärlager namens "Vindobona", das keltischen Ursprungs war. Kaiser Trajan gilt als der eigentliche Gründer des Kastells. Die Römer wählten diesen Ort aufgrund wichtiger Handelswege wie der Bernsteinstraße und der Donau. Das Lager wurde von Anfang an in Steinbauweise errichtet, und der Umriss der Außenmauern ist bis heute erhalten geblieben.
Welche Rolle spielte Vindobona in der Römerzeit?
Vindobona wurde ein Legionärslager, was zur Entstehung einer Lagervorstadt und zur Entwicklung einer Zivilstadt führte. Der Wohlstand wuchs, und die Stadt dehnte sich aus. Im 4. und 5. Jahrhundert begann jedoch ein Niedergang, der durch eine Brandkatastrophe im Legerareal und das Ende des Römischen Reiches beschleunigt wurde.
Wie entwickelte sich Wien im Mittelalter?
Die Reste der römischen Lagerbefestigung wurden weiterhin genutzt. Um 1200 wurde die "Wiener Stadtmauer" errichtet, was Wien zu einer bedeutenden Stadt des Reichsgebietes machte. Die wirtschaftliche Basis der Stadt lag im Handel und im Weinbau, wobei Wein das wichtigste Exportgut war.
Welche Auswirkungen hatten die Türkenbelagerungen auf Wien?
Die Türkenbelagerungen, insbesondere die von 1529, führten zu tiefgreifenden baulichen Veränderungen. Die mittelalterlichen Stadtmauern wurden durch Basteien ersetzt, und um die Stadt wurde eine breite un bebaute Zone (Glacis) angelegt. Die Zweite Türkenbelagerung beschädigte die Stadtmauer und Gebäude schwer, was zum Bau des Linienwalls um die Vorstädte führte.
Was ist die Ringstraßen-Ära und wie hat sie Wien geprägt?
Nach der Auflassung der städtischen Befestigung im Jahr 1857 entstand die Ringstraße. An dieser Prachtstraße wurden zahlreiche öffentliche Gebäude im Stil des Historismus errichtet, darunter Ministerien, Museen, die Staatsoper und das Reichsratsgebäude. Die Gasbeleuchtung wurde eingeführt, und die Donauregulierung veränderte das Wiener Landschaftsbild nachhaltig. Die Trinkwasserversorgung wurde durch die erste Wiener Hochquellenwasserleitung verbessert.
Wie erfolgte die Eingemeindung der Vorstädte nach Wien?
1850 erfolgte die erste Erweiterung der Stadt durch die Eingemeindung der innerhalb des Linienwalls gelegenen vorstädtischen Zone. 1890/92 wurden die Vororte südlich der Donau und 1904 Floridsdorf nördlich des Stroms nach Wien eingemeindet.
Welche Wohnsituationen herrschten in den Wiener Vorstädten im 19. Jahrhundert?
In den Wiener Vorstädten herrschten oft schlechte Wohnbedingungen, mit kleinen Wohnungen, fehlenden Wasseranschlüssen und Toiletten in den Wohnungen. Das Phänomen der "Bettgeher" war verbreitet. Es gab jedoch auch Bezirke, die von Anfang an der Oberschicht vorbehalten waren.
Welche Maßnahmen ergriff die sozialdemokratische Regierung in den 1920er und 1930er Jahren?
Die sozialdemokratische Regierung versuchte, die Hauptprobleme der Zeit zu bekämpfen, indem sie lichtdurchflutete Wohnungen mit Wasser und Toiletten schuf und Wert auf Grünflächen legte. Siedlungsmaßnahmen an den Stadträndern wurden ebenfalls forciert.
Welche Auswirkungen hatte der Zweite Weltkrieg auf Wien?
Der Zweite Weltkrieg zerstörte Wien zum größten Teil. Über 20 Prozent des Hausbestandes waren ganz oder teilweise zerstört, und zahlreiche Brücken und Versorgungsleitungen wurden beschädigt.
Wie entwickelte sich Wien nach dem Zweiten Weltkrieg?
Nach dem Krieg wurde das "Gebietsänderungsgesetz" beschlossen, das die Stadterweiterung von 1938 weitgehend rückgängig machte. Ab den sechziger Jahren erfolgte eine Neuorientierung auf den Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und sozialer Einrichtungen. Die Errichtung der U-Bahn und der Ausbau des Krankenhauswesens wurden vorangetrieben. Die Umgestaltung des Donauraumes und die Errichtung der UNO-City prägten das Stadtbild.
Wie ist die aktuelle Lage Wiens bezüglich Geografie, Klima und Bezirke?
Wien liegt im Nordosten Österreichs, beiderseits der Donau. Das Klima ist eine Übergangszone zwischen kontinentalem und ozeanischem Klima. Die Stadt besteht aus 23 nummerierten Bezirken, die sich spiralförmig um die Innere Stadt gruppieren.
Wie ist die Bevölkerungsstruktur Wiens heute?
Heute leben etwa 1,65 Millionen Menschen in Wien. Die rückläufigen Bevölkerungszahlen wurden durch Zuwanderer aus dem Umland, vor allem aus Osteuropa und der Türkei, zum Teil ausgeglichen.
Welche Bedeutung hat Wien als Wirtschaftsstandort?
Wien ist das größte Wirtschaftszentrum Österreichs, mit zahlreichen Banken und Versicherungen. Handwerk und Gaststättengewerbe sind ebenfalls bedeutend. Mehr als zwei Drittel aller unselbstständig Beschäftigten arbeiten im Dienstleistungssektor.
Wie ist die Verkehrsinfrastruktur in Wien?
Wien verfügt über eine gute Verkehrsinfrastruktur, mit einem internationalen Flughafen, drei Hauptbahnhöfen und einem gut ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz.
Welche Rolle spielt der Tourismus in Wien?
Wien ist ein beliebtes Touristenziel mit rund 7 Millionen Übernachtungen im Jahr. Die Stadt verfügt über zahlreiche Hotels, Pensionen und Appartements.
Was macht Wien als Kulturstadt aus?
Wien ist eine bedeutende Kulturstadt mit zahlreichen Museen, Theatern, Kinosälen, Bibliotheken und Kabaretts. Die Stadt ist außerdem für ihre Ausbildungsstätten bekannt.
- Citar trabajo
- Karin Richter (Autor), 2000, Die Entstehung Wiens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102120