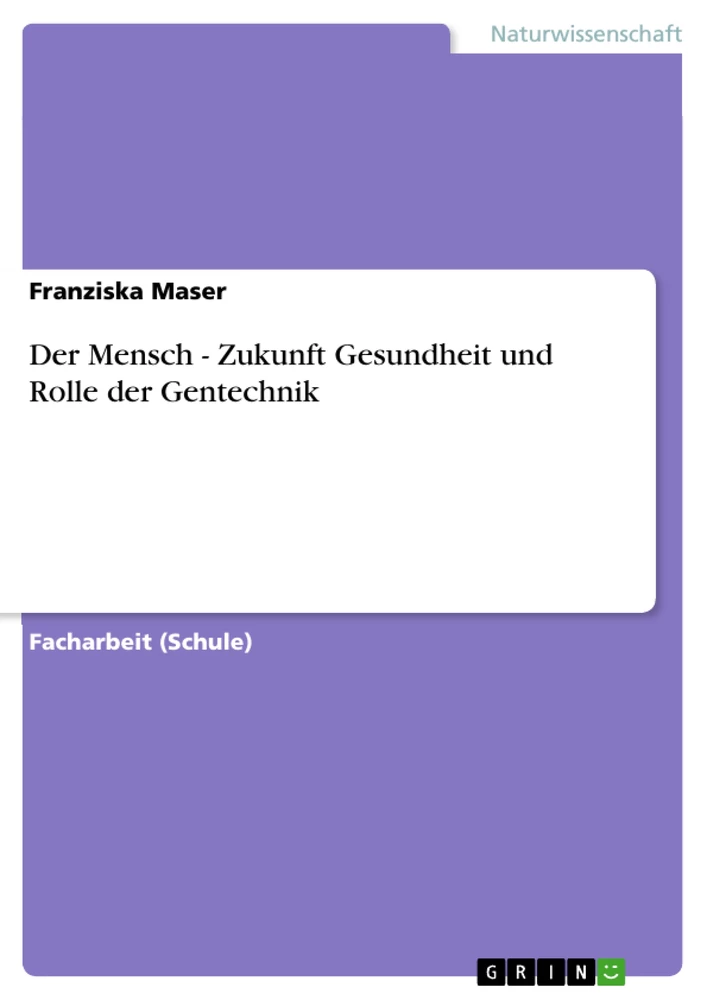Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Grenzen des menschlichen Körpers und Geistes neu definiert werden, eine Welt, in der Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit bedeutet, sondern ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens ist. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine intriguing Reise durch die komplexen und oft widersprüchlichen Landschaften der Gesundheit, von den tiefgreifenden Definitionen des Begriffs selbst bis hin zu den revolutionären Möglichkeiten und ethischen Dilemmata der modernen Gentechnik. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Infektionskrankheiten, von der verheerenden Tuberkulose bis zu den modernen Herausforderungen von Aids und multiresistenten Erregern, und entdecken Sie die entscheidende Bedeutung der Gesundheitsvorsorge in einer zunehmend urbanisierten und umweltbelasteten Welt. Erforschen Sie die Bereiche der körperlichen Fitness, der ausgewogenen Ernährung und der geistigen Ausgeglichenheit als Säulen eines gesunden Lebensstils, und lernen Sie, wie Sie Ihr eigenes Wohlbefinden aktiv gestalten können. Wagen Sie einen Blick in die Zukunft der Medizin, in der die Gentechnik das Potenzial birgt, Erbkrankheiten zu heilen und neue Therapien für unheilbare Leiden zu entwickeln, aber auch ethische Fragen nach der Manipulation des menschlichen Erbguts und der Verantwortung des Einzelnen aufwirft. Diskutieren Sie mit über die ethischen Implikationen von Gentests, Keimbahntherapie und somatischer Gentherapie, und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung zu den drängenden Fragen, die diese bahnbrechenden Technologien aufwerfen. Dieses Buch ist ein fesselnder Leitfaden für alle, die sich für die Zukunft der Gesundheit und die Rolle der Gentechnik in unserem Leben interessieren, und bietet eine fundierte und ausgewogene Perspektive auf die Chancen und Risiken, die vor uns liegen. Es ist eine Einladung, sich aktiv an der Gestaltung einer gesünderen und gerechteren Welt zu beteiligen, in der wissenschaftlicher Fortschritt und ethische Verantwortung Hand in Hand gehen. Entdecken Sie die faszinierenden Möglichkeiten der modernen Medizin und die Bedeutung eines ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses. Erfahren Sie mehr über Krankheitserreger, Immunisierung, Impfungen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Gesundheitswesen, Prävention und Behandlung von Krankheiten werden ebenso thematisiert wie die ethischen Aspekte der Genforschung und Gentechnik. Ein unverzichtbares Buch für alle, die sich ein umfassendes Bild von Gesundheit und Gentechnik machen wollen. Der Gesundheitsbegriff der WHO, soziale Ungleichheit und geistiges Wohlbefinden werden ebenso beleuchtet wie chronische Erkrankungen und die Tuberkulose. Die Gentechnik wird umfassend und leicht verständlich erklärt, von der DNA bis zu Gentests und Keimbahntherapie. Es geht um die Risiken und Chancen der Gentechnik, die Ethik und die Verletzung ethischer Grundsätze.
Inhaltsverzeichnis
1 Gesundheit
1.1 Begriff Gesundheit
1.2 Zitat WHO und Bedingungen für die Gesundheit
1.2.1 Körperliches Wohlbefinden
1.2.2 Soziales Wohlbefinden
1.2.3 Geistiges Wohlbefinden
2 Erkrankungen und Gesundheitsvorsorge
2.1 Begriff Infektionskrankheiten
2.2 Begriff chronische Erbkrankheiten
2.3 Tuberkulose - eine Infektionskrankheit früher und he ute
2.3.1 Erreger und Infektion
2.3.2 Krankheitsbild und Diagnose
2.3.3 Therapie und Vorbeugung
2.3.4 Gesellschaftliche Probleme
2.4 Gesundheitsvorsorge
2.4.1 Bereiche
2.4.2 Maßnahmen
2.4.2.1 Impfungen
2.4.2.2 Ernährung
2.4.2.3 Sport
3 Gentechnik
3.1 Begriff Gentechnik
3.2 Anwendung der Gentechnik auf den Menschen
3.2.1 Gentechnik im Kampf gegen neue Infektions- und alte Volks- 29 krankheiten
3.2.2 Erbkrankheiten
3.2.3 Begrenzung genetischer Risiken durch die Gesetzgebung
3.3 „Neue Menschen braucht das Land“ - Verletzung ethischer 37 Grundsätze durch die Gentechnik?
3.3.1 Gentest und Genetischer Fingerabdruck
3.3.2 Keimbahn- und somatische Gentherapie
3.3.3 Gentechnik in der Öffe ntlichkeit
3.3.3.1 Dezemberdiskussion 2000: Klonen in Großbritannien
3.3.3.2 Persönliche, moralische Bewertung
4 Zusammenfassung
5 Abbildungsverzeichnis
6 Internetadressen
7 Literaturverzeichnis
1 Gesundheit
1.1 Begriff
„Gesundheit ist die schöpfungsmäßig bedingte Harmonie des menschlichen Lebens, die Ordnung der leib - seelischen Kräfte. Sie ist so ein wesentlicher Bestandteil der Menschenwürde und Träger wichtiger Werte im Einzelleben wie im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben der Gesellschaft. Es kann daher für das Individuum wie für die menschliche Gesellschaft kein höheres Ziel geben, als diese Urfunktion des Daseins zu erhalten und zu fö r- dern - ein Grundgefühl, das in der Sehnsucht und Verheißung aller Kulturen nach einem langem Leben zum Ausdruck kommt“(SCHRÖDER, 1950).
In einer Deklaration der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Gesundheit sogar zum Grundrecht erklärt. Zu allen Zeiten war nicht nur die Heilung Kranker, sondern immer auch, Menschen möglichst lange gesund zu erhalten, das Ziel von Ärzten. „Schön ist es, für die Kranken besorgt zu sein, ihrer Gesundheit wegen; viel schöner, für die Gesunden besorgt zu sein, ihres Nichterkranken wegens“ (HIPPOKRATES). Schon seit Alters her war auch be- kannt, dass je nach sozialer Zugehörigkeit, Aufkommen und Verbreitung von Krankheiten unterschiedlich sind. Im 18. Jahrhundert wies Hufeland darauf hin, dass Menschen an sich wesentlich länger leben könnten, wenn nicht die verschiedensten soziologischen und gesund- heitsschädlichen Einflüsse dem Leben zu früh ein Ende setzen würden und sein Zeitgenosse Scherf gab mit seiner Forderung, unter dem Begriff Gesundheit müsse man nicht nur die Ab- wesenheit von Krankheiten, sondern die gesamten körperlichen Kräfte und Fähigkeiten des Menschen auf der höchstmöglichen Stufe ihrer Vollkommenheit verstehen, eine Definition von Gesundheit, die dem Gesundheitsbegriff der WHO gleicht (zit. nach SCHRÖDER, 1950).
Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, nicht allein das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen, aber auch individuelle Lebensverhältnisse sind mit einzubeziehen (z. B. Arbeitsplatz, soziale Kontakte, Wohnqualität). Medizinisch objektive Befunde (Blutdruck, Gewicht, ...), subjektive Empfindungen (Vitalität, Lebensfreude, ...) und soziale Zustände (Einsamkeit, Geborgenheit, Kontakt, ...) müssen ausgewogen sein. Gesund- heit, das heißt körperliche Leistungsfähigkeit, emotionale Ausgeglichenheit, Widerstandsfä- higkeit gegen Infektionen, sozia le Geborgenheit, Beweglichkeit und Fitness, ist also ein Er- gebnis der gesamten Lebensführung. Alle diese Komponenten sind notwendig, um wirklich von einem gesunden Menschen sprechen zu können. Denn man kann diese Begriffe auch ge- trennt voneinander bewerten: Eine Person kann z. B. bei einem Fitnesstest gute Werte erzie- len, obwohl sie gleichzeitig an einer ernsthaften Erkrankung leidet (z. B. Diabetes). Aller- dings bürgt die Auffassung von Gesundheit auch Probleme in sich. Oft wird die Grenze zw i- schen Gesundhe itsbewusstsein und -wahn, wie süchtiges Joggen, Muskelaufbau durch Do- ping, einseitige Ernährung (z. B. Müsliwahn) oder waghalsige Extremsportarten (z. B. Kle t- tern, Ski fahren) nicht mehr erkannt. Deswegen entstanden unter anderem auch Sprichwörter, die sic h auf den körperlichen Gesundheitszustand beziehen, wie z. B.: “Wer sich gesund fühlt, ist nur noch nicht gründlich untersucht worden.“ Am eindeutigsten erklärt was man unter Ge- sundheit versteht das Salutogenese - Modell von AURON ANTONOVSKY. Das Modell ve r- zichtet auf die Unterscheidung zwischen krank und gesund, der Mensch bewegt sich auf der lückenlosen Verbindung zwischen den Polen Gesundheit und Krankheit, mal mehr zu dem einen, mal mehr zu dem anderen Extrem gerichtet. Es gehen auch gesundheitsschütze nde Maßnahmen mit ein, z. B. körperliche Fitness oder soziale Unterstützung. Das sind einige von zahlreichen Gründen, warum man trotz vorhandener Risikofaktoren gesund bleibt. Schmerz und Leid gehören zur menschlichen Existenz.
1.2 Zitat WHO und Bedingungen für die Gesundheit
In der Ottawa - Charta zur Gesundheitsförderung der WHO wurde 1986 die Gesundheitsfö r- derung so definiert: „Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höhe- res Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermö glichen und sie damit zur Stär- kung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und sozia- les Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihr Wünsche und Hoffungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne ist Gesundheit als ein wesent- licher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont, wie die körperlichen Fähigkeiten. „Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente der Gesundheit sind Frieden, an- gemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Ökosystem, eine sorgfältige Behandlung der vorhandenen Energiequellen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Verbesserung der Gesundheit kann nur von einer solchen Basis aus erreicht werden.“
Die Realisierung dieser Ideale und Ziele wird seit jeher angestrebt, konnte aber noch nie verwirklicht werden, da viele Faktoren die Gesundheit jedes Einzelnen beeinflussen. Im Folgenden werden die von der WHO am für wichtigsten gehaltenen Bedingungen für die Gesundheit eines Menschen näher erläutert.
1.2.1 Körperliches Wohlbefinden
Die Gesundheit der Menschen war zu allen Zeiten gefährdet, gewandelt haben sich nur die Ursachen und Anlässe für das Kranksein. Im 14. Jahrhundert starben bei einer Pestepidemie in Europa rund 25 Millionen Menschen (ein Viertel der damaligen Bevölkerung). 1848 fielen in Russland ungefähr eine Million Menschen der Cholera zum Opfer. Um die Wende zum 20. Jahrhundert erlagen in Deutschland jährlich 200.000 Menschen der Tuberkulose (he ute weni- ger als 10.000). Andere Lebensgewohnheiten, geänderte Einstellungen zur Hygiene und die Fortschritte in der Medizin sind Gründe für die Eindämmung dieser Infektionskrankheiten. Doch im 20. Jahrhundert sind Herz- und Gefäßerkrankungen die Pest unserer Zeit. Jährlich gibt es ca. 35.000 Tote in Deutschland. Auch die Zahl der Zuckerkranken ist gestiegen, Ge- lenk- und Wirbelsäulendefekte sind weitere Krankheiten. Dies sind nur einige Beispiele für die vielen Krankheiten, die es gibt, einige von ihnen galten als besiegt, andere sind es und viele kamen neu hinzu oder gibt es nach wie vor. Sie alle greifen die körperliche Gesundheit eines Menschen an, so dass es zu Folgeerscheinungen wie Husten, Fieber, Schnupfen, Zittern, Rötungen der Haut und vielem mehr kommen kann. Die Symptome können ernsthaft gefähr- lich oder einfach nur eine „Herausforderung“ für das Abwehrsystem des Körpers sein. Tatsa- che aber ist, dass auf diesem Wege versucht wird, die Gesundheit durch biologisch - chemi- sche Prozesse zu erhalten. Demzufolge gehören das Eindringen von Fremdkörpern und das Aktivieren des Immunsystems lediglich zu Prozessen, die sich nur auf die körperliche Ge- sundheit oder vollständige Funktionstüchtigkeit des menschlichen Organismus beziehen. Doch das Zitat der WHO sagt eindeutig aus, dass man als Mensch nicht nur gesund ist, wenn der Körper intakt ist, sondern erst, wenn auch Geist und Seele im Einklang mit der Welt sind. Also erst, wenn man sich sozial, geistig und körperlich wohl fühlt, ist man auch wirklich ge- sund.
1.2.2 Soziales Wohlbefinden
Die soziale Komponente spielt daher eine genauso wichtige Rolle in puncto „Gesundheit“ wie der körperliche Aspekt. Doch oft wird mit dem Wort „sozial“ auch soziale Ungleichheit in Verbindung gebracht, deshalb muss man auch in bezug auf die Gesundheit eines Menschen hier Unterschiede mit einbeziehen. Denn vor allem im sozialem Bereich prägen unterschiedli- che Lebensgewohnheiten und -bedingungen den gesundheitlichen Zustand. Trotz hohen Le- bensstandards in den Ländern der westliche n Welt sind ökonomische, ökologische und soziale Bedingungen verschieden und ermöglichen den Menschen jeweils unterschiedlich weite Handlungsspielräume. Dass bestimmte Empfehlungen für eine gesunde Lebensweise nur von Mitgliedern der Oberschicht realisiert werden können, war schon im Altertum bekannt. Man- gel an Nahrung, unzureichende Wohnverhältnisse, Armut, soziale Isolation, Randständigkeit und Einsamkeit sind Stressoren, die das Bewältigungsverhalten erheblich beeinflussen kön- nen. Wenn Menschen wegen einer miserablen Ausgangslage ständig Sorgen haben müssen, ob sie ihren Alltag und die nahe Zukunft bewältigen können, treten Warnungen von Gesund- heitsschäden, die sich erst nach Jahren bemerkbar machen, bei Kosten - Nutzenüberlegungen in den Hintergrund.
„Sowohl kritische Lebensereignisse wie Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit und Tod als auch chronische Rollenbelastungen im Bereich beruflicher Arbeit, in den Partner- und Famili- enbeziehungen nehmen in den modernen Gesellschaften von oberen zu unteren Soziallagen zu“ (STEINKAMP, 1993). Verhaltensweisen wie Rauchen, Alkoholkonsum, Bewegungsar- mut, Fehlernährung, Übergewicht und Schlafdefizite verteilen sich ebenso wie der Gesund- heitsstatus ungleich nach sozialer Klasse, Bildungsgrad, Einkommen , günstigen Wohn- und Umweltbedingungen, sozialer Geborgenheit und Integration“ (BLAXTER, M.; 1990). Aber nicht nur das Gesundheitsverhalten, sondern auch dessen Wirkungen hängen von sozialöko- nomischen Lebensbedingungen ab. Je besser nämlich die Lebensbedingungen von vornherein sind, desto wirksamer sind auch Verhaltensänderungen. Die Gesundheitseffekte unterschied- lichen Verhaltens sind geringer als die unterschiedlicher Lebensumstände (angezeigt durch Berufsgruppe, Einkommen, Wohnen, Stress und soziale Unterstützung). Überhaupt sichert eine gesundheitsbewusste Lebensführung nur ein längeres Leben bei Angehörigen der Mittel- schicht“ (KÜHN, 1993). Unterschichtsangehörige haben zum Teil große Schwierigkeiten, sich gesundheitsbewusst zu verhalten, weil die Addition einer Vielzahl gesundheitsschädi- gender Einflüsse, wie z. B. ungesunde Arbeitsbedingungen, physikalische und chemische Einwirkungen ihrer Umgebung, schlechte Ernährungssituation, finanzielle Unsicherheit, schlechte Wohnsituation, Störungen der Persönlichkeitsentwicklung, so großen Einfluss ha- ben, dass sie nicht durch das individuelle Verhalten zur Vermeidung von gesundheitsschädi- genden Risikofaktoren reduziert werden können.
Der Gesundheitszustand wird auch durch Bedingungen am Arbeitsplatz wesentlich beeinflusst. Dies wurde in einer Studie beschrieben, in der der Zusammenhang zwischen sehr hoher Arbeitsbelastung und der Entstehung chronische Erkrankungen für die Berufgruppe der Schweißer untersucht wurde. Bei den Schweißern treten nämlich nicht nur solche berufsbedingten Erkrankungen auf, die von der Berufgenossenschaft anerkannt werden, sondern bei ihnen entwickelt sich eine Multimorbidität (erhöhte mehrfache Häufigkeit der Erkrankungen) in Folge von Unfällen, Erkrankungen der Atmungsorgane, des Skeletts, des Muskel - und Bindegewebes und der Verdauungsorgane. OPHOLZER (1994) weist ebenso deutlich wie KÜHN (1993) auf den Zusammenhang zwischen Arbeit und Gesundheit hin und nennt als ausschlaggebendes Kriterium die berufliche und soziale Stellung.
Rein statistisch gesehen werden solche Menschen weniger krank und leben länger, die über ein gutes Bildungsniveau verfügen, selbstbewusst sind, einen vertrauten Partner, viel Freude, einen Arbeitsplatz, mit dem sie zufrieden sind und ein ausreichendes Einkommen haben. Doch wie Marc Aurel schon vor 1820 Jahren feststellte: „Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab.“ So kann man daraus ableiten, dass nur der gesund ist, der sich im Inneren seiner Seele auch so fühlt.
1.2.3 Geistiges Wohlbefinden
Demzufolge spielt der geistige Zustand bei dem Thema Gesundheit auch eine entscheidende Rolle. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte dazu eine interessante Untersuchung: „Hochgefühl durch Sport“. Demnach steigert sich das Wohlbefinden nach sportlicher Betätigung um 75 %, man wird um 25 % ruhiger, die Stimmung wird um 20 % gehoben, Erregbarkeit, Ärger, Deprimiertheit, Energielosigkeit sinken um 8 - 13 %. Aber diese positive Folgen können nur unter der Bedingung erreicht werden, wenn Bewegung nicht als Mittel zum Zweck, z. B. zur Gewichtsreduzierung oder als Zwang angesehen wird.
Dies zeigt wie viel von unserem geistigen Zustand abhängt. Wer Wohlbefinden erlebt, kann Stress besser verarbeiten, ist ausgeglichener, besitzt eine positive Einstellung zu seinem Körper, was besonders wichtig ist in der heutigen Arbeitswelt.
Um das Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln, das heißt Anstrengung, Ermüdung oder auch Stärkung zu spüren, kann Sport eine wertvolle Hilfe sein, aber am Ende muss jeder sel- ber wissen, was sein geistiges Wohlbefinden fördert. Für manchen kann dies ein beruhigender Spaziergang in den Sonnenuntergang oder ausgelassenes Tanzen und Lachen bei einer Feier mit Freunden sein. Tatsache ist, dass Menschen denen im stressigen Berufsalltag kein geisti- ger Ausgleich gelingt, häufiger unter Stimmungsschwankungen, Stress oder anderen alltägli- chen Belastungen leiden als Menschen, die in der Lage sind, abzuschalten. Demzufolge sind diese unausgeglichenen Personen auch von einem geschwächten Immunsystem betroffen und anfälliger für Krankheiten. Ihre Gesundheit ist somit mehr gefährdet, als wenn sie „Balance“ in ihr Leben bringen. Nur wer sich auch psychisch wohlfühlt, sei es durch Partnerschaft, Fa- milie, Freunde, einen gesicherten Arbeitsplatz, der Freude am Arbeiten oder der Akzeptanz seiner individuellen Persönlichkeit, kann die Fähigkeit aufbauen, mit im Verlauf des Lebens auftretenden Schwierigkeiten in einer sich aktiv auseinandersetzenden Form umzugehen, sie als Herausforderung begreifen und darüber hinaus notfalls in der Lage zu sein, die Möglich- keiten des sozialen Netzes entsprechend zu nutzen.
Die krankmachenden Faktoren können also nur reduziert werden, wenn auch der geistige Zustand im Einklang mit Körper und sozialem Wohlbefinden sind.
Erst wenn ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens erreicht wurde, ist man gesund. Gesundheit ist also ein Balanceproblem. Man fühlt sich um so gesünder, je besser man mit Stressoren zurechtkommt. Jedoch kann man durch überhöhte Sollwerte auch selber zum Stressor werden. Zum Bewältigen der Stressoren ist die Überzeu- gung des eigenen Lebens und Tuns sowie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten notwen- dig.
2 Erkrankungen und Gesundheitsvorsorge
Solange es ein menschliches Leben gibt, waren und sind Menschen dem Einfluss von Krank- heiten, Verletzungen und Unfällen ausgesetzt. Sogar die Weltgeschichte wurde teilweise von den Krankheitserregern geschrieben. Einer der größten Feldherren aller Zeiten, Alexander der Große, starb nicht in einer Schlacht, sondern im Jahre 323 v. Chr. in Babylon, wahrscheinlich an Malaria. An derselben Krankheit verstarb im Jahre 410 der Westgote Alarich mit vielen Getreuen, was zum Ende der Herrschaft der Westgoten in Rom führte. Viele Italienfeldzüge der deutschen Kaiser des Mittelalters wurden nicht durch Waffen, sondern durch Malariaepi- demien entschieden. Heutzutage erschrecken vor allem Aids oder BSE die Menschen in den Industrienationen, während viele Bewohner von Entwicklungsländern zusätzlich immer noch unter Cholera, Malaria oder Tuberkulose leiden. Aber fast genausolange wie es Krankheiten gibt, existiert auch in den Menschen der Wunsch, diese zu verhindern und ihnen erfolgreich entgegenzuwirken. Demzufolge spielte und spielt die Gesundheitsvorsorge bzw. Prävention eine wichtige Rolle in unserem Leben und wird auf Grund immer neuer Erkenntnisse und Entdeckungen auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Denn durch die kontinuierliche Veränderung des Krankheitsspektrums mit weniger Infektionskrankheiten und chronisch de- generativen Erkrankungen, deren Behandlung kostenintensiv ist, wird der Präventionsgedanke unterstützt. Vorbeugen ist nicht nur besser, sondern auch billiger als Heilen und eine sparsa- me, aber wirkungsvolle Behandlung ist gegenwärtig das Hauptziel der Mediziner.
2.1 Begriff Infektionskrankheiten
Unter Infektionskrankheiten versteht man vereinfacht das Eindringen, das Vorhandensein sowie die Vermehrung von Krankheitserregern im menschlichen Körper, sofern die Immun- abwehr dagegen nicht ausreichend ist. Viele Infektionskrankheiten heilen von selbst aus, eine Reihe ist zur Zeit immer noch nicht heilbar und viele benötigen neben der Gabe von Medika- menten ein gewisses Maß an systematischer Unterstützung wie z. B. Bettruhe, Vitamine oder viel Flüssigkeit. Andere Infektionskrankheiten dagegen bedürfen oft einer intensiven und langandauernden Behandlung, wie z. B. Aids, Hepatitis, Tuberkulose, Malaria oder eine Lun- genentzündung. Die Erreger, die diese und andere Infektionskrankheiten auslösen, sind be- stimmte Mikroorganismen, die in vier Hauptgruppen eingeteilt werden: 1. Bakterien, verant- wortlich z. B. für Mandelentzündungen 2. Viren, die oftmals harmlose Infekte auslösen aber auch für schwere Erkrankungen wie Aids oder Hepatitis verantwortlich sind. 3. Pilze, die z. B. die Schleimhäute oder die Füße befallen und 4. Parasiten wie Würmer, Echinokokkus oder der Bilharzioseerreger.
Für viele Infektionskrankheiten gibt es gute und wirksame Medikamente, wie z. B. Antibiotika. Für andere Erkrankungen, wie z. B. Aids, Ebola oder Creutzfeld - Jacob ist (noch) keine heilende Therapie möglich. Außerdem sind in den letzten Jahren bei einer Reihe von Infektionskrankheiten wie Malaria und Tuberkulose, die man erfolgreich behandeln konnte, Resistenzen gegen die bisher angewandten Antibiotika entstanden.
Die Geschichte der systematischen Erforschung der Infektionserkrankungen beginnt 1876 durch Robert Koch mit dem Nachweis von Bakterien, die den Milzbrand auslösen. Noch viel früher hatte ein niederländischer Linsenmacher Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) durch ein selbstgebautes Mikroskop Mikroben im Speichel beobachtet. In der nachfolgenden Zeit entdeckten verschiedene Forscher immer wieder andersgestaltete "kleine Tierchen", die sie aufs genaueste beschrieben und kategorisierten, aber nicht mit den dazugehörigen Krankhe i- ten in Verbindung brachten. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts glaubte man noch, dass die- se Tierchen spontan entstünden. So sollten aus Käse Maden entstehen und faulender Weizen Mäuse produzieren. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde immer eindeutiger, dass bestimmte Kleinstlebewesen für Verfallsprozesse zuständig waren. Louis Pasteur (1822-1895) wies schließlich nach, dass in gekochtem Wasser nur Mikroorganismen aufzufinden waren, wenn sie nachträglich eingebracht wurden. Seitdem gilt der Grundsatz: Leben kann nur weitergegeben werden, aber nicht "de novo" aus dem Nichts entstehen.
Nach dieser Entdeckung wurden viele Krankheitserreger nachgewiesen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jetzt wusste man zwar, dass die Mikroorganismen Krankheiten auslösen können, es war aber nicht klar, wie sie übertragen werden konnten. Man hatte die Vorstellung von Miasmen (Mi- asma grch. Verunreinigung), die aus dem Boden, aus Sümpfen oder aus den Leichen ausdüns- teten. Malaria (mal aria, ital. schlechte Luft) schien durch Miasmen aus den Sümpfen zustan- de zu kommen.
Der österreichisch - ungarische Geburtshelfer I. Semmelweis erkannte, dass das sogenannte Kindbettfieber vom Leichnam der an dieser Krankheit verstorbenen Wöchnerin auf gesunde Kreißende durch die Hand des behandelnden Arztes übertragen werden kann (1847), wenn er zuerst die Autopsie durchführte und danach die Schwangere untersuchte.
Dies waren die ersten Schritte auf dem großen Sektor der Infektionskrankheiten und ihrer Bekämpfungen, die bis heute nicht an ihrer Aktualität verloren haben.
2.2 Begriff chronische Erkrankungen
Chronisch bedeutet „langsam und lange verlaufend“. Akute Schmerzen z. B. dauern Stunden bis wenige Tage, chronische dagegen mehrere Wochen oder länger. Der Begriff „chronisch“ sollte deswegen erst nach einer Laufzeit von über sechs Monaten verwendet werden. Nach den BAföG Verwaltungsvorschriften ist eine chronische Erkrankung gegeben, wenn die Aus- wirkung einer nicht nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung vorliegt, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand beruht, z. B. Suchtkrankheiten, Leukämie, rheumatoide Arthritis, Autismus oder TBC. Chronische Erkrankungen können genetisch oder psychisch bedingt sein oder durch Krankheitserreger hervorgerufen werden.
2.3 Tuberkulose - eine Infektionskrankheit früher und heute
Ohne jeden Zweifel ließen sich Krankheiten noch nie so wirksam bekämpfen wie im 20. Jahr- hundert. Dennoch sind Infektionskrankheiten wie Diphtherie, Cholera, Typhus, Malaria und Tuberkulose, die lange Zeit kontrollierbar schienen, heute wieder auf dem Vormarsch. Nach dem zweiten Weltkrieg kämpfte man massiv gegen diese Krankheiten an - meist erfolgreich wegen der neuen Wunderwaffe Penicillin. Der Mensch hat sich sehr lange in Sicherheit ge- wägt, die Infektionskrankheiten im Griff zu haben. Doch der allzu sorglose Umgang mit den Antibiotika hat dazu geführt, dass sich viele Resistenzen bei den Erregern ausgebildet haben. Der Zusammenbruch ehemals vorbildlicher Gesundheitssysteme im Osten und wachsende Armut, Hunger und mangelnde Hygiene dort und in den Entwicklungsländern sind zudem ein geeigneter Nährboden für die Verbreitung der Infektionskrankheiten.
Im Folgenden wird am Beispiel der Tuberkulose (TBC - lat. Tuberculosis) eine dieser gefährlichen, wiederkehrenden Infektionskrankheiten näher erläutert.
Noch um die Jahrhundertwende (19. - 20. Jahrhundert)starb in hiesigen Breiten etwa jeder zehnte Mensch an TBC, die Lebenserwartung lag bei ca. 35 - 40 Jahren. Bedingt durch eine erhebliche Bevölkerungsdichte in den Städten zur Zeit der industriellen Revolution, spielte die Tuberkulose für die Sterblichkeit der Menschen, vor allem im 19. Jahrhundert und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, eine große Rolle.
Die öffentliche Aufmerksamkeit und die Betroffenheit der Menschen war sicherlich mit der heutigen bezüglich AIDS vergleichbar. Zusätzlich bekam die Krankheit fast den Rang einer Kulterkrankung, was sich u.a. im „Zauberberg“ von Thomas Mann oder der "Selbstmordpart- nerin" von Heinrich von Kleist, Henriette Vogel, die sich gemeinsam im Jahre 1811 töteten, dokumentierte. Lange wurde, ähnlich wie in den Anfängen der Aidserkrankung, über die Ur- sachen gestritten. Wobei zuerst die vorherrschende Meinung war, dass Tuberkulose eine sozi- ale Erkrankung sei, also eine Folge der Wohn- und Lebensbedingungen der einfacheren Volksschichten.
Auch eine Erblichkeit wurde erwogen. Im Jahre 1882 beendete Robert Koch in Berlin diese Diskussion mit der Entdeckung des Tuberkel - Bakteriums. Die Bekanntgabe seiner mikroskopischen Entdeckung leitete Koch mit folgenden Worten ein: „Wenn die Zahl der Opfer, welche eine Krankheit fordert als Maßstab für ihre Bedeutung zu gelten hat, dann müssen Infektionskrankheiten, Pest, Cholera u. s. w. weit hinter der Tuberkulose zurückstehen. Die Statistik lehrt, dass 1/7 aller Menschen an Tuberkulose stirbt“. Aber erst rund 40 Jahre später stand ein wirksamer Impfstoff für die Menschen zur Verfügung.
In den 70er Jahren dieses Jahrhunderts glaubte man, dass die Tuberkulose besiegt sei und zumindest für die erste Welt keine Rolle mehr spielen würde. Diese Hoffnung trog. Seit den 80er Jahren ist ein starker Anstieg von Tuberkulose - Erkrankungen und -Todesfällen in den Industrienationen, bedingt durch HIV und Immigranten aus der dritten Welt und Osteuropa, zu verzeichnen. In der dritten Welt spielt Tuberkulose nach wie vor eine große Rolle für die Sterblichkeit der Menschen und vor allem auch in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist ein dramatischer Anstieg in den letzten Jahren zu erkennen.
Aber auch heute spielt die soziale Komponente immer noch eine wichtige Rolle, da gut ernährte Menschen ungleich seltener an Tuberkulose erkranken als unterernährte Menschen in schlechten sozialen Verhältnissen.
2.3.1 Erreger und Infektion
Die Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien übertragen wird.
Als Bakterien bezeichnet man einzellige Mikroorganismen, die einen für Prokaryonten typi- schen Zellaufbau aufweisen. Sie besitzen eine feste Zellwand, aber keinen Zellkern, sondern einen freien DNA - Doppelstrang (Plasmidring). Sie sind meistens zwischen 0,2 µm und 2,0 µm groß. Es gibt unterschiedliche Formen der Bakterien, dadurch ergibt sich auch die Klassi- fikation:
Kokken (Kugelbakterien), Abb. 1, Stäbchenförmige, Abb. 2, Schraubenförmige (Spirochäten und Spirillen), Abb. 3.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Rundliche Bakterien bezeichnet man als Coccen. Sie können in linearen Kolonien vorkommen (Streptococcen) oder haufenförmig (Staphylococcen). Hier sind Streptococcen abgebildet (blau coloriertes Bild).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Stäbchenförmig sind Pneudomonaden wie Pseudomonas aeruginosa oder alle Bacillen und z. B. E.Coli, das Darmbakterium der Säugetiere (grün coloriertes Bild).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Hier ist der Endoparasit Campylobacter jejuni zu sehen, ein spiralförmigs Bakterium, das Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber hervorruft.
Weiterhin können die Bakterien durch Färbemethoden unterschieden werden. Dabei unterscheidet man in gramnegative und grampositive Zellen. Die unterschiedliche Färbbarkeit hängt von der Zusammensetzung der Zellmembran ab.
Als Übertragungswege kommen verschiedene Möglichkeiten in Frage, wie z. B. nachfolgend aufgeführt:
Luft (Tuberkulose), Wasser (Typhus), Tröpfchen (Windpocken), Blut (HIV), Stuhl (Cholera), Urin (Zytomegalie), Sekrete (z. B. Tollwut).
In den meisten Fällen der Tuberkulose ist der Erreger das Mycobacterium tuberculosis, selten (0,1 % aller Tuberkulose - Infektionen) auch Mycobacterium bovis, das hauptsächlich von Rindern auf den Menschen übertragen wird (Milchfunktion).
Beide Mykobakterien sind säure- und alkoholfeste, schlanke, gerade oder gebogene, grampositive, 0,2 - 0,5 x 1 -5 µm große Stäbchenbakterien. Bei intaktem Immunsystem erkranken nur ca. 3% der Infizierten an Tuberkulose, bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem (AIDS- und immunschwachen Patienten, Alkohol- und Drogenkranke), erhöht sich die Zahl der Erkrankten dagegen drastisch. Gelangen Bakterien aus dem Organismus von Erkrankten nach außen, spricht man von der "offenen Tuberkulose". Die Ausscheidung erfolgt je nach Lokalisation mit Hustenauswurf (Sputum, Lungentuberkulose) oder Magensaft, Urin (Harnwegstuberkulose) oder Stuhl (Darmtuberkulose).
Die Infektion erfolgt meist durch Kontakt mit Erkrankten, die an offener TBC leiden, und zwar überwiegend mittels Tröpfcheninfektion, d.h. durch Sprechen, Niesen oder Husten.
Menschen mit offener Tuberkulose müssen frühzeitig erfasst und wenn nötig isoliert werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Die Inkubationszeit beträgt ca. 4-6 Wochen. Offene, also ansteckende Tuberkulose unterliegt in Deutschland dem Bundesseuchengesetz. Danach können Tuberkulose - Träger auch gegen ihren Willen isoliert werden.
2.3.2 Krankheitsbild und Diagnose
Die Tuberkulose ist eine chronische, in zwei Stadien verlaufende Infektionskrankheit. Es wird unterschieden in:
Primärtuberkulose: Das sind alle Krankheitserscheinungen im Rahmen der Erstinfektion mit Tuberkulosebakterien. und Postprimärtuberkulose: Das sind isolierte Organtuberkulose nach durchgemachter Primärtuberkulose, auch Reaktivierungskrankheit genannt.
Bei der Primärtuberkulose gelangen die Bakterien in 95 % aller Fälle durch die Inhalation erregerhaltiger Hustentröpfchen von Patienten mit offener Tuberkulose in die Lunge, wo sie von dort ansässigen Makrophagen (Fresszellen) aufgenommen werden.
Normalerweise werden Erreger innerhalb der Fresszellen abgetötet, die Mykobakterien können jedoch aufgr und einer Besonderheit ihres Wandaufbaus in den Makrophagen überleben und sich vermehren. Nach dem Zerfall der Fresszelle werden die Erreger freigesetzt und wiederum von anderen Makrophagen aufgenommen.
Durch den Zerfall der Fresszellen entsteht ein Entzündungsherd, der auch als Primäraffekt bezeichnet wird. Von dort aus wandern die Erreger in die nächstgelegenen Lymphknoten, die daraufhin durch die Bildung von speziellen Abwehrzellen (Lymphozyten) anschwellen. Den Primäraffekt und den Befall von Lymphknoten durch Tuberkelbakterien bezeichnet man als Primärkomplex.
Die Erregerherde können sich nun innerhalb der Entzündungsreaktion im Bindegewebe abkapseln und innerhalb eines Jahres verkalken. Der verkalkte Primärkomplex lässt sich dann z.B. auch im Röntgenbild nachweisen.
Innerhalb dieser abgekapselten Herde können jedoch immer noch lebensfähige Tuberkulose- bakterien vorhanden sein, die später reaktiviert werden können (à Postprimärtuberkulose).
Das Stadium der Primärtuberkulose, in dem ca. 50% der Erstinfektionen zum Stillstand kommen, verursacht meist kaum oder nur sehr untypische Beschwerden wie leichte Temperaturerhöhung, Husten, Nachtschweiß oder Appetitlosigkeit.
Ausgehend vom Primärkomplex können sich insbesondere bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem auch noch andere Krankheitsbilder entwickeln:
Bei der Ausbreitung der Tuberkulosebakterien auf den Lymphwegen in weiter entfernte Lymphknoten des Brustkorbes entsteht die sog. Hiluslymphknoten - Tuberkulose. Dadurch können Bronchien abgedrückt und damit Teile der Lunge minderbelüftet werden.
Bei der Mitbeteiligung des Rippenfells (Pleura) an der Entzündungsreaktion des Primärkomplexes hat die Pleuritis Exsudativa, die sogenannte "nasse" Rippenfellentzündung eine Flüssigkeitsansammlung in der Lunge zur Folge, die Atembeschwerden hervorrufen kann.
Bei der Ausbreitung der Tuberkulosebakterien auf dem Blutwege werden die Erreger in ande- re Organe gestreut und es kommt zur Bildung kleinster Herde, die zwar gar keine Beschwer- den bereiten, aber aufgrund der in ihnen enthaltenen Erreger später eventuell zum Ausgangs- punkt einer Postprimärtuberkulose werden können. Bei schlechter Abwehrlage des Patienten und großer Erregeranzahl entstehen viele Herde in verschiedenen Organen. Dabei untersche i- det man u.a. die Miliartuberkulose mit vielen Herden in der Lunge, die sich im Röntgenbild als "Schneegestöber" darstellen und die Meningitis tuberculosa, eine durch die Tuberkulose- Herde ausgelöste Hirnhautentzündung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Die gesunde Lunge kann ein großes Volumen aufnehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Die von Tuberkulose befallene Lunge hat ein geringeres Lungenvolumen.
Heilen die Organherde, die während der Erregeraussaat auf dem Blutweg entstanden sind, nicht ab, entwickelt sich nach unterschiedlich langer Zeit eine Organtuberkulose. Dies ist das zweite Stadium der Tuberkulose, die Postprimärtuberkulose oder Reaktivierungskrankheit genannt.
Dabei verflüssigen sich die Erregerherde im Zentrum, es entsteht eine flüssigkeitsgefüllte Höhle, die sogenannte Kaverne.
Entsteht nun beim Einschmelzen der Herde eine Verbindung der Kaverne zu einem kanalikulärem System, wie z.B. Blut- oder Lymphgefäßen, Bronchien oder Harnleiter, können die Bakterien in andere Regionen streuen und erneut Herde setzen oder natürlich auch mit Auswurf oder Urin an die Umwelt gelangen ("offene Tuberkulose").
Bei Nachbarschaft eines Lungenherdes zu Blutgefäßen können diese beim Einschmelzen ve r- letzt werden, so dass es zu Lungenblutungen mit blutigem Husten kommt.
Neben der Lungentuberkulose, die mit ca. 85% die hä ufigste Organtuberkulose darstellt, gibt es unter anderem die Nieren-, die Knochen-, die Nebennnierenrinden-, Augen- und Hirntu- berkulose.
Die Postprimärperiode ist immer symptomatisch mit Fieber (jedoch nie extrem hohem Fieber), Nachtschweiß und Abgeschla genheit verbunden. Sie heilt nie spontan aus, ist daher immer behandlungsbedürftig und tritt in unseren Breiten fast nur im Erwachsenenalter auf, im Gegenteil zur Primärtuberkulose.
Da die Symptomatik der Tuberkulose doch eher uncharakteristisch ist, wobei es in 10% der Fälle gar keine Beschwerden gibt, sind Fehldiagnosen relativ häufig.
Erste Hinweise auf eine Tuberkuloseerkrankung geben die Krankengeschichte, wie Erkrankungen in der Familie oder in der näheren Umgebung, ein abwehrgeschwächter Körper aufgrund anderer Erkrankungen, die momentanen Beschwerden (leicht erhöhte Temperaturen, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, Husten) sowie Röntgenaufnahmen. Die endgültige Diagnose lässt sich nur durch den klinisch chemischen Nachweis des Erregers erbringen.
Als Untersuchungsmaterial werden je nach vermuteter Lokalisation Hustenauswurf, Magensaft, Bronchialsekret oder Urin verwendet. Mit Hilfe spezieller Färbungen (Ziehl-Neelsen, Fluoreszenz-Färbung), wird das Material erst mikroskopisch auf Tuberkulosebakterien untersucht, gleichzeitig wird eine Bakterienkultur angelegt, da bei einer geringen Erregerkonzentration die Mikroskopie wenig zuverlässig ist.
2.3.3 Therapie und Vorbeugung
Jede aktive Tuberkulose muss behandelt werden. Offene Tuberkulosen werden anfänglich sogar stationär behandelt.
Die Behandlung erfolgt gegen die Symptome mit Antitussiva, also Medikamenten, die den Hustenreiz unterdrücken. Außerdem wird ein strenges Alkohol- und Rauchverbot erteilt und eine Behandlung abwehrschwächender Begleiterkrankungen durchgeführt, um den Körper zu stärken.
Der Tuberkuloseerreger selbst wird, um einer Resistenzentwicklung des Bakteriums gegen einen Wirkstoff vorzubeugen, mit einer Kombination aus folgenden Medikamenten bekämpft: Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Streptomycin, Pyrazinamid.
Die Standardtherapie wird über einen Zeitraum von ca. 9 Monaten durchgeführt, anschließend wird der Patient bei komplikationslosem Verlauf 2 Jahre lang überwacht. Ein verfrühter Ab- bruch der Therapie kann zu resistenten Erregerstämmen führen. Bei einem erneuten Krank- heitsausbruch sind die verwendeten Medikamente dann nicht mehr wirksam. Dies gilt auch für Personen, die danach von dieser Person infiziert wurden. Um die Seuche auch in den Ent- wicklungs- und Schwellenländern wirksam bekämpfen zu können setzt die WHO (Welt Ge- sundheits Organisation) deshalb seit 1992 auf eine Strategie namens DOTS. Dies ist die Ab- kürzung für Directly Observed Treatment Short Course. Dabei muss der Patient bis zur Ge- sundung seine Medikamente unter ständiger Aufsicht nehmen. Leider werden zur Zeit welt- weit nur ca. 10% der Erkrankten nach diesem Schema behandelt. Kriege, fehlende medizini- sche Infrastrukturen, ärztliche Unkenntnis, Korruption und vor allem natürlich Geldmangel sind die wesentlichen Gründe dafür.
Neben der Maßnahme der Erfassung und ggf. Isolierung von an offener TBC erkrankten Menschen, ist eine Schutzimpfung, die sogenannte BCG - Impfung (Bacille - Calmette - Gue- rin), verfügbar.
Diese Impfung, kann jedoch nicht einer Infektion mit Tuberkulo sebakterien vorbeugen, sondern lediglich die Bildung spezieller Abwehrzellen bewirken. Damit sinkt das Erkrankungsrisiko, bzw. die Komplikationsrate. Die BCG - Schutzimpfung wird unter anderem folgenden Personengruppen empfohlen:
Säuglingen und Kindern, die in einem Gebiet mit hohem TBC - Risiko leben, bzw. deren Eltern aus solchen Gebieten kommen.
Für Kinder, bei denen eine geplante Ausschaltung des Immunsystems auf Grund von bestimmten Therapien vorgesehen ist, wie z. B. von Leukämie oder schwerer Neurodermitis, Dies gilt ebenso für ihre Geschwister und Eltern.
Personal im Gesundheitsdienst, vor allem in den Bereichen Kinderheilkunde, Schwangerenund Immunschwächenbetreuung, sollte auf jeden Fall die Schutzimpfung erhalten. Außerdem sollte auch das Personal in Kinder betreuenden Einrichtungen nicht auf eine BCG - Schutzimpfung verzichten.
Vor jeder Impfung muss ein Tuberkulintest (z. B. Tubergen® - Test, Tuberkulin TINE TEST®) durchgeführt werden, um die Reaktivierung eines Herdes bei bereits Infizierten durch den Impfstoff zu vermeiden. Für den Tuberkulintest wird ein Bestandteil des abgetöteten Bakteriums, das Tuberkulin, in kleinsten Mengen in die Haut injiziert.
Zeigt sich innerhalb der folgenden 24-72 Stunden eine Schwellung mit Rötung, kann das auf eine Infektion mit Tuberkulosebakterien, aber auch auf eine durchgeführte BCGSchutzimpfung hinweisen.Nach 3 Monaten wird der Erfolg der Impfung ebenfalls mittels des Tuberkulintestes geprüft, der Impfschutz hält lebenslang an.
Am 15.07.1999 veröffentlichte das britische Fachblatt „Nature“ die Meldung, dass im Kampf gegen Tuberkulose ein hochwirksamer DNA - Impfstoff in Sicht ist. Im Tierversuch gelang es einem Team des „National Institute for Medical Research“ in London, Mäuse zur Produktion besonders aktiver Abwehrzellen des Immunsystems zu „animieren“. Dazu spritzten sie den Tieren Erbfragmentstücke des Tuberkuloseerregers in die Lunge und in die Milz ein. Der Impfstoff (Vakzin) schaltete das Immunsystem der Mäuse um: Aus der ineffektiven, sogenannten Typ - 2 - Immunantwort wurde plötzlich eine Typ -1 - Reaktion. Diese führt schließlich zur Herstellung von T - Zellen, die mit dem umgehenden Abtöten der Bakterien beginnen. Bisherige Impfstoffe werden aus ganzen Erregern hergestellt, während das DNA - Vakzin des Londoner Teams auf Teile der Bakterien - DNA beruht.
2.3.4 Gesellschaftliche Probleme
Mehr als 100 Jahre nach der Entdeckung des Tuberkulose - Erregers und mehr als 50 Jahre nach de Einführung der antituberkulösen Therapie sind weltweit mehr Menschen als jemals zuvor von der „weißen Pest“ mit Krankheit und Tod betroffen.
Ein Drittel der Weltbevölkerung (1,7 Milliarden Menschen) sind mit Tuberkulose infiziert, acht Millionen Menschen erkranken jährlich neu. Etwa alle zehn Sekunden stirbt auf der Welt ein Mensch an der Krankheit - drei Millionen jedes Jahr - das sind mehr als an Malaria und Aids zusammen jährlich sterben. Die Tuberkulose ist heute die Infektionskrankheit, die welt- weit am häufigsten zum Tode führt - und das in einer Zeit, da die Erkrankung praktisch im- mer heilbar wäre. 95 % aller Tuberkulosekranken stammen aus Ländern der Dritten Welt, deshalb wird Tuberkulose nicht nur als „weiße Pest“, sondern auch als eine Krankheit der Armut bezeichnet. Der Welt - Tuberkulose - Tag am 24. März versucht deswegen jedes Jahr aufs neue, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass der Kampf gegen die Tuberkulose dringender als je zuvor ist. Obwohl die Tuberkulose gut behandelbar und kontrollierbar wäre, fehlen in den meisten Ländern die finanziellen und organisatorischen Mittel.
Besonders schlimm ist die Situation in der dritten Welt und in Osteuropa. Nach neuesten Angaben der WHO breitet sich in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion eine TBC - Epidemie aus. Derzeit liegt die Erkrankungsquote bei 250.000 Patienten im Jahr. In den Gefängnissen der betroffenen Länder und auch Russlands ist die Lage fast dramatisch, denn dort sind rund 100.000 Häftlinge an aktiver Tuberkulose erkrankt, die Hälfte davon hat multiresistente Erreger. Für diese Personen gib t es keine Behandlungsmöglichkeiten mehr.
Auch in den Ländern der dritten Welt ist Hilfe unbedingt erforderlich. Entscheidend für die Tuberkulosebekämpfung ist es, so die WHO, die Patienten konsequent zu betreuen. Um dies zu gewährleisten wurde 1992 die schon erwähnte DOTS - Strategie (Direcctly Observed Treatment, Short Coupe) ins Leben gerufen, die als erfolgversprechend und kostengünstig gilt. Die Ausgaben betragen pro geheilten Patienten zwischen 80 und 100 DM. Gesundheit s- arbeiter und freiwillige Helfer kontrollieren die Medikamenteneinnahmen, die ansonsten den Patienten eigenverantwortlich überlassen bliebe. Diese setzen nämlich ihre Medikamente hä u- fig ab, sobald die erste Besserung eintritt. Die Tuberkulose kann dann nicht ausheilen. Durch die DOTS - Strategie hofft man, bis zum Jahr 2004 rund 70 % aller Patienten mit offener Lungentuberkulose zu erfassen und größtenteils zu heilen. Dieses Ziel zu erreichen wird nicht einfach sein, da mittlerweile durch die unkontrollierte Anwendung von Tuberkulostatika mul- tiresistenete Bakterienstämme entstehen.
Ein weiteres Problem stellt das Auftreten von HIV - Infektionen dar, die die Zahl der Tuber- kulosefälle weiter ansteigen lassen. Ein HIV - positiver Mensch besitzt ein 30fach höheres Risiko, an Tuberkulose zu erkranken, als ein HIV - negativer. Schätzungen haben ergeben, dass weltweit ein Zehntel aller Tuberkulosefälle im Rahmen von HIV - Infektionen auftritt. Deshalb sollten die Basisgesundheitsdienste bei HIV - positiven Personen ihre Prioritäten auf die Diagnostik und Therapie der Tuberkulose setzen. Die Tuberkuloseprogramme hingegen sollten die HIV/Aids - Prävention berücksichtigen.
In Deutschland ist die Situation entspannter, kann aber trotzdem nicht als befriedigend oder gar als „gelöstes Problem“ bezeichnet werden. Der Rückgang der Tuberkulose stagniert seit nahezu 1991, die Zahl der offenen, also ansteckungsfähigen Tuberkuloseneuzugänge hat sich in den letzten Jahren nicht vermindert. Regional zum Beispiel in Berlin, wird sogar von einer Zunahme der multiresistenten Mycobacterium tuberculosis- Stämme berichtet. Dafür lassen sich verschiedene Ursachen anführen. Ein Hauptgrund ist die Immigration von Menschen aus Ländern mit einer hohen Tuberkuloseverbreitung, außerdem eine Verschlechterung der Lebensbedingungen für bestimmte Gruppen, wie z. B Nichtsesshafte, Drogen- und Alkoholabhängige. Ineffektive Überwachungs- und Präventionsprogramme behindern ebenfalls eine schnelle Verbesserung der besorgniserregenden Situation.
Auch die Verbreitung des „Human Immunodeficiency Virus“ erhöht die Gefahr einer HIV/Tuberkulose - Doppelinfektion. Ein unzureichendes Therapieregime unterstützt zwar die Demokratie, aber auf keinn Fall die Vernichtung dieser lebensgefährlichen Infektionskrankheit, die eigentlich gar keine Bedrohung mehr darstellen müsste.
2.4 Gesundheitsvorsorge
Die alten Plagen der Menschheit verbreiten sich nun wieder neu, von Tuberkulose über Mala- ria bis hin zu lebensgefährlichen Durchfallerkrankungen: Infektionskrankheiten verbreiten sich immer stärker. Der internationale Reise- und Handelsverkehr verteilt die Erreger über die ganze Welt. Auch Umweltverschmutzung und Klimaveränderungen tragen zur Ausbreitung bei. Aber nicht nur Infektionskrankheiten stellen eine Bedrohung dar, auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen in Städten leben, beeinflusst das Gesundheitsbild. Für das Jahr 2025 wird damit gerechnet, dass 50 % der Weltbevölkerung in Städten leben werden - 1995 waren es nur 45 %.
Da in Städten hohe Bevölkerungszahlen auf verhältnismäßig engem Raum zusammenleben, bringt das nicht nur Vorteile mit sich. Hohe Luftverschmutzungen, Unfälle, schlechte Wohnsituationen, Gewalttaten und vor allem Stress stellen zunehmend eine Gefahr für die Gesundheit jedes einzelnen dar. Aus diesen Gründen ist es von enormer Bedeutung, sich durch eine effektive Gesundheitsvorsorge gegen diese Umwelteinflüsse zur Wehr zu setzen.
2.4.1 Bereiche
Damit eine Prävention von Nutzen ist, sollte sich jeder darüber im Klaren sein, unter welchen Umweltbedingungen er zu leben hat. Dazu gehören nicht nur Luft- und Klimaverhältnisse, sondern auch das soziale Umfeld. Und letztendlich auch der seelische Zustand jedes Indivi- duums. Denn wie schon erläutert wurde, ist ein Mensch nur gesund, wenn er sich körperlich, sozial und geistig wohlfühlt. Demzufolge gibt es auch viele Bereiche, in denen jeder Mensch seine Gesundheit stärken kann, ob es nun physisch oder auch psychisch notwendig ist. Aller- dings sollte jeder das Feingefühl besitzen, erkennen zu können, ob seine Gesundheit gefährdet ist , denn viele nehmen eine ernste Gefahr erst viel zu spät wahr. Vor allem im geistigen Be- reich ist es schwierig, krankhafte und unnormale Erscheinungen zu erkennen, denn nicht nur plötzlich auftretende psychische Krankheiten ausgelöst durch zum z. B. traumatische Schicksalsschläge, sondern auch Stress kann schwere gesundheitliche Folgen haben. Oft ist ein seelisches Problem nur der Auslöser und überträgt sich auf den Körper, wenn es nicht schon frühzeitig erkannt wird.
2.4.2 Maßnahmen
Diese sogenannten Risikofaktoren, die das Entstehen bestimmter Krankheiten, insbesondere solcher des Herzkreislaufsystems begünstigen, sollten im Interesse jedes einzelnen soweit wie möglich reduziert werden. Rauchen, Bewegungsmangel, Bluthochdruck und zu hohe Blut- fettwerte sind heutzutage „Standardprobleme“, die in erschreckendendem Maße immer mehr jüngere Altersgruppen betreffen. Deshalb werden Maßnahmen zur Verhütung der Entwick- lung chronischer Krankheiten hauptsächlich durch solche Risikofaktoren propagiert. Sie zie- len vo rwiegend auf Verhaltensänderungen der Individuen. Vermeiden von Risiken bedeutet zunächst, dass das Rauchen aufgegeben, das Essen auf eine cholesterinarme Diät umgestellt und regelmäßig Sport getrieben werden soll. Aber auch Impfungen und regelmäßige Arztbe- suche dämmen Gesundheitsrisiken ein und verhindern den Ausbruch oder die Verbreitung von Krankheiten.
2.4.2.1 Impfungen
Impfungen verleihen einen sicheren Schutz vor einer Vielzahl von Erkrankungen, die haup t- sächlich durch Viren und Bakterien verursacht werden. Im folgenden werden die prinzipiellen Arten von Impfungen, wie aktive und passive Impfung, Subunit- und DNA- Impfungen, deren mögliche Risiken sowie die wichtigsten Anwendungen dargestellt.
Seit Tausenden von Jahren haben die Menschen all ihren Scharfsinn aufgewendet, um einen lebensrettenden Schutz vor den immer wieder grassierenden Infektionskrankheiten zu finden. Bereits 430 v. Chr. beschrieb der Grieche Thukydides, dass niemand zweimal Pocken bekäme. Doch schon mehr als 1000 Jahre zuvor hatte man in Asien entdeckt, dass auch bei leichtem Krankheitsverlauf ein zuverlässiger Schutz vor einer Wiedererkrankung entstand. Daher versuchte man, durch künstliche Übertragung eine möglichst milde Form einer Infektionskrankheit zu erzeugen. In Asien wurde eine wässrige Lösung von Pockenkrusten in die Haut injiziert. In China wurden getrocknete Krusten in die Nase geblasen. In Afrika wurde Sekret von abheilenden Pockenblasen genommen und übertragen.
Diese Methode der "Variolation" wurde 1718 durch Lady Wortley-Montagu nach Europa gebracht. Sie hatte 1717, als Frau des damaligen englischen Gesandten in Konstantinopel, die Pockenepidemie miterlebt, die etwa 25 Prozent aller Kinder tötete. Zurück in England, ließ sie das intrakutane Einbringen von Sekret an sechs Strafgefangenen ausprobieren - eine etwas barbarische aber erfolgreiche Vorgehensweise. Die Methode verbreitete sich und wurde auch in Deutschland ab etwa 1724 eingesetzt; sie traf aber bald auf heftigen Widerstand, da sie nicht ganz ungefährlich war - zwei bis drei Prozent der Geimpften starben.
Am 14. Mai 1796 kam dann die Stunde des Landsarztes Dr. Jenner, der einen kleinen Jungen erst mit Kuhpocken infizierte, die er von einer Melkerin genommen hatte, um ihn einige Zeit später den echten Pocken auszusetzen. Der Junge erkrankte nicht und die Vakzination (von lateinisch "vaccinia"= Kuhpocken) begann ihren Siegeszug, wenn auch zunächst nicht in Eng- land. 1806 erließ der Schweizer Kanton Aargau ein Gesetz zur Pockenschutzimpfung, im Jahr darauf folgten Bayern und Hessen, schließlich wurde sie in der ganzen Welt üblich und trug entscheidend dazu bei, einer jahrtausend alten Geißel diesen Schrecken zu nehmen. Aber noch fehlte alles Wissen zu Entwicklung weiterer Impfstoffe. Niemand wusste damals etwas über die Ursachen ansteckender Krankheiten. Es sollte daher noch fast 80 Jahre dauern, ehe durch die bahnbrechenden Arbeiten solcher Forscher wie Pasteur, Robert Koch oder Emil von Behring hierzu die Grundlagen gelegt werden konnten. Danach verlief die Entwicklung un- aufhaltsam: Die ersten bakteriellen Totimpfstoffe 1896/7 waren gegen Typhus (Pfeiffer und Kolle), Cholera (Kolle) und die Pest (Hafkine). Mitte des 20. Jahrhunderts machten Fort- schritte in der Aufklärung der Zellbiologie und Biochemie Impfungen gegen die folgenden Krankheiten möglich: Poliomyelitis 1953, Masern 1963, Röteln 1967, Mumps 1975 oder He- patitis B 1979.
Auf jeder Zelle eines Lebewesens sitzen einzigartige und unverwechselbare Merkmale, die aus Eiweißmolekülen bestehen: die so genannten Antigene. Dies ist bei Menschen so, aber auch bei Bakterien; sogar Viren, die sehr klein sind und noch nicht einmal aus Zellen beste- hen, haben solche Eiweißstrukturen auf ihren Oberflächen. Unser Immunsystem lernt sehr früh, die eigenen Merkmale zu erkennen und zu tolerieren; aber gegen sämtliche fremde An- tigene (Merkmale) geht es vor. Dies ist ein sehr komplizierter Prozess, bei dem mehrere Arten von Antikörpern (humorale Immunität) und Immunzellen (zellvermittelte Immunität) zusam- menwirken. Wichtig für das Verstehen der Impfwirkung ist dabei, dass das Immunsystem sozusagen eine Doppelstrategie verfolgt:
Zum einen produziert es bei einer Infektion große Mengen von Antikörpern, die ganz spezi- fisch gegen die als fremd erkannten Antigene des Eindringlings - zum Beispiel eines Bakteri- ums - gerichtet sind, und ihn letztlich vernichten und aus den Körper eliminieren können. Bis diese Produktion richtig anläuft, vergehen aber einige Tage und dies kann bei sehr bösartigen Erregern zu lange sein.
Zum anderen aber bildet es nach einem ersten Kontakt sogenannte Gedächtniszellen. Bei ei- nem erneuten Kontakt mit dem selben Erreger sind diese in der Lage, nunmehr blitzschnell die Produktion von Antikörpern "aus dem Stand heraus" in Gang zu setzen, da die notwend i- gen Informationen bereits vorhanden sind. Bevor der Erreger überhaupt anfangen kann, sich richtig zu vermehren, sieht er sich bereits einer gewaltigen Übermacht von Antikörpern ge- genüber, die absolut spezifisch gegen ihn gerichtet sind. Eine Krankheit kommt daher oft gar nicht erst zustande, und in aller Regel bemerkt der Mensch nichts von dem Vorgang.
Diese Abläufe macht man sich bei einer Impfung zu Nutze. Bei ihr präsentiert man dem Immunsystem die spezifischen Merkmale (Antigene) eines Erregers, und regt es so zur Bildung von Antikörpern und - was noch viel wichtiger ist - von Gedächtniszellen an. Dringt eines Tages der "echte" Erreger ein, so hat er im Idealfall ebensowenig eine Chance wie bei einer vorangegangen natürlichen Infektion.
Da diese Form der Impfung den Organismus zur aktiven, eigenständigen Abwehr befähigt, nennt man sie die aktive Schutzimpfung (im Gegensatz zur passiven Schutzimpfung, bei der dem Organismus der Schutz nur "geliehen" wird). Die Kunst besteht nun darin, diesen Kontakt mit dem Immunsystem so zu gestalten, dass der Mensch nicht tatsächlich erkrankt oder sonst einen Schaden erleidet. Hierzu musste man bei der Impfstoffentwicklung verschiedene Wege gehen und verwendet Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe.
Lebendimpfstoffe enthalten vermehrungs fähige Erreger, die man aber durch verschiedene Verfahren abgeschwächt hat (Attenuierung). Ihr großer Vorteil ist, dass sie eine echte Krank- heit sozusagen im Kleinen durchspielen, und daher oft eine gute und langanhaltende Immuni- tät erzeugen. Ihr Nachteil ist, dass es in sehr seltenen Fällen zu ernsthaften und sogar schwer- wiegenden Nebenwirkungen und Krankheitserscheinungen kommen kann. Beispiele für die Anwendung von Lebendimpfstoffen sind Mumps, Masern, Röteln und Gelbfieber sowie auch die BCG-Impfung (Tuberkulose ).
Totimpfstoffe bestehen aus Erregern, die inaktiviert und nicht mehr vermehrungsfähig sind, oder aus Teilen von deren Bestandteilen. Inaktiviert werden die Erreger oder ihre Bestandteile durch chemische Maßnahmen wie die Behandlung mit Formalin oder durch physikalische Anwendungen wie die Zuführung von Hitze. Wie oben bereits ausgeführt, genügt es ja oft, dem Immunsystem nur ein charakteristisches Merkmal eines Krankheitserregers zu präsentie- ren, um ihn zur Produktion von Antikörpern anzuregen. Ein Vorteil von Totimpfstoffen ist es, dass eine daraus folgende Erkrankung ausgeschlossen ist. Die Antigene, die den Schutz he r- vorrufen, können auch gentechnologisch hergestellt werden, wie etwa das Hepatitis - B - O- berflächen-Antigen. Durch inaktivierte Erreger wirken vor allem die Impfstoffe gegen Keuchhusten, Grippe, Cholera, Fleckfieber, Tollwut, Ruhr, Pneumo- und Meningokokkenin- fektionen.
Totimpfstoffe kommen auch zum Einsatz, wenn nicht der Erreger selber, sondern sein Gift (Toxin) die hauptsächlichen Krankheitserscheinungen hervorruft, wie das zum Beispiel bei der Diphtherie oder dem Tetanus der Fall ist.
Bei der passiven Immunisierung führt man den Organismus geeignete Konzentrate von Ant i- körpern von außen zu (in der Regel durch Injektion). Er ist dadurch für eine gewisse Zeit ähn- lich geschützt, als ob er die Antikörper selber gebildet hätte. Der Schutz hält aber nur eine Weile an, da die Antikörper abgebaut werden; auch ist er nur einmalig, da es natürlich keine Gedächtniszellen gibt. Man macht dies bei immungeschwächten Personen, in bedrohlichen Krankheitssituationen oder auch zur Prophylaxe z. B. gegen Hepatitis A oder bei Fernreisen.
Es gibt in Deutschland keine Pflichtimpfungen mehr, wie dies früher z.B. bei der Pocken- schutzimpfung der Fall war. Dennoch hat der Staat als Gemeinwesen ein hohes Interesse an einer möglichst lückenlos durchgeimpften Bevölkerung. Denn der Impfschutz nützt nicht nur dem einzelnen Menschen, denn sobald ein genügend großer Anteil der Bevölkerung geimpft ist, reißt eine Infektionskette ab, und die Krankheit kann sich nicht weiter ausbreiten. Wird eine Infektionskrankheit nur zwischen Menschen übertragen, kann sie durch Impfungen sogar völlig ausgerottet werden, wie das bei den Pocken der bereits der Fall ist. Möglich wäre dies auch bei den Masern und der Kinderlähmung (Poliomyelitis) sowie auch bei der Hepatitis B, an der weltweit immer noch mehr als eine Million Menschen jährlich sterben. In Deutschland sind etwa 0,5% der Bevölkerung Hepatitis B positiv; das heißt, sie sind in Gefahr, dass die Infektion in eine chronische Form mit der Möglichkeit der Erkrankung an Leberzirrhose oder Leberkrebs übergeht. Bei Kindern beträgt dieses Risiko sogar 70 bis 90 %! Daher werden die wichtigsten Impfungen durch die obersten Gesundheitsbehörden der Bundesländer empfoh- len. Eine wichtige Folge hiervon ist, dass der Staat bei auftretenden Impfschäden nach sol- chen Impfungen in Haftung tritt. Eine entscheidende Rolle bei diesen Impfempfehlungen hat die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert Koch Institut (RKI) in Berlin inne. Sie überarbeitet diese Empfehlungen regelmäßig und veröffentlicht sie. Alle Bundesländer stüt- zen sich bei ihren Empfehlungen darauf.
Auch der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil diese zentrale Rolle der STIKO hervorgeho- ben, weswegen sich die allermeisten Kinderärzte strikt nach ihnen richten. Der Impfkommis- sion gehören auf dem Gebiet des Impfwesens kompetente Wissenschaftler an, die vom Präsi- denten des RKI im Einvernehmen mit dem zuständigen Bundesministerium für drei Jahre berufen werden.
Der Begriff " Kinderkrankheiten " suggeriert, es handele sich um Krankheiten, von denen nur Kinder befallen würden, und die irgendwie zu einer normalen Entwicklung "dazugehörten" und gleichsam " üblich" seien. Dies ist nicht im mindesten der Fall. Die so genannten Kinder- krankheiten treten deswegen vorzugsweise im Kindesalter auf, weil sie so ansteckend sind, dass kaum jemand ihnen auf dem Weg zum Erwachsenenalter entkommt. Sie sind oft auch alles andere als kindlich harmlos, sondern ausgesprochene und zum Teil recht aggressive In- fektionskrankheiten, die erhebliche und bleibende Schäden verursachen können und dies ist auch regelmäßig der Fall. Beispielsweise ist Mumps die häufigste nicht angeborene Ursache für die Ertaubung von Kindern und Jugendlichen; Masern können zu schweren Hirnverände- rungen führen; Windpocken zu Hirnhautentzündungen und Nierenschäden. Die Röteln fo r- dern jedes Jahr ihre Opfer in Form von schwerst missgebildeten Kindern, deren nicht immune Mütter während der Schwangerschaft angesteckt wurden.
Bei der Verhinderung solcher unnötiger Folgen spielt Deutschland keine rühmliche Rolle, und nimmt international bestenfalls einen Platz im Mittelfeld ein. In einer Reihe von Ländern - z. B. Skandinavien und die USA - sind die Impfraten deutlich höher als bei uns mit der Folge, dass nicht nur die entsprechenden Krankheiten, sondern vor allem auch ihre tragischen Komplikationen dort so gut wie unbekannt sind. Die meisten Kinderärzte in den USA haben in ihrem Berufsleben noch nie einen Masernfall gesehen, geschweige die Hirnschäden bis hin zu Todesfällen, wie es sie bei uns immer noch gibt.
Die WHO hat es sich daher zum Ziel gesetzt, durch weltweite Impfprogramme bestimmte Infektionskrankheiten auszurotten oder stark zu reduzieren, wie das bei den Pocken so vo r- bildhaft schon gelungen ist. Nur wenn in Deutschland die Durchimpfungsraten deutlich angehoben werden, können auch wir unseren Beitrag für dieses Ziel leisten.
2.4.2.2 Ernährung
Essen und Trinken gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Aber über die bloße Befriedigung dieser Grundbedürfnisse hinaus haben sich die Menschen schon immer die Fra- ge gestellt, welche Nahrungsmittel geeignet für eine gesunde und bekömmliche Ernährung und welche eher ungeeignet oder gar schädlich sind. Ernährung hat aber über die bloße Be- friedigung von Hunger und Durst hinaus für das Leben der Menschen eine weitere, oft sogar tiefere Bedeutung.
In fast allen Kulturen war und ist die Nahrungsaufnahme eng mit religiösen und kultischen Riten verknüpft. Mit Freunden "gut essen zu gehen", einen guten Wein zu trinken oder sich auf ein Bier zu treffen, macht außerdem die wichtige soziale Komponente der Nahrungsauf- nahme deutlich.
Dennoch stellt die heutige Ernährung auch Probleme dar. Einige Menschen haben wie die Geschichte schon immer berichtete, zu wenig zum Essen während in den Industrienationen das Nahrungsangebot in keinem Verhältnis zu den benötigten Mengen steht. Dies hat Unter- oder Fehlernährung zur Folge, die schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen kann.
Aus diesem Grund sollte jeder wissen wie viel Energie er benötigt bzw. verbraucht und wie ausgewogen und damit gesund seine Ernährung ist.
Eine ausreichende Energiezufuhr über die Ernährung ist für die Sicherstellung bzw. Wieder- herstellung der Funktionen des menschlichen Körpers unerlässlich. Der verwertbare Energie-
gehalt der Nahrung wird in kJ (Kilojoule) oder veraltet in kcal (Kilokalorien) angegeben (1 kJ = 0,239 kcal bzw. 1 kcal = 4,184 kJ).
Der Energiebedarf des Menschen ergibt sich aus dem Gesamtenergieumsatz seines Organismus, der sich aus Grundumsatz und Leistungsumsatz zusammensetzt:
Eine Übersicht über den täglichen Energiebedarf der unterschiedlichen Altersgruppen ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Täglicher Bedarf an Energie und Nährstoffen
Grundumsatz: Als Grundumsatz wird diejenige Energiemenge bezeichnet, die als Minimum zur Aufrechterhaltung der Lebensfunktionen des Organismus in völliger Ruhe no twendig ist. Dazu gehören die Aufrechterhaltung der Organfunktionen, des Kreislaufs, der Atmung, sowie der Körpertemperatur (= Thermogenese).
Leistungsumsatz: Der Leistungsumsatz beinhaltet darüber hinaus Energie für körperliche und geistige Aktivität, sowie gegebenenfalls für Schwangerschaft, Stillen, Wachstum oder Regeneration nach Krankheiten oder Verletzungen. Bei den mit der Nahrung zugeführten Nährstoffen unterscheidet man energieliefernde von nicht ene rgieliefernden. Zu den energie- liefernden Nährstoffen gehören Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate. Zu den nicht energieliefern- den Nährstoffen gehören z. B. Ballaststoffe, Mineralien, Spurenelemente und Vitamine.
Fette
Mit einer Energiedichte von 38,1 kJ/g (= 9,1 kcal/g) ist Fett der wichtigste Energielieferant. Fette als Triglyzeride bestehen aus drei mit Glycerol veresterten Fettsäuren. Die Fettsäuren tierischen Ursprungs sind gesättigt, d. h. sie enthalten keine Doppelbindung. Sie kommen vor in Fleisch, Schmalz, Talg, Milch und Butter.
Ungesättigte Fettsäuren, also mit einer oder mehreren Doppelbindungen, sind meist pflanzlichen Ursprungs und kommen z. B. in Sonnenblumen, Maiskeim- oder Baumwollsamenöl vor. Auch das Fett von Fischen hat einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Viele ungesättigte Fettsäuren kann der Körper nicht selbst herstellen. Man bezeichnet sie daher als essentiell. Dazu gehören auch die in Fisch (und Lebertran) besonders reich vorkommenden sogenannten Omega-6-Fettsäuren. Bei einer gesunden Ernährung sollte also auch Wert auf die Zufuhr von essentiellen Fettsäuren gelegt werden.
Nahrungsfette sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte Energielieferant Nummer 1. Nicht verbrannte Fette werden vom Körper als Depot- und als Baufett gespeichert. Diese Energie- speicherform ist sehr gewichts- und platzsparend. Hätte beispielsweise ein Vogel seinen E- nergievorrat in Kohlenhydraten statt in Depotfett angelegt, könnte er nicht vom Boden abhe- ben. Während Hunger- und Mangelzuständen greift der Körper auf seine Energiereserven der Depotfette zurück. Je nach äußeren Umständen (Überangebot, Schwangerschaft) werden diese in "guten Zeiten" entsprechend aufgefüllt, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein.
Eiweiße
Eiweiße (Proteine) sind nicht so energiereich wie Fette. Ihre Energiedichte beträgt 17,2 kJ/g (= 4,1 kcal/g). Die Bausteine, aus denen sie zusammengesetzt sind, die Aminosäuren sind wichtig für die Synthese körpereigener Struktur- (Bindegewebe) und Funktionsproteine (En- zyme). Nahrungsproteine werden im Darm in ihre Bausteine zerlegt, die Aminosäuren werden resorbiert, um dann als Material für körpereigene Proteine zu dienen. Der tägliche Mindestbe- darf an Proteinen liegt bei 37 g für Männer und 29 g für Frauen. Die empfohlenen Mengen, die tatsächlich aufgenommen werden sollen, sind aber etwa doppelt so groß. Während Schwangerschaft und Stillzeit liegt der Bedarf noch höher (siehe Tabelle). Die biologische Wertigkeit der Nahrungsproteine ist um so größer, je mehr essentielle Aminosäuren sie ent- halten.
Die Aminosäuren Valin, Leuzin, Isoleuzin, Phenylalanin, Methionin und Lysin können nicht vom Körper hergestellt werden und müssen daher mit der Nahrung zugeführt werden. Tieri- sche Proteine sind meist hochwertiger als Proteine pflanzlichen Ursprungs. Proteine aus Hül- senfrüchten enthalten z. B. nur wenig Methionin, Proteine aus Weizen und Mais nur wenig Lysin.
Kohlenhydrate
Kohlenhydrate dienen als leicht verfügbare Energiequelle. Ihr Energiegehalt liegt wie der der Eiweiße bei 17,2 kJ/g (= 4,1 kcal/g). In der Nahrung kommen sie als Monosaccharide vor (Glucose, Fruktose, Galaktose) z. B. in Obst und in Honig, als Disaccharide z.B. Laktose in Milch, als Maltose in Bier oder als Saccharose in allen mit Haushaltszucker gesüßten Lebensmitteln sowie als Polysaccharide in vielen pflanzlichen (Stärke in Kartoffeln) und tierischen (Glykogen im Muskelgewebe) Produkten. Kohlenhydrate sind nicht essentiell, machen aber einen wesentlichen Anteil der Energiezufuhr aus.
Zu den Nahrungsstoffen, die nicht an der Energiezufuhr beteiligt sind, gehören - wie eingangs erwähnt - Vitamine, Mineralien, Spurenelemente sowie die Ballaststoffe. Die Vitamine lassen sich wie bereits angedeutet in fettlösliche und wasserlösliche einteilen.
Fettlösliche Vitamine sind z. B. Vitamin A, D, E und K; in Wasser löslich sind Vitamine wie z. B. B1, B2, Folsäure, C, B6 oder Pantothensäure. Die meisten von ihnen sind essentiell, da sie vom Körper nicht oder nur in bestimmten Vorstufen gebildet werden können. Sie sind für eine ganze Reihe von Stoffwechselvorgängen von entscheidender Bedeutung. Zu den vom Körper benötigten Mineralien zählen Makroelemente wie Kalium, Natrium und Chlor. Letzte- re kommen z.B. im Kochsalz vor und werden vom Körper in größeren Mengen benötigt. An- dere Elemente werden vom Körper nur in Spuren benötigt (Mikroelemente oder Spurenele- mente).
Ballaststoffe
Als Ballaststoffe werden die Substanzen bezeichnet, die zwar mit der Nahrung aufgenommen werden, aber im Verdauungstrakt nicht verwertet werden können und daher keinen Beitrag zur Energiebilanz des Organismus liefern. Es handelt sich dabei zumeist um nicht spaltbare Polysaccharide, also Kohlenhydrate. Die Ballaststoffzufuhr sollte mehr als 30 Gramm pro Tag betragen. Ballaststoffe haben eine darmregulierende Wirkung, sie beeinflussen unter anderem positiv Verstopfung und Durchfall. Außerdem senken sie das Cholesterol im Blut und verrin- gern die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Dickdarmtumoren. Da sie u.a. für einen weichen Stuhl sorgen, wird die Entstehung einer Reihe von Enddarmerkrankungen, wie z.B. Hämorrhoiden verringert bzw. verhindert.
Bei gesunder, ausgewogener Ernährung ist der tägliche Vitamin- und Energiebedarf des Men- schen vollkommen gedeckt. Allerdings schwankt der Bedarf abhängig von Alter, Geschlecht und physiologischen Bedingungen wie körperlicher Belastung, Schwangerschaft oder Still- zeit. Unter- oder Fehlernährung oder Resorptionsstörungen können hingegen zu Hypovitami- nosen (zu wenig) und in Extremfällen zu Avitaminosen (gar kein Vitamin) führen. Unter Feh- lernährung wird die einseitige Ernährung durch „fast food“ vor allem bei jungen Menschen oder die Mangelernährung bei Alkoholkern verstanden. Auch das häufig medikamentös ind u- zierte Absterben der Darmflora z. B. durch Antibiotika kann zu Mangelzuständen führen.
Ist die Ernährung ausgewogen, kann z. B. auf Vitaminpräparate, verzichtet werden. Von ihnen wird nämlich nur so viel resorbiert, wie der Körper aktuell benötigt, der größte Teil, mehr als 90 %, wird einfach wieder ausgeschieden. Nur bei den Vitaminen A und D kann eine Überdosierung (Hypervitaminose) zu Vergiftungserscheinungen führen.
2.4.2.3 Sport
Eltern joggen, Kinder hocken. Gerade noch eine Stunde täglich bewegen sich im Schnitt die Grundschüler in Deutschland. Während viele Mütter und Väter gesundheitsbewusst auf der Fitness - Wellness - Welle reiten, bleiben den Kleinen bei neun Stunden Schlaf, neun Stunden Sitzen in der Schule, vor dem Computer und dem Fernseher und fünf Stunden Stehen ganze 15 bis 30 Minuten für intensive Bewegung oder Sport.
Der Karlsruher Sportwissenschaftler Klaus Bös warnt daher vor einer „gesellschaftlichen Zeitbombe“. Kinder, die zu wenig Bewegung haben, und die sich nicht ausreichend spiele- risch und sportlich betätigen können, werden später gesundheitliche Probleme haben. Deutschland wird krank.“ Untersuchungen bei zwölfjährigen Kindern zeigen, dass 40 Prozent von ihnen Kreislaufprobleme haben, jedes dritte Kind Haltungsfehler, jedes zweite Muskel- schwächen und jedes fünfte Übergewicht. Immer mehr Grundschüler klagen über Kopf - und Rückenschmerzen.
Außerdem berichtet der Sportmediziner, dass Schüler mehr krankheitsfördernde Merkmale aufweisen als noch vor zehn Jahren: „Wir stellen vermehrt Entzündungsfaktoren fest.“ Bewegungsmangel, Fast Food und Soft Drinks haben zur Folge, dass sich in den vergangenen 20 Jahren die Zahl der Schüler mit mindestens 30 Prozent Übergewicht um die Hälfte erhöht hat. „Heute werden Risikofaktoren bei jungen Leuten diagnostiziert wie sie sich früher erst bei 55- Jährigen zeigten. Kinder werden immer ungelenker. Sie verlieren die Beherrschung ihres Körpers und die Fähigkeit, ihre Bewegungen zu koordinieren.
Vielen Kindern fehlen die natürlichen Lebensräume, um ihren Bewegungsdrang ausleben und auch ihre Aggressionen abbauen zu können. Motorische Kompetenz aber brauche jeder Mensch für seine Entwicklung und sein Wohlbefinden, auch wenn er gar keinen Sport treiben möchte. Denn bereits 33 Prozent der Berufsschüler und zwölf Prozent der Gymnasiasten klag- ten bei einer Befragung in Karlsruhe über ständige Rückenbeschwerden im Alltag.
Die Schule als einzige Institution, die alle Kinder erfasst, kann keine Hilfestellung leisten: Längst ist der Sportunterricht im Lande zum Sitzenbleiber der Nation geworden. Schulsport wird gekürzt und ist oft im Gegensatz zu anderen Fächern nicht vertreten. Außerdem sind Ärzte bei Attesten zur Befreiung vom Sportunterricht freigebiger als für Hauptfächer. Hinzu kommt, dass fast die Hälfte der Sportlehrer um die 50 Jahre alt und damit der schweren Aufgabe des Unterricht s in den Hallen kaum noch gewachsen ist.
Untersuchungen an Gymnasien haben ergeben, dass nur vier Prozent der Mädchen und 32 Prozent der Jungen im Schulsport schwitzen oder schnaufen. „Der Anreiz zu mehr Bewegung muss schon im Kindergarten gesetzt werden“, fordert Bös. Doch die Wirklichkeit dort schil- dert Christine Krawietz: „Viele Kinder steigen vom Kindergarten ins Auto um und bewegen sich dann nur noch angeschnallt auf dem Rücksitz fort“, sagt die Kindergartenleiterin aus Weil der Stadt.
Doch dies kann ernsthafte Folgen haben. Es ist wissenschaftlich eindeutig erwiesen, dass ein Mangel an körperlicher Betätigung das Auftreten von Herz- und Kreislauferkrankungen be- günstigt. Regelmäßige sportliche Aktivitäten trainieren die Gefäße, halten sie elastisch und versorgen sie mit Sauerstoff. Somit wirkt körperliche Aktivität dem Entstehen oder Fort- schreiten der Arterisklerose (Fettablagerungen in den Arterien) entgegen, reduziert aber auch andere Risikofaktoren wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit. Sportliche Aktivitäten sind gut für die Gesundheit, jedoch muss das Ausüben einer Sportart vom Alter und vom Gesund- heitszustand abhängig gemacht werden.
Wenn der Sport gesund sein soll, muss er Spaß machen. Es reicht also nicht aus, dass man sich gegen seinen Willen zum Sport zwingt, er dann nicht gewissenhaft ausgeführt wird.
Sport kann sogar die Lebenseinstellung von Menschen ändern, das Gesundheitsbewusstsein kann gewandelt werden (z. B: Abwenden von Medikamenten, Rauchen, etc.) und das psychische Wohlbefinden steigen.
Regelmäßige körperliche Betätigung in begrenztem Umfang ist die beste Vorbeugung für ältere Menschen, neben dem Vermeiden von Risikofaktoren wie Rauchen und Übergewicht.
Allerdings fördert der Sport auch soziale Bindungen, ob es nun ein freundschaftliches Bad- mintonduell oder sogar ein kleines Basketballturnier mit der ganzen „Clique“ ist, durch Sport können Freundschaften gefestigt oder neue geschlossen werden, auf jeden Fall steigert es die Lebensqualität jedes einzelnen. Körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden können bei günstigen Bedingungen und vernünftiger Gestaltung auch über das sportliche Handeln erwo r- ben werden, dass damit einen entscheidenden Beitrag zu unserer Gesundheit leistet.
3 Gentechnik
Das 20. Jahrhundert kann als Zeitalter eines sich ständig beschleunigenden Fortschritt charak- terisiert werden, in dem die technischen Errungenschaften des Alltags von den Massenve r- kehrsmitteln bis zur Apparatemedizin entwickelt wurden. Wesentliche Entdeckungen mit fo l- genreichen Konsequenzen für die Menschheit waren am Anfang dieser Epoche das Ergebnis von Zufällen oder gar eines experimentellen Missgeschicks und vollzogen sich in der Stille der Labors wie die Erforschung des Penicillins zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Auch weiterführende Entwicklungsarbeiten zur kommerziellen Verwertung der wissenschaft- lichen Ergebnisse fanden ohne Meinungsbildung in der Öffentlichkeit statt. Die Industrie ha t- te auch kein Interesse daran, die zunehmende Kommerzialisierung in allen Lebensbereichen transparent zu machen und lästige Fragen nach latent vorhandenen, sozialen oder ökologi- schen Negativwirkungen heraufzubeschwören. Die in den Markt eingeführten Produkte wur- den anfangs nur nach dem Nutzen für die Gesellschaft bewertet, der allerdings wie das Be i- spiel der Antibiotika zeigt, durch die ungeklärten Risiken einer zunehmenden Ausbreitung antibiotikaresistenter Krankheitserreger relativiert wurde. Dieses anschauliche Fallbeispiel aus der Medizin verdeutlicht eine generelle Entwicklung in aufgeklärten Gesellschaften, in denen Fortschrittsglauben und Kritikbewusstsein in einem Spannungsfeld stehen. Diese Spannung zwischen Erkennbarem, Machbarem und Verantwortbarem trifft in besonderem Maße für die Gentechnik zu, da sie sich seit ihrer Einführung in der Mitte der siebziger Jahre diese Jahrhunderts stürmischer als jede andere Technologie zuvor entwickelte und das Poten- tial besitzt, alle Lebensbereiche von Mensch und Umwelt nachhaltig zu beeinflussen.
3.1 Begriff Gentechnik
Die Gründung der Firma Genentech 1976 in San Francisco durch den Biologen Herbert Boyer und den Anlageberater Robert A. Swanson war das Startsignal für die wirtschaftliche Nutzung der Gentechnik. Wer Silicon Valley verschlafen hatte, sah in der Gen- und Biotechnologie die Chance, am zweiten Teil des Wirtschaftswunders zu partizipieren. Ungefähr zwanzig Jahre nach der industriellen Einführung kann man die sozial - ökonomischen Auswirkungen der Gentechnik nur in Ansätzen erfassen. Fünfzehn Basismedikamente wie der Blutbildner E- rythropoethin und ein Impfstoff gegen Hepatitis B wurden weltweit zugelassen, 850 genma- nipulierte Nutzpflanzensorten werden zur Zeit im Freiland getestet und sogenannte transgene Tiere dienen als Wirkstoffproduzenten und Modell für die medizinische Forschung. Aber was ist Gentechnik eigentlich? Gentechnik stellt Methoden bereit zur Untersuchung und Änderung des Erbmaterials auf molekularer Ebene.
Damit unter dem Begriff „Erbmaterial“ eine genauere Vorstellung möglich ist, erfolgt nun eine kurze Erläuterung. Alle Lebewesen - ob Bakterium, Pflanze, Tier oder Mensch sind aus Zellen aufgebaut. Eine Zelle ist die kleinste selbständig lebens- und vermehrungsfähige Einheit eines Organismus. Im Zellkern, in den Chromosomen, befindet sich bei höheren Lebewesen der Hauptanteil der Erbsubstanz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.6: Aufbau der Desoxy-Ribo-Nukleinsäure DNA mit den folgenden Abkürzungen für: H = Wasserstoff, Z = Zucker als Desoxyribose,
P = Phosphat A = Adenin,
C = Cytosin T = Thymin, G = Guanin.
Chromosomen bestehen aus Doppelsträngen (Doppelhelixstruktur) von Desoxyribonuklein- säure (DNS, engl. DNA). Ein DNA - Strang (siehe Abb. 6) besteht aus einer Abfolge von Grundbausteinen (Nukleotiden), die sich jeweils aus einer von vier verschiedenen Basen, ei- nem Zuckermolekül (Desoxyribose) und einer Phosphatgruppe zusammensetzen. Der Doppel- strang entsteht durch sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den komplementä- ren Basen Adenin (A) und Thymin (T) sowie Guanin (G) und Cytosin (C). Die DNA ist in einzelne Abschnitte geteilt, Gene genannt, die Gesamtheit aller Gene nennt man Genom. Das Genom des Menschen enthält ca. 50.000 bis 100.000 Gene. Einfache Bakterienzellen haben immerhin noch bis zu 5.000 Gene.
Auf dem DNA - Faden ist die genetische Information gespeichert, die letztendlich Bau und Funktion eines jeden Organismus bestimmt. Die Anordnung von jeweils drei Basen hinter- einander stellt den Code(Triplettcode) für eine Aminosäure dar. Nach „Ablesen“ bzw. erne u- tem „Verschlüsseln“ der genetischen Information, einmal durch die Boten - RNA im Zellkern und dann, durch ihren Weitertransport zu den Ribosomen, durch die Transport - RNA, wer- den die codierten Aminosäuren zu Proteinen (Eiweißen) verknüpft (Eiweißsynthese):
Die relevante Erbinformation des Menschen, die sich aus der Sequenz der vier Basen ergibt, umfasst - wie schon erwähnt wurde - etwa 80.000 Gene und macht etwa 10 % von den insgesamt drei Milliarden Basenpaaren der DNA aus. Die übrigen 90 % sind sogenannte nicht - codierte DNA - Abschnitte (junk - DNA), die für jede Person unterschiedliche (polymorphe) und damit charakteristische Bereiche enthalten kann. Diese polymorphen, erblichen Merkma l- systeme können für einen Identitätsnachweis oder einer Vaterschaftsanalyse mit molekular genetischen Methoden untersucht werden.
Unter Gentechnologie versteht man die Gesamtheit der Methoden zur Charakterisierung und Isolierung von genetischem Material zur Bildung neuer Kombinationen sowie zur Wiederein- führung und Vermehrung des neu kombiniertem Erbmaterials in anderer biologischer Umge- bung. Dies bedeutet, dass mit Hilfe gentechnischer Methoden Gene unabhängig von ihrer Herkunft und losgelöst von den natürlichen Paarungsschranken der Organismen fast beliebig miteinander kombiniert werden können. Das Ergebnis sind neue Eigenschaften, die mit natür- lichen Züchtungsmethoden oft nicht oder nur in sehr langen Zeiträumen erreicht werden kön- nen.
Ziel der Gentechnik ist es, die Möglichkeiten zur Veränderung des Erbmaterials für neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Medizin, Pharmazie, Lebensmittelherstellung, Umwelttechnik sowie Pflanzen- und Tierzüchtung zu nutzen. Gleichzeitig müssen dabei aber der Schutz von Mensch und Umwelt vor den Risiken und Gefahren der Gentechnik gewahrt und missbräuchliche Anwendung verhindert werden.
3.2 Anwendung der Gentechnik auf den Menschen
Mit der Gentechnik verbinden sich große Hoffnungen und beträchtliche wissenschaftliche und wirtschaftliche Chancen. Sie ist innerhalb weniger Jahre zu einem unentbehrlichen Werkzeug in den verschiedenen Bereichen der Biowissenschaften geworden. Gleich, ob es sich um Probleme der Mikro- oder der Immunbiologie, der Krebsforschung oder um die Untersuchung von Erbkrankheiten handelt, überall werden gentechnische Methoden zunehmend genutzt.
Aus den dadurch gewonnenen Erkenntnissen über Aufbau und Funktion der menschlichen Gene sollen in Zukunft Mittel und Wege zu einer wirksamen Behandlung zahlreicher Krank- heiten, vielleicht sogar Therapien, gefunden werden. So kann z. B. die Diagnose für eine Erb- krankheit bereits gestellt werden noch ehe das Leiden überhaupt ausgebrochen ist, oder die Krankheit kann durch Ersatz der defekten Gene therapiert werden. Auch im medizinisch - industriellen Bereich hat die Gentechnik bereits einen Platz als Schlüsseltechnologie der Zu- kunft eingenommen. Bakterien können z. B. gentechnisch so verändert werden, dass sie in- dustriell nutzbar sind, etwa in der Pharmaindustrie zur Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen. Sie produzieren dann in enormer Stoffwechselleistung Substanzen, die sonst gar nicht oder nur sehr aufwendig herstellbar sind. Das beste Beispiel hierfür ist die gentechni- sche Herstellung von Insulin, einem unverzichtbaren Medikament für zuckerkranke Men- schen.
Fachleute gehen davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis mit Hilfe der Gentechnik auch bei bisher noch unheilbaren Krankheiten wie z. B. Multiple Sklerose, Krebs, Aids oder Trisomie 21 Durchbrüche erzielt werden. Hilfe hierfür verspricht man sich von einer genauen Untersuchung und Kartierung des menschlichen Erbgutes.
Doch obwohl dieser Fortschritt eine enorm große Möglichkeit für die Erforschung und Heilung vieler Krankheiten ist, birgt er auch viele Gefahren in sich. Denn durch die Entschlüsselung unserer Gene werden nicht nur Fragen zur Entstehung bestimmter Krankheiten beantwortet, es werden damit auch Informationen über die Merkmalsausprägung und die gesamte Entwicklung eines Menschen preisgegeben. Diese Erkenntnisse können großartige Erfolge hervorbringen, aber auch furchtbare Katastrophen zur Folge haben.
3.2.1 Gentechnik im Kampf gegen neue Infektions - und alte Volkskrankheiten
Vergleichbar dem stürmischen Aufbruch der Arzneimittelchemie um die Jahrhundertwende hat das vor gerade 20 Jahren publizierte Schlüsselexperiment der Gentechnik einen in seine Ausmaßen noch nicht voraussehbaren Innovationsschub in der Humanmedizin ausgelöst. Ohne das gentechnische Methodenarsenal ist die angewandte und grundlagenorientierte Pharmaforschung in Zukunft nicht mehr denkbar.
Die Gentechnik hat sich, von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt, als Basis der experimen- tell orientierten, biomedizinischen Grundlagenforschung bewährt und Ansätze zur Aufklärung bisher unverstandener Krankheitsursachen und -entwicklungen geliefert. In den Industrienati- onen sind Krebs, Herz - Kreislauf - Erkrankungen und Diabetes die drei häufigsten Todesur- sachen, eine Situation, an der auch die jahrzehntelange Forschung mit den klassischen Me- thoden der Medizin nichts geändert hat. Am Beispiel der Krebsforschung wird das Potential der Gentechnik besonders deut lich, da sie einen ersten, wesentlichen Schritt zur Klärung der wissenschaftlichen Grundlagen der Tumorentstehung ermöglichte. Es stellte sich heraus, dass die sogenannten aggressiven Onkogene oder „Krebsgene“ nichts anderes sind als außer Kon- trolle geratene Steuerungsgene im menschlichen Körper. Äußere Faktoren wie bestimmte Stoffwechselprodukte von Schimmelpilzen, energiereiche Strahlen oder Chemikalien - bei- spielsweise wie im Zigarettenrauch - können den Kontrollmechanismus der Krebsgenvorstu- fen, die auch als Protoonkogene bezeichnet werden, durch Mutationen ausschalten und ein ungehemmtes Wachstum der betroffenen Zellen zum Tumor auslösen. Die Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung lassen sich aber im allgemeinen nicht direkt in geeigneten prävent i- ve und therapeutische Maßnahmen umsetzen, da die Verbindung der verschiedenen biochemi- schen Reaktionen im menschlichen Organismus umfangreiche Begleitstudien erfordert, bis ein neues Behandlungsprinzip die Praxisreife erlangt.
Konkrete Therapieerfolge in der Humanmedizin kann die Gentechnik im Rahmen der Gewinnung von Arzneimitteln und Impfstoffen durch rekombinante Mikroorganismen und Zellkulturen realisieren. Dominiert wird dieses Anwendungsgebiet zur Zeit noch durch die Herstellung humaner Proteine, von denen bis heute 16 verschiedene als körpereigene Wirkstoffe in Medikamenten zugelassen sind.
Auch die Entwicklung von Impfstoffen erlebt mit der Gentechnik einen neuen Aufschwung, da die Möglichkeiten der herkömmlichen Methoden weitgehend ausgereizt sind. Heute bereits vorhandene Impfstoffe können durch gentechnische Herstellungsverfahren infektionssicherer gemacht und Schutzimpfungen gegen Krankheiten können eingeführt werden, für die es bislang keine zuverlässige Vorbeugung gab. Ein vorbeugender Impfschutz gegen Tropenkrankheiten und „neue“ Seuchen, deren Brisanz etwa der Pestausbruch 1994 in Indien oder der kontinuierliche, unkontrollierbare Anstieg der Aids - Fälle weltweit dokumentieren, ist dringend erforderlich und ohne gentechnische Forschung nicht denkbar.
Eine breite praktische Anwendung gentechnischer Methoden har sich schon fest im Bereich der Diagnostik durchgesetzt und erweitert die Möglichkeiten der Ärzte, Krankheiten frühze i- tig und richtig zu erkennen, die Behandlung zu überwachen und die Heilungsaussichten zu beurteilen. Die diagnostische Forschung verfolgt zwei Ansatzpunkte, die auf der einen Seite in die Verbesserung und Erweiterung bestehender Testverfahren münden, indem die he r- kömmlichen Reagenzien durch rekombinante Enzyme ersetzt werden. Auf der anderen Seite erlaubt die Genanalyse den Nachweis von Schäden am Erbmaterial und das Eindringen frem- den Erbguts bei Infektionen. Durch empfindliche molekulargenetische Methoden lassen sich krankhafte Entwicklungen in den Zellfunktionen durch defekte Gene erkennen, lange bevor Krankheitssymptome in Erscheinung treten.
Die Bereitstellung wirksamer Arzneimittel durch die Pharmaindustrie ist Basis der großen Forschritte in der Medizin des 21. Jahrhunderts, die einen entscheidenden Beitrag zur Le- bensqualität und -erwartung der Bevölkerung in Industrienationen liefert. Der Hauptanteil der im Handel befindlichen Medikamente enthält Wirkstoffe, für deren Auffinden und Entwick- lung die vier klassischen Quellen der Pharmaforschung - Heilpflanzen, Säugetiere, Mikroor- ganismen sowie chemische Synthesen - genutzt wurden. Mehr als ein Vietel aller Arzneimit- tel stammt schon jetzt aus biotechnologischen Produktionsverfahren, so dass die Gentechnik auf diesem Sektor die methodischen Voraussetzungen liefert, natürlich vorkommende Ro h- stoffe in stärkerem Maße als bisher zu nutzen. Gentechnik schafft also keinen völlig neuen Industriezweig, sondern ist vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung der Biotechnologie zur Erzeugung bewahrter, aber zusätzlich auch neuartiger biopharmazeutischer Produkte.
Die neue durch Gentechnik möglich gewordene Medikamentengeneration orientierte sich in der Anfangsphase an therapeutisch bereits eingeführten Naturstoffen aus der Gruppe der Pro- teine und Peptide. Für den medizinischen Bedarf erfolgte die Isolierung der Prototypen aus natürlichen Quellen, z. B. aus toten Säugetieren und Mikroorganismen, meist in zu geringen Mengen und teilweise in unreiner Form, so dass ein potentielles Infektionsrisiko oder die Ge- fahr immunologischer Abwehrreaktionen bei Produkten tierischen Ursprungs vorhanden war. Diese Präparationsprobleme können durch genetische Verfahren umgangen werden, was zwar noch keine grundlegend neuen Therapieformen eröffnet, aber mit rekombinanten Proteinen eine höhere Qualität in die Produktionsprinzipien von Pharmawirkstoffen einführt.
Mit den konventionellen Präparationsmethoden ließen sich bislang nur wenige Pharmaproteine aus tierischen oder humanen Geweben und Körperflüssigkeiten sowie Zellkulturen gewinnen wie aus der nachfolgenden Tabelle zu erkennen ist.
Tabelle: Beispiele für klassische Methoden zur Gewinnung von Pharmaproteinen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Mit den Methoden zur gezielten Isolierung einzelner Gene, ihrer Klonierung und dem Gen- transfer über Artgrenzen hinweg ist die Gentechnik angetreten, Pharmaproteine, die bisher entweder gar nicht oder nur begrenzt zugänglich waren, in hoher Reinheit in ausreichenden Mengen und in vielen Fällen kostengünstiger herzustellen. Beim gegenwärtigen Stand der Technik erfolgt die Biosynthese der für die Therapie zugelassenen rekombinanten Wirkstoffe in den meisten Pharmaunternehmen mit Hilfe verschiedener Arten des Darmbakteriums E-scherichia coli oder der Bäckerhefe.
Die Gentechnik erweitert aber auch die Möglichkeiten der aktiven Immunisierung durch ve r- besserte oder neuartige Impfstoffe und in noch stärkerem Maße bei der passiven Immunthera- pie mit der Herstellung maßgeschneiderter Antikörper. Durch das Klonen und die Charakteri- sierung des viralen Erbgutes ist eine gezielte Synthese der entsprechenden Genprodukte in ausreichenden Mengen möglich. Als biologische Produzenten dienen auch hier Kolibakterien, Hefen, Säuger und neuerdings auch vermehrt Insektenzellen, aus denen die gewünschten Vi- rusproteine isoliert und nach der Reinigung direkt als Impfstoffe eingesetzt werden können. Beispielhaft für diesen Ansatz ist der erste gentechnisch hergestellte Hepatitis B - Impfstoff, der 1986 zugelassen wurde. Neben einer Verbesserung der vorhandenen Produktionsverfah- ren besteht ein ungebremster Bedarf für die Entwicklung neuer Impfstoffe, z. B. gegen Aids, Lungenentzündung und Tuberkulose. Diese Faktoren zeigen, dass die Gentechnik wesentlich mehr ist als eine genmanipulierende Wissenschaft zur systematischen Veränderung des menschlichen Erbgutes.
3.2.2 Erbkrankheiten
Die Gentechnik spielt aber nicht nur auf dem Sektor der Infektions- und Volkskrankheiten eine wichtige Rolle, sondern auch im Kampf gegen den Ausbruch und die Symptome von genetisch bedingten bzw. vererbbaren Erkrankungen. Allerdings ist die Forschung auf diesem Gebiet aus ethischen Gründen noch nicht annäherungsweise so weit wie auf dem exogenen Gebiet. Unter genetisch bedingten Erkrankungen versteht man alle Erkrankungen, die von den Vorfahren auf ihre Nachkommen übertragen werden. Erbkrankheiten im strengen Sinne sind dagegen all die Erkrankungen, die sich nicht erst im Laufe des Lebens gebildet haben, son- dern sich bereits in deren Erbanlage befinden. Sie werden dominant oder rezessiv vererbt wie die anderen Merkmale eines Organismus, und es lässt sich oftmals aus dem Stammbaum einer betroffenen Familie schließen, welche der beiden Möglichkeiten zutrifft. Diese Gene können auf einem Körperchromosom (Autosom) oder einem Geschlechtschromosom (Gonosom) lie- gen, daher werden autosomale und x - chromosomale Erbgänge unterschieden.
Erbkrankheiten sind den Menschen schon seit dem Altertum her bekannt und immer wieder gab es Maßnahmen, die Verbreitung dieser Krankheiten einzudämmen, bis hin zu den schlimmen Rassegesetzen der Nationalsozialisten in den Jahren 1933 bis 1945 oder in Schweden bis in die späten siebziger Jahre. Wegen der erhöhten Gefahr von Erbkrankheiten sind und waren Geschwisterehen u.ä. in nahezu allen Kulturen tabuisiert. Heutzutage unter- teilt man genetisch bedingte Erkrankungen in drei große Gruppen: in die chromosomalen, die monogenen und polygenen.
Bei Erbkrankheiten im "klassischen Sinne" besitzen, wie erwähnt, alle Zellen der Vorfahren lebens lang mindestens ein Gen, das mutiert ist. Bei den chromosonalen Veränderungen ist dies nicht der Fall. Chromosomale Veränderungen entstehen bei den Eltern, bzw. einem El- ternteil erst im Laufe ihres Lebens in den Samen- oder Eizellen. So steigt z. B. die Wahr- scheinlichkeit dafür, dass das Chromosom 21 in den Samen- bzw. Eizellen statt in einzelner in doppelter Ausführung vorliegt mit dem Alter der Mutter, oder in geringerem Maße des Vaters an.
Bei dieser Gruppe von Krankheiten ist ein ganzes Chromosom oder sind Teile eines Chromo- soms so verändert, dass entweder ganze Teile fehlen oder mehrfach vorhanden sind. Weiter- hin können sich Teile des zusätzlichen dritten Chromosoms an andere Chromosomen anhe f- ten.
Ein typisches Beispiel für diese Gruppe ist das Down-Syndrom, volkstümlich als Mongolis- mus bezeichnet, bei dem das Chromosom 21 bei der erkrankten Person statt in doppelter Form in dreifacher Form (Trisomie 21) vorliegt. Es gibt auch Trisomien anderer Chromoso- me, wie z. B. die des Chromosoms 13, das Patau - Syndrom, oder des Chromosoms 18, das Edwards-Syndrom. Träger derartiger Veränderungen sind, mit Ausnahme der Trisomie 21, nicht überlebensfähig. Die Häufigkeit dieser Erkrankungen liegt im Promillebereich.
Bei monogenen Erbkrankheiten ist nur ein verändertes Gen für den Ausbruch der vererbbaren Erkrankung verantwortlich. Dieser Gendefekt führt zum Verlust oder der Fehlbildung eines bestimmten Enzyms oder Proteins. Typische Vertreter dieser Erkrankungsgattung sind z .B. die Mukoviszidose, die Phenylketonurie, der Albinismus und auch die Chorea Huntington. Die Häufigkeit dieser Erkrankungen liegt bei eins zu 2 000 bis zu eins zu 20.000.
Gene als Träger bestimmter Erbinformationen können innerhalb bestimmter Grenzen variie- ren, ohne dass derartige Variationen zu einer Erkrankung des betroffenen Menschen oder sei- ner Nachkommen führt. Da oft eine ganze Reihe von Genen für bestimmte Funktionen ve r- antwortlich sind, können sich mehrere variierte Gene - die jedes für sich zu keiner Erkrankung führt - so in ihrer Wirkung verstärken, dass es in diesem Fall zu einer Erkrankung oder aber zu einer erhöhten Anfälligkeit (Disposition) für bestimmte Erkrankungen kommen kann. Man spricht in diesem Fall von polygenen Erbkrankheiten. Dabei spielen neben der genetischen Disposition auch sicherlich äußere (exogene) Einflüsse eine Rolle. Hier ist noch Forschungs- arbeit zu leisten. Typische Beispiele dieser Art der polygenen Erbkrankheiten sind z. B. Herz- kranzgefäßverengungen z. B. als Folge von Stoffwechselerkrankungen, Diabetes, die Schizo- phrenie und zum Teil auch Krebserkrankungen.
Im folgenden werden einige Beispiele für veränderbare Gene und den daraus möglicherweise resultierenden Stoffwechselstörungen aufgezählt.
Tabelle: Krankheiten verursacht durch Gendefekte (Auswahl)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* insulin dependent diabetes mellitus type 1
Diese Tabelle zeigt den großen Unterschied zwischen den Infektions- und Erbkrankheiten. Durch die rasche Entwicklung auf dem Gebiet der Gentechnik kann die Veranlagung zu einer Erbkrankheit zwar schon frühzeitig, sogar im Mutterleib, festgestellt werden, aber es gibt noch absolut keine einzige erfolgreiche Therapiemöglichkeit für auch nur eine von ihnen.
Die Chorea Huntington, z. B., ist eine Nervenkrankheit, die in der Regel um das 40. Lebens- jahr deutlich erkennbar wird, und etwa innerhalb von 15 Jahren nach Beginn zum Tode führt. Die Symptome zeigen sich anfangs in der Neigung zum Torkeln, Schwanken und Zittern. In vielen Fällen kommt es parallel zu diesen mehr körperlichen Leiden auch noch zu einem fort- schreitenden geistigen Abbau bis hin zur Demenz. Hilflosigkeit und allgemeiner Verfall zeichnen das Endstadium der Krankheit aus. Es ist bekannt, dass das Gen für die Huntington - Krankheit auf dem kurzen Arm des Chromosoms 4 liegt und dass es autosomal dominant vererbt wird. Das bedeutet, dass das Erkrankungsrisiko für Kinder eines Betroffenen, unab- hängig von dem Geschlecht, 50 % beträgt. Daher ist es für Risikopersonen (Familienmitglie- der) möglich, Gentests durchführen zu lassen. Die betroffenen Personen können selbst entsche iden, ob sie das Ergebnis mitgeteilt bekommen möchten oder nicht. Auch ein pränatale Untersuchung bereits im Mutterleib ist möglich, sie soll aber bei Nachweis des krankheitsaus- lösenden Gens bei dem Feten zum Abbruch der Schwangerschaft führen. Dies ist ethisch al- lerdings sehr umstritten.
Trotzdem ist diese Art von Untersuchungen zur Zeit die einzige Möglichkeit, bei Nachweis eines krankhaften Gens und den dann empfohlenen Abbruch der Schwangerschaft, den Ausbruch von Erbkrankheiten zu verhindern.
Unter Pränataldiagnostik versteht man die medizinischen Untersuchungen, die während der Schwangerschaft durchgeführt werden können, um eine mögliche Schädigung oder Erkrankung des ungeborenen Kindes erkennen zu lassen. Zu den Untersuchungsmethoden gehören sowohl bildgebende Verfahren wie Ultraschall als auch die Fruchtwasseruntersuchung oder als Spezialfall die Präimplantationsdiagnostik (PID).
Anfang der 80'er Jahre fanden die ersten Untersuchungen dieser Art statt. Seitdem sind sie nicht unumstritten, da sie die werdenden Eltern vor gravierende Entscheidungen stellen können. Als selektierende Methode lehnen viele Menschen die Pränataldiagnostik ab. Da bei einem auffälligen Befund oftmals eine Abtreibung die Folge ist, sind auch die Kirchen, u.a. die katholische, gegen derartige Untersuchungen.
Im folgenden sollen die medizinischen und ein paar rechtliche Aspekte der Pränataldiagnostik vorgestellt werden. Die Entscheidung darüber, ob eine schwangere Frau von dieser Möglichkeit einer medizinischen Untersuchung Gebrauch macht, liegt allein in ihrer und ein Stück weit in der Hand des betreuenden Arztes.
Die Amniozentese (Fruchtwasserentnahme) wird werdenden Eltern empfohlen wenn:
die Schwangere älter als 35 oder der Vater über 41 Jahre alt ist, die Frau bereits Chromosomstörungen hat oder bei ihr Chromosomentranslationen erkannt sind bzw. vermutet werden, eine familiäre Disposition besteht für pränatal diagnostizierbare Erkrankungen oder ein Familienmitglied einen Neuraldefekt hat, z.B. einen offenen Rücken (Spina bifida).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Amniozentese - mit einer Nadel wird Fruchtwasser entnommen.
Ab der 14. Schwangerschaftswoche etwa kann die Amniozentese durchgeführt werden. Sie findet unter sterilen Bedingungen und ohne Betäubung statt. Durch die Bauchdecke der Frau wird unter Ultraschallkontrolle eine dünne Punktionsnadel bis in die Fruchtblase vorgescho- ben, um ca. 15 - 20 ml Fruchtwasser als Probe abzusaugen. Eine Berührung oder gar Verle t- zung des wachsenden Kindes ist dabei in der Regel ausgeschlossen. Die meisten Frauen emp- finden diese Untersuchung wie eine intravenöse Injektion; sie wird als unangenehm aber nicht als schmerzhaft beschrieben.
Untersucht werden Zellen des den Fötus umgebenden Fruchtwassersacks (Amnion), sowie abgeschilferte Hautzellen des Fötus und Zellen aus dem Magen-Darm-Trakt. Im Labor werden die Zellproben "angezüchtet". Nach erfolgreicher Vermehrung können die Chromosomen isoliert und analysiert werden. Die Ergebnisse der Untersuchung erhält man in der Regel zwei bis drei Wochen nach der Fruchtwasserentnahme.
Die diagnostische Genauigkeit der Amnionzentese liegt durchschnittlich bei ca. 99 %, bei der Bestimmung von Neuraldefekten etwas niedriger bei 90 %. Die folgenden Diagnosen lassen sich mit ihrer Hilfe feststellen: Chromosomenveränderungen, z.B. das Down-Syndrom (Mon- golismus), eine Reihe von Neuraldefekten, wie ein offener Rücken (Spina bifida), erbliche Stoffwechselerkrankungen. Das Risiko, dass bei einer Amniozentese ein Abort ausgelöst wird, liegt durchschnittlich bei ca. 0,5 - 1 %. Außerdem besteht eine gewisse Infektionsgefahr für Mutter und Kind. In spezialisierten Kliniken und Praxen werden bis zu 15 Amniozentesen pro Tag durchgeführt; entsprechend ist dort das Risiko wesentlich geringer als das allgemein ermittelte.
Zeitlich früher als die Amniozentese lässt sich die Ent nahme von Mutterkuchengewebe etwa ab der siebten bis neunten Schwangerschaftswoche anwenden. Die Beschaffenheit der Chromosomen kann auch schneller bestimmt werden, da man lebende Zellen des Föten erhält, die sehr schnell wachsen.
Die Chorionzottenbiopsie wird, aus den gleichen Gründen wie bei der Amniozentese, wer- denden Eltern empfohlen. Um Zellen des Fötus zu gewinnen, gibt es die zwei folgenden Me- thoden: Transabdominal: Bei dieser Form der Chorionzottenbiopsie wird unter ständiger Ult- raschallkontrolle durch die Bauchdecke der Schwangeren eine dünne Punktionsnadel gesto- chen und bis in die Placenta geführt. Eine Gewebeprobe wird entnommen und im Labor ent- sprechend analysiert. Für die Frau ist die Prozedur nahezu identisch mit der der Amniozente- se, nur dass andere Zellen an einer anderen Stelle entnommen werden. Transzervikal: Im Un- terschied zur transabdominalen Methode wird hier keine Nadel durch den Bauch gepiekt, sondern ein dünner Katheter durch die Scheide und den Gebärmuttermund in die Placenta geschoben.
Auch die Chorionzotten stammen wie der Fötus ursprünglich aus der befruchteten Eizelle. Daher lassen sie eine Aussage über den Fötus zu, man untersucht ihn sozusagen indirekt. Nach der Entnahme werden die Zellen im Labor, ähnlich wie bei der Amniozentese, entspre- chend aufbereitet und analysiert. Die Ergebnisse liegen normalerweise schon nach etwa sie- ben Tagen vor. Sie lassen die gleichen Diagnosen wie bei der Mniozentese zu. Das Risiko eines Aborts liegt bei der Chorionzottenbiopsie bei ca. 1 - 1,5 %. Auch hier gilt, dass es umso geringer ist, je häufiger der verantwortliche Arzt die Methode anwendet. In Deutschland wer- den etwa fünfzig bis hundert Mal so viele Amniozentesen wie Chorionzottenbiopsien durch- geführt.
Durch Ultraschall können Größen gemessen und verglichen sowie "sichtbare" Embryo- Fehlbildungen erkannt werden. Mit Hilfe der Methode des sogenannten Farbdopplers kann außerdem der kindliche Blutfluss bestimmt werden. Eine Ultraschalluntersuchung beinhaltet nach derzeitigem Wissen keinerlei Risiko für Mutter und Kind. Die Untersuchung kann von außen "durch" die Bauchdecke erfolgen oder durch Einführung eines Schallkopfes in die Scheide.
Bei dieser derzeit in Deutschland heftig umstrittenen Spezialform einer Pränataldiagnostik wird die weibliche Eizelle außerhalb des weiblichen Körpers mit einer Samenzelle befruchtet. In der normalen Reproduktionsmedizin wird sie dann in den Uterus eingepflanzt, in der Hoffnung, dass sich ein gesundes Kind entwickelt. Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) hingegen wird, wenn sich aus der befruchteten Eizelle etwa acht Zellen gebildet haben, eine entnommen und auf eventuelle Erbfehler untersucht. Die Frau kann dann entscheiden, ob sie eine Einpflanzung wünscht oder die Embryonalzellen abgetötet werden sollen.
Die Symptome einer genetisch bedingten Erkrankung können lediglich durch Medikamente im Anfangsstadium der Krankheit behandelt werden, allerdings arbeitet man fieberhaft an der Entwicklung anderer Behandlungsmöglichkeiten. Vor allem die Forschung mit humanen Embryonen ist ein großer Hoffnungsträger für viele Betroffene, löst aber auch ethische Grundsatzdiskussionen aus.
3.2.3 Begrenzung genetischer Risiken durch die Gesetzgebung
Das Sicherheitskonzept der Gentechnik wird auf drei Stufen gewährleistet, unter denen die Ebene der biologischen Sicherheitsmaßnahmen aus wissenschaftlicher Sicht die höchste Priorität einnimmt. Technische Vorkehrungen sollen eine unbeabsichtigte Ausbreitung rekomb i- nanter Organismen im Labor und in der Umgebung verhindern sowie ihre vollständige Ze r- störung nach Versuchsende sicherstellen.
Neben diesen biologischen und technischen Maßnahmen lassen sich die Sicherheitsziele der Gentechnik mit organisatorischen Vorkehrungen kombinieren. Dazu zählen einerseits geeig- nete Ausbildungsstandards der Beschäftigten, die vollständige Dokumentation der durchge- führten Arbeiten und die Einsetzung von Sicherheitsbeauftragten sowie zur Wahrnehmung der staatlichen Kontrolle von Anlagen und Verfahren die Schaffung spezieller Gentechnikge- setze. Diese gesetzlichen Regelungen können aber nur dann ihren Zweck sinnvoll erfüllen, wenn sie nicht durch generelle Verbote gentechnische Arbeiten von vornherein behindern oder ausschließen, sondern die Voraussetzung für die Einhaltung der Sicherheit beim Umgang mit der Gentechnik schaffen.
In Deutschland werden mangelnde wirtschaftliche Erfolge der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Bereich der Gentechnik und die Abwanderung fähiger, in der Grundlagenfo r- schung tätiger Wissenschaftler ins Ausland häufig mit bürokratischen Hemmnissen und übertriebenen Sicherheitsauflagen begründet. Mit deutscher Gründlichkeit haben die Behörden in den einzelnen Bundesländern und Bonn ein Regelwerk für die genetische Forschung und Entwicklung erarbeitet, das an Unübersichtlichkeit kaum zu überbieten ist.
Am 1. Juli 1990 ist in Deutschland das „Gesetz zur Regelung von Fragen der Gentechnik“ oder kurz Gentechnikgesetz (GenTG) in Kraft getreten, das durch eine Reihe von Verordnun- gen den rechtlichen Rahmen für die Forschung und industrielle Anwendung der Gentechnik bietet.
Das Gesetz verfolgt einen Schutzzweck, indem es den Menschen und seine Umwelt vor möglichen Gefahren der Gentechnik schützen soll und erfüllt gleichzeitig einen Förderzweck, der den rechtlichen Rahmen für die Entwicklung und Unterschützung genetische Projekte scha f- fen soll. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich nur auf die gezielte Neukombination des genetischen Materials und den Umgang mit den rekombinanten, vermehrungsfähigen Organismen, während wirtschaftlich releva nte, molekulare Bestandteile der genetisch veränderten Organismen, wie pharmazeutisch nutzbare Proteine, technische Enzyme oder niedermolekulare Stoffwechselprodukte vom Gentechnikgesetz nicht erfasst werden.
Das Kernstück des Gentechnikrechts bildet die Sicherheitsverordnung, die Regelungen zur Risikobewertung einzelner Arbeitsabläufe und die dazu erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen enthält. Entsprechend ihrer möglichen Gefährlichkeit werden alle genetisch veränderten Or- ganismen in vier Sicherheitsstufen von S1 bis S4 eingeteilt. In der niedrigsten Stufe S1 be- steht nach dem gegenwärtigen Stand der Technik kein Risiko für Mensch und Umwelt, wäh- rend bei den höheren Sicherheitsstufen von einem geringen (S2), mäßigen (S3) oder hohen (S4) Gefährdungspotential auszugehen ist.
Als biologische Sicherheitsmaßnahme wird in der Mehrzahl aller genetischen Experimente ein Wirt aus der Risikogruppe 1, zu der mit dem Darmbakterium Escherichia coli und der Bäckerhefe Saccaromyces cerevisiae auch die wichtigsten Produktionsstämme gehören, eingesetzt. Zuständig für die Klassifizierung der Sicherheitsstufen sind die Länderbehörden mit Ausnahme von S3- bzw. S4- arbeiten, die von der Zentralen Kommission für Biologische Sicherheit (ZKBS) eingestuft werden.
Die Länder sind ebenfalls für die Anmeldung bzw. Genehmigung der gentechnischen Arbeiten und Anlagen zuständig, während die Kontrolle von Freisetzungsversuchen und das InVerkehr-Bringen rekombinanter Produkte in die Kompetenz von verschiedenen Bundesbehörden wie die dem Land wirtschafts-, Umwelt- oder Gesundheitsministerium nachgeschalteten Ämter fällt. Als gentechnische Anlage versteht man nach dem Gesetz nicht nur Forschungslabors oder Produktionsstätten, sondern auch Lagerräume bzw. Autoklaven zum Vernichten der rekomb inant en Organismen.
An Hand der Pränataldiagnostik und ihren Konsequenzen lässt sich aber verdeutlichen, dass die Gesetze ethische Fragen noch lange nicht beantworten.
Die Neufassung des § 218 vom Herbst 1995 lässt aufgrund der Tatsache, dass ein fehlgebildetes Kind zu erwarten ist, keine Abtreibung zu. Innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate kann sich eine Frau aber zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, wenn sie sich vorher beraten lässt und einen entsprechenden Beratungsschein vorweisen kann. Die Abtreibung ist dann rechtswidrig aber straffrei.
Nach der Dreimonatsfrist ist ein Abbruch nur noch aufgrund einer medizinischen Indikation möglich. Diese ist bei einer zu erwartenden späteren Behinderung des Kindes gegeben. Mit Hilfe des Scheins über die Voraussetzungen einer medizinischen Indikation verfährt die Frau dann entsprechend wie innerhalb der Dreimonatsfrist.
Bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) gilt nicht der § 218, sondern das Embryonenschutz- gesetz.
3.3 „Neue Menschen braucht das Land“ - Verletzung ethischer Grundsätze durch die Gentechnik?
Das 21. Jahrhundert hat gerade begonnen, es soll das Jahrhundert der realistischen Zukunft s- visionen sein, wie es auf der EXPO 2000 eindrucksvoll demonstriert wurde. Aber schon jetzt steht fest, dass die Grenze des Machbaren weit über die Grenze der Ethik und der Moral hinausreichen kann, denn durch die Entschlüsselung unseres Erbgutes werden der Forschung und Medizin Wege offenbart, die jedem Wissenschaftler die Möglichkeit bieten, in die Schöpfung des Menschen einzugreifen und damit fast göttlichen Charakter zu erlangen. Doch soll die Menschheit wirklich diesen letzten Schritt gehen?
Wer heute eine Zeitung aufschlägt, wird mit Meldungen konfrontiert, die zum Beispiel lauten: „das Humangenom - Spielball der Forscher“, „Herz aus der Retorte“ oder auch „Klinikärzte protestieren gegen das Klonen von Embryonen“. Die wohl frappierendste Schlagzeile der letzten Zeit lautete: „menschliche Samenzellen von Ratten“.
Einem Forscher in Japan war es erstmals gelungen, Ratten und Mäuse zur Produktion von menschlichen Samenzellen anzuregen. Weder Nutzen noch Reaktion der Gesellschaft auf das Experiment seien nach Angaben des beteiligten Wissenschaftlers geklärt. "Die Verwendung von Sperma aus Tieren zur Zeugung gesunder Menschen würde sicher bei vielen, auch bei mir, emotionale Konflikte hervorrufen", erklärte dieser. Man muss also gar nicht den Jahrtau- sendbegriff strapazieren, schon in diesem Jahrzehnt lassen die Entwicklungen in Biomedizin und Biologie keinen Zweifel daran, dass die Frage, wo Menschenbild und Menschenwürde in Forschung und Klinik anzusiedeln sind, gestellt werden muss. Pluralität in der Forschung und die Globalisierung erschweren das Herausfinden von Leitmotiven für den biomedizinischen Fortschritt. W. Krämer weist diesem die Qualität einer "Fortschrittsfalle" zu - das heißt einer unfinanzierbaren, um jeden Preis lebensverlängernden Hochtechnologiemedizin ohne Le- bensqualität (Medizinrecht 1996; 1: 1-5). Immer neue Sensationsmeldungen über angeblich bahnbrechende Diagnose- und Behandlungsmethoden haben eine gesellschaftliche Gleichgül- tigkeit mit allgemeiner Orientierungslosigkeit ausgelöst, welches eine gemeinsame Rückbe- sinnung auf ethische Grundkonsense oder deren Ausbildung dringend erfordert.
Zu Beginn dieses Jahrzehntes wurde die Gentechnik und ihre Anwendung am Menschen zum Paradigma für einen Wertewandel in der Medizin erkoren. Die Entschlüsselung des menschli- chen Genoms, die bereits im Jahr 2001 komplett zum Abschluss gekommen sein soll, hat nun dazu geführt, dass mittlerweile sehr viel mehr Krankheiten und Krankheitsdispositionen durch Gendiagnostik festgestellt werden können, als tatsächlich therapierbar sind. Man spricht von einer so genannten diagnostisch-therapeutischen Schere. Allerdings hat die bisherige Ent- wicklung mit Ausnahme einiger ermutigender Erfolge, zum Beispiel in der Genmarkierung oder im Bereich der Therapie angeborener Immunmangelkrankheiten, keine statistisch signi- fikante Verbesserung durch gentherapeutische Methoden geze igt. Deshalb hat die Erörterung über Chancen und Risiken der Gentherapie immer auch weitgehend antizipatorischen Charak- ter. Gentherapie als der Schritt von genetischer Diagnose zur gezielten Konstruktion mensch- lichen Erbgutes in Körperzellen kann im Prinzip zwei Zielrichtungen haben: einerseits Hei- lung, was Krankheits- und Leidensdruck voraussetzt, andererseits die Steigerung von Fähig- keiten (sogenanntes enhancement). Dabei ist die somatische Gentherapie von Eingriffen in Keimbahnzellen zu unterscheiden. Keimbahneingriffe sind nach dem Embryonenschutzgesetz in Deutschland sowie nach der europäischen Menschenrechtskonvention zur Biomedizin ve r- boten.
3.3.1 Gentest und genetischer Fingerabdruck
„Die Vornahme eines Versuchs ist bei fehlender Einwilligung unter allen Umständen unzulä s- sig.“ Was das Reichsministerium des Innern am 28. Februar 1931 im spröden Juristenton kundtut, ist ein Meilenstein. Denn zum ersten Mal stellt in Deutschland ein Gesetzgeber klar: Allein der Patient soll entscheiden dürfen, ob er sich für ein medizinisches Experiment am eigenen Leib zur Verfügung stellt.
Bereits elf Jahre später, ab Januar 1942 degradieren Naziforscher Menschen zu Versuchstieren. Im Konzentrationslager Buchenau impfen sie ihre Opfer mit Fleckfieber - Erregern. In Auschwitz schindet KZ - Arzt Josef Mengele Zwillinge mit Typhusbakterien. Das sind nur zwei Beispiele aus einer langen, grausigen Versuchsliste, die erst 1945 abbricht.
Ein Blick in die Vergangenheit macht klar: Die „ethische Frage“ hinkte dem Menschen immer wieder hinterher. „Seit der Einführung naturwissenschaftlichen Denkens in die Medizin An- fang des 19. Jahrhunderts driften das Machbare und die Ethik auseinander“, erläutert der Me- dizinhistoriker Dr. Th. Schlich, Privatdozent am Institut für Geschichte der Medizin in Frei- burg.
Das Experiment wurde damals zur Grundlage der Heilkunst. Und beim Experimentieren gin- gen Ärzte und Wissenschaftler nicht gerade zimperlich zur Sache. Um zu klären, ob Krebs übertragbar ist, verpflanzten im 19. Jahrhundert Chirurge n in Frankreich und Deutschland Frauen mit einseitigem Brustkrebs Tumorgewebe in die noch gesunde Brust. Auf der Suche nach Infektionserregern impften Ärzte gesunde Probanden ohne deren Zustimmung mit dem Blut infizierter Menschen.
Erst nach Jahrzehnten regte sich Protest. Den größten Wirbel löste der Fall Albert Neisser aus. Der Direktor der Breslauer Dermatologischen Klinik hatte 1892 auf der Suche nach dem Sy- philis - Erreger Prostituierten und minderjährigen Mädchen das Serum von Syphilis - Patien- ten injiziert. 1899 wurde Neisser zu 300 Mark Geldstrafe verurteilt, weil er - so das Gericht - es versäumt habe, die Zustimmung der Teilnehmer einzuholen. Danach sollte es weitere 32 Jahre bis hin zum ministeriellen Erlass dauern, der Menschenexperimente ohne Einwilligung in Deutschland verbot.
Heute scheint der Kampf um die Rechte des Patienten gegen Forscherwillkür entschieden, zumindest in der westlichen Welt: Ohne „informed consent“ - die Zustimmung durch den informierten, aufgeklärten Patienten - läuft nichts. Vorher darf der Arzt keinen Blinddarm operieren und keine neue Tablette testen.
Doch an anderer Stelle nimmt der technische Fortschritt sehr wohl seinen Lauf - und, im Verbund mit Einzelinteressen, ungebremster denn je zuvor. Zwar kann in Deutschland jeder, sobald er das Licht der Welt erblickt hat, auf den vollen Schutz des Gesetzes bauen. Aber die rechtliche Stellung von menschlichen Embryonen ist gefährlich unklar.
Staat und Gesellschaft haben in der Fortpflanzungsmedizin wesentliche Kompetenzen an den einzelnen delegiert, genauer an die Mütter und Väter. Ein Paar mit unerfülltem Kinderwunsch entscheidet autonom über den Einsatz einer Reagenzglas-Befruchtung (In-Vitro-Fertilisation). Bei europäischen Nachbarn wie Belgien, England und Frankreich bestimmen die Eltern sogar - wenngleich erst nach ausführlicher Beratung durch Ärzte -, ob Gen-Tests auf mögliche Erbkrankheiten beim Embryo stattfinden sollen, bevor er in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt wird (Präimplantations - Diagnostik, PID).
In ihrem jüngsten „Diskussionsentwurf einer Richtlinie zum Einsatz der PID“ verweist auch die deutsche Bundesärztekammer auf die Eltern: Sie seien es, die am Ende aufgrund der Untersuchungsergebnisse über den Transfer des Embryos in die Gebärmutter entscheiden müssten - im Rahmen einer verantwortungsbewussten Einzelfallentscheidung.“
Die Praxis zeigt allerdings: Ein unentwirrbares Konglomerat aus „Einzelfällen“ und „Entscheidungen einzelner“ lässt im Zeitalter der Globalisierung ethische Standards und nationa le Gesetze links liegen.
Schon die deutsche Rechtssprechung ist voller Widersprüche. In der Städtischen Frauenklinik Oldenburg wird 1997 ein Junge, der am Down - Syndrom (Trisomie 21) leidet, in der 26. Schwangerschaftswoche abgetrieben. Das Kind überlebt den Eingriff. Es wächst heute bei einer Pflegefamilie auf.
Eine schizophrene Situation: Zuerst versuchen Mediziner, einen Embryo im Mutterleib zu töten - den sie danach, als er sich außerhalb des Mutterleibes befindet, unbedingt gemäß ärztlichen Ethos als „Frühgeborenes“ durchbringen müssen. Erst nach dem „Oldenburger Fall“ sah sich die Bundesärztekammer veranlasst, ein Verbot von Abtreibungen zu einem solch späten Zeitpunkt zu fordern.
Angst und Hoffnung, Trauer und Wut, Glück- und Erlösung - nur wenige Techniken rufen ähnlich stake Gefühle hervor wie die Einführung von Gentests zur Diagnose erblicher Krankheiten. Einerseits bieten sie die Chance, Risikopatienten frühzeitig zu erkennen und deren Heilungschancen zu erhöhen. Für zahlreiche Leiden aber gibt es noch keine wirksame Behandlung. Hier können Gentests zwar in vielen Fällen sehr genaue Informationen über das persönliche und familiäre Risiko liefern, auf den Verlauf der Krankheit hat das aber keinen Einfluss.
Nicht jeder verträgt den Blick in die Zukunft, wenn quälende Ungewissheit zur scheinbar fatalen Gewissheit wird.
Schlagzeilen machte bereits 1994 die Entdeckung des ersten „Brustkrebsgens" BRCA1 und kurz darauf die von BRCA2. Vier von fünf Frauen, die diese Gene tragen, müssten damit rechnen, im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs zu erkranken, hieß es damals. „Diese Behaup- tung ist schlichtweg falsch, empört sich Claus Bartram, Direktor des Instituts für Humangene- tik der Universität Heidelberg. Schließlich gibt es hunderte verschiedener Mutanten dieser Gene. Manche sind harmlos, viele gefährlich. Einige erhöhen die Wahrscheinlichkeit, auch noch an Eierstock-, Haut- oder Darmkrebs zu erkranken. Andere haben darauf keinen Ein- fluss.
"Noch gibt es viel zu wenige Daten, um das individuelle Risiko präzise zu ermitteln", erklärt Bartram. "Wir müssen den Frauen klar machen, dass unsere Aussagen unscharf sind." Der Nachweis eines „Brustkrebsgens" ist also keinesfalls ein Todesurteil. Ebensowenig bietet die Abwesenheit dieser Gene einen sicheren Schutz vor dem Leiden: Experten betonen immer wieder, dass BRCA1 und BRCA2 bei weit über 90 Prozent aller Brustkrebsfä lle überhaupt keine Rolle spielen. Wie auch beim Darmkrebs sind nur fünf bis zehn Prozent aller Erkrankungen erblich und treten gehäuft in Familien auf.
Besteht der Verdacht, einer solchen Familie anzugehören, sollte man eine Tumorsprechstunde aufsuchen. In zwölf deutschen Kliniken gibt es diese Beratungsstellen, die von der deutschen Krebshilfe gefördert werden.
Dort können sich die Frauen im Gespräch mit Gynäkologen, Humangenetikern und Psycho- therapeuten zunächst ausführlich informieren. Entscheiden sie sich für einen Gentest, folgen nach dessen Auswertung weitere Beratungen und Gespräche mit den Experten. In Düsseldorf haben sich nach eingehender Beratung aber nur 170 von über 500 Frauen für den Test ent- schieden.
Wird dabei tatsächlich ein erhöhtes Risiko aufgedeckt, raten Ärzte zu engmaschigen Vorsorgeuntersuchungen. Dazu gehören halbjährliche Ultraschall- Aufnahmen der Brust sowie ab dem 35. Lebensjahr zusätzlich eine Mammographie. Zur Brustkrebsvorbeugung kommt sowohl die Einnahme des Medikamentes Tamoxifen in Frage als auch in seltenen Fällen eine Amputation der Brust oder der Eierstöcke.
Gentests in Deutschland sind auch bei einer erblichen Form des Dickdarmkrebses möglich, dem Lynch - Syndrom (auch hereditäres Nicht-Polypöses Colon-Carzinom HNPCC genannt) sowie bei der tuberrhösen Sklerose. Etwa jedes 6000ste Neugeborene trägt die Veranlagung für diese schwer zu erkennende Krankheit. Der Gentest hilft, die Gefahr zu erkennen und einzugreifen, noch bevor sich Geschwülste in Nieren und Gehirn, Haut oder Herz ausbreiten. Allerdings erreicht dieser Test bisher erst eine Trefferquote von 50 Prozent.
Einen Blick in die Zukunft zu werfen, dieser Traum wird für manche zum Alptraum. Beim Morbus Huntington (auch Huntington´sche Krankheit) kann ein Gentest mit großer Siche r- heit klären, wer im vierten oder fünften Lebensjahrzehnt an dem schweren Hirnleiden erkranken wird. Das Dilemma: Der Morbus Huntington ist heute noch unheilbar, der geistige und körperliche Zerfall nicht aufzuhalten.
Es ist verständlich, dass nach der in Deutschland zwingend vorgeschriebenen ausführlichen Beratung jeder zweite auf den Test verzichtet. Wer dennoch Klarheit will, muss in Kauf ne h- men, dass der Test zwangsläufig auch Informationen zum Krankheitsrisiko der nächsten Verwandten liefert - einschließlich der eigenen Kinder.
Groß ist die Lücke zwischen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten auch bei der häufigs- ten schweren Erbkrankheit, der Mukoviszidose. Vor allem die Atemwege und die Bauchspei- cheldrüse werden dabei durch zähe Schleimabsonderungen geschädigt. Theoretisch wäre es zwar möglich, alle Neugeborenen mit einem recht billigen Gentest zu untersuchen. Deutsche und amerikanische Experten sind sich aber einig, dass der Wert solcher Informationen angesichts begrenzter Therapiemöglichkeiten zu gering ist, um den Mukoviszidose - Gentest flächendeckend einzuführen.
Dennoch bilden Gentests die Grundlage für molekulare Analysen von genetisch bedingten Krankheitsbildern beim Menschen, und sie fördern die Entwicklung präziser Diagnoseverfah- ren zur Identifizierung von Personen mit erhöhtem Krankheitsrisiko. Damit werden letztend- lich auch die Voraussetzungen für neue und erfolgreiche Therapiekonzepte geschaffen sowie die Beurteilung von Prognose und Verlauf krankheitsauslösender Prozesse optimiert. Mehr als 4500 verschiedene Krankheiten werden durch die Weitergabe von Genen von einer Gene- ration auf die nächste übertragen und sind dadurch als Erbkrankheiten klassifiziert. Die poly- genen Erkrankungen bilden die größte Gruppe der in Wohlstandsgesellschaften vorhandenen Gesundheitsstörungen und umfassen Allergien, Krebs, Herz- Kreislauf- und altersbedingte Störungen wie Alzheimer - Demenz, bei denen eine vererbbare Komponente in Form einer genetischen Prädisposition oder Veranlagung bislang nur vermutet, aber nicht eindeutig nach- gewiesen werden konnte.
Die medizinische Diagnostik zur Erkennung von solchen Erbkrankheiten ist nichts grundsätz- lich Neues. Außer langwierigen Familienuntersuchungen über Generationen hinweg sind seit 1959 verschiedene Chromosomenanomalien lichtmikroskopisch entdeckt und Krankheiten zugeordnet worden wie die Trisomie 21, bei der im Gegensatz zu gesunden Zellen mit ihren Chromosomenpaaren ein zusätzliches Chromosom Ursache des Down - Syndroms oder des Mongolismus ist.
Ein breites Anwendungsgebiet für Diagnosetechniken auf DNA - Basis existiert für monogene Erbkrankheiten, da bei ihnen die Ursache eines Gendefekts und seine Auswirkungen eindeutig zugeordnet werden können.
Die meisten Krankheiten sind außerordentlich selten oder nur auf bestimmte ethnische Bevö l- kerungsgruppen beschränkt, haben aber durch die Grausamkeit ihres Verlaufs und entspre- chender Berichte in den Medien weite Publizität erlangt. Ein Beispiel ist die Cystische Fibro- se oder Mukoviszidose, eine Erkrankung de Drüsengewebe, bei der unter anderem die Schleimabsonderung in der Lunge gestört ist und die Betroffenen unter Erstickungsanfällen leiden. Zu den monogenen Krankheiten gehören aber auch die Zuckerkrankheit Diabetes mel- litus und die familiäre Hypercholesterinämie, die mit einem erhöhten Risiko für Arterioskle- rose und Herzinfarkt einhergeht und weite Bevölkerungsteile in den Industrieländern betrifft.
Individuelle genetische Daten können nicht nur für die jeweilige Person im Rahmen der Ge- sundheitsfürsorge dienlich sein, sondern auch Auswahlkriterien für kommerzielle Interessen- gruppen darstellen. Die Furcht vor obligatorischen Gentests durch Versicherungsgesellscha f- ten oder Arbeitgeber als zusätzliche Nutznießer dieser diagnostischen Techniken ist dabei nicht absurd. Für die Ausstellung von Arbeits- und Versicherungsverträgen steht dabei nicht das frühzeitige Erkennen der äußerst seltenen monogenen Erbkrankheiten im Vordergrund, sondern im wesentlichen die Prognose von polygenen Dispositionen, zu denen Bluthoch- druck, Fettstoffwechselstörungen, Magengeschwüre oder Psychosen gehören. Auch genetisch bedingte individuelle Reaktionsweisen auf Umweltfaktoren, zum Beispiel schnellere Ausfall- erscheinungen beim Alkoholgenuss infolge einer Veranlagung zum verminderten Alkoholab- bau, wären für Dritte interessant. Die Erhebung solcher Daten kann für die Betroffenen schwerwiegende soziale und ökonomische Folgen haben und ist zudem aus biomedizinischer Sicht äußerst fragwürdig, da keine gesicherten wissenschaftlichen Studien vorliegen, deren Ergebnisse eine Beurteilung der Parameter Arbeitsfähigkeit, Gesundheitsentwicklung und Lebenserwatung aus Genomanalysen erlauben.
Inder Praxis spielen schon heute genetische Risikofaktoren, soweit sie sich aus der Familien- vorgeschichte ablesen lassen, eine Rolle bei der tariflichen Eingruppierung in private Kran- ken- und Lebensversicherungen. Die Verfügbarkeit einer genauen und preiswerten DNA - Diagnostik für vererbbare Prädispositionen bestimmter Krankheiten könnte zusammen mit der erforderlichen staatlichen Duldung zum Zwang für den einzelnen führen, sich solchen Tests zu unterziehen und gegebenenfalls in Risikogruppen ausgegrenzt zu werden. Die europäi- schen Versicherungsgesellschaften haben im Herbst 1993 auf einem Treffen in Paris einen uneingeschränkten Zugang zu personenbezogenen genetischen Daten gefordert und ange- droht, die im Europaparlament geplante restriktive EU - Richtlinie zur Verhinderung des Missbrauchs von Genomanalysen zu umgehen.
Die Auswirkungen der DNA - Diagnostik für Arbeitnehmer sind ein weites Feld für Spekula- tionen und verlangen nach eindeutigen gesetzlichen Regelungen. Bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen werden in Deutschland zur Zeit keine Gentests durchgeführt. In den USA hatte aber bereits 1972 der Chemiekonzern Du Pont Arbeitssuchende in ein genetisches Ü- berwachungsprogramm integriert, und 1982 führten einer Studie des amerikanischen Amts für Technikfolgenabschätzung (OTA) zufolge bereits 17 Unternehmen solche Tests durch. Mit ihren Untersuchungen sollen vor allem jene Bewerber oder Mitarbeiter identifiziert werden, die besonders sensibel auf gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz reagieren.
Die Zielsetzung der bereits durchgeführten arbeitsmedizinischen Gentests richtet sich im wesentlichen auf Gendefekte, die bei unbelasteten Personen normalerweise kein Krankheitsbild hervorrufen, aber auf eine exponierte Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Che mikalien oder anderen Belastungen hinweisen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es dem Schutz jedes einzelnen dient, wenn er in bezug auf spezifische Risiken am Arbeitsplatz beraten wird. Das Aussondern von krankheitsanfälligen Arbeitnehmern anstelle einer Verbesserung des Arbeitsschutzes ist jedoch auf keinen Fall hinzunehmen.
Demzufolge sind Betroffene doppelt bestraft: Sie erfahren als erstes, dass sie an einer unheilbaren Erbkrankheit erkranken werden und zweitens können sie, wenn die wahnwitzige Idee von öffentlichen Gentests nicht verhindert wird, ihren Arbeitsplatz, Versicherungsschutz und soziales Ansehen verlieren. Wenn also freiwillig ein Gentest durchgeführt wird, muss jeder das Recht haben, entscheiden zu dürfen, ob das Ergebnis weitergegeben werden darf oder nicht. Alles andere wäre eine Verletzung der Menschenwürde.
DNA - Analysen werden aber nicht nur zur Krankheitsauffindung durchgeführt, sondern auch zur Identifizierung von Menschen durch den genetischen Fingerabdruck.
Beim genetischen Fingerabdruck oder "DNA-Fingerprinting" wird mit den Methoden der Biomedizin aus informationsfreien DNA-Abschnitten des Genoms erstellt, das charakteris- tisch für jedes Individuum ist und eine eindeutige Identifizierung von Personen gewährleisten soll.
Während die Sequenz der Gene, die bestimmte Proteine des menschlichen Organismus kodie- ren, bei Gesunden nahezu identisch ist, existieren in den verbleibenden, mit einem Anteil von etwa 96 % überwiegenden Abschnitten des Humangenoms ohne erkennbaren Informationsge- halt bestimmte Regionen mit einer herausragenden Sequenzvielfalt. In diesen sogenannten hypervariablen Bereichen identifizierte die Arbeitsgruppe von Alec Jeffrey an der Universität Leicester in England bereits 1985 kurze, einfach aufgebaute Sequenzmotive, beispielsweise die Nucleotidabfolge GGCC, die sich bis zu hundertmal wiederholen. Die genaue Zahl dieser Wiederholungen variiert von Mensch zu Mensch, so daß man mit einer Oligonucleotidsonde für eine solche Sequenz ein Bandenmuster erzeugen kann, das dem Strichcode auf Super- marktprodukten ähnelt und als genetischer Fingerabdruck die eindeutige Identifizierung eines Menschen zuläßt. Da das Muster bei jedem zur Hälfte vom Vater und zur Hälfte von der Mut- ter ererbt ist, lassen sich außer der individuellen Charakterisierung auch Familienbeziehungen mit hoher Genauigkeit dokumentieren. Für die praktische Durchführung der Tests stehen die notwendigen DNA-Sonden von kommerziellen Anbietern zur Verfügung, wobei die ursprüngliche Jeffreysche Methode von der ICI-Tochterfirma Cellmark Diagnostics (Großbrit anien) vermarktet wird.
Der genetische Fingerabdruck hat sich bei Vaterschaftsnachweisen als Methode der Wahl bewährt, ist aber auch schon in der Gerichtsmedizin, insbesondere in Kombination mit der PCR-Technik eingesetzt worden. Man kann genügend DNA für die Durchführung einer sol- chen Analyse aus einem Tropfen getrockneten Bluts, ein paar Haarwurzeln, einem Speichel- oder Samenfleck gewinnen, um einen möglichen Straftäter zu überführen. Anfang 1988 wur- de diese neue Methode in den USA erstmals in einem Gerichtsverfahren benutzt und hat seit- dem besonders bei zuvor ungeklärten Sexualdelikten zur Identifizierung der Täter geführt. Auch in Deutschland hat die Erbgutanalyse bei der Fahndung nach Straftätern geholfen. Vor allem der Freistaat Sachsen hat eine hohe Erfolgsquote. Im letzten Jahr hatten Spezialisten der sächsischen Polizei rund 10.000 nukleargenetische Untersuchungen durchgeführt. Die im Rahmen der DNA-Analyse aufgefundenen und analysierten Spuren machen es leichter, Täter ausfindig zu machen. Sie helfen aber auch, Unbeteiligte zu entlasten.
Die Beherrschung und exakte Anwendung dieser Untersuchungsmethode ist eine unabdingba- re Voraussetzung, um probenfremde DNA-Spuren auszuschließen, da Nucleinsäuren schließ- lich in der Umwelt überall vertreten sind, unter anderem im Boden und im Trinkwasser. Ver- besserungen der Technik, durch die neben dem Bandenmuster auch die interne Struktur der Wiederholungseinheiten nachgewiesen wird, lassen experimentelle Fehler erkennen und er- öffnen für Juristen eine zusätzliche, aussagekräftige Alternative zu den traditionellen Verfah- ren der Täterermittlung.
Somit haben DNA-Analysen eindeutige Vor- aber auch Nachteile.
3.3.2 Keimbahntherapie und somatische Gentherapie
Mit Pillen, Spritzen oder Krankengymnastik lassen sich meist nicht die eigentlichen Krankheitsursachen, sondern eigentlich nur deren Symptome bekämpfen. Besonders wenn ein Gendefekt die Ursache der Krankheit ist, bleibt mit konventionellen Therapieformen eine wirkliche Heilung unmöglich. Das heißt für viele Patienten, dass sie ein Leben lang Medikamente zu sich nehmen müssen. Seit den 70er Jahren wird nun an der direkten Therapie der Gene, das heißt den Ersatz des defekten Genes durch ein gesundes, geforscht.
Ashanti DaSilva hat ein krankes Gen. Wäre es gesund, würde dieses Gen das Enzym Adenosindesaminase (ADA) herstellen, das eine wichtige Rolle im Stoffwechsel des Immunsystems spielt. Aufgrund ADA - Mangels ist Ashanti überempfindlich für Infektionen aller Art. Nur wenn sie das Enzym ADA künstlich aufnimmt, kann sie sich in öffentlichen Räumen aufha l- ten oder in die Schule gehen.
Damit sie nicht permanent ADA von außen braucht, sondern ihr Körper den Stoff selbst pro- duziert, wurde 1986 an Ashanti erstmals ein gentherapeutischer Ansatz getestet. Entschärfte Viren halfen dabei, in Zellen von ihr ein gesundes ADA - Gen einzuschleusen. Mit ansche i- nendem Erfolg: Durch die Gentherapie verbesserte sich Ashantis Krankheitsbild. Bei genaue- rem Hinsehen stellte sich allerdings heraus, dass die Ärzte außer Gentherapie noch andere Medikamente einsetzten. Niemand vermag nun genau zu sagen, ob die Verbesserung von As- hantis Zustand wirklich der Gentherapie zuzuschreiben ist - ein gutes Beispiel für die heutzu- tage vorherrschende Skepsis in Bezug auf Nutzen und Wirkung der Gentherapie, die sich momentan noch in der Testphase befindet und nicht als offizielle Therapieform zugela ssen ist.
ADA-Mangel, Mukoviszidose oder Hypercholesterinämie, eine Fettstoffwechselstörung, sind Beispiele für Erbkrankheiten, die von einem einzigen defekten Gen verursacht werden. Diese Krankheiten haben aufgrund des genau definierten genetischen Defektes die besten Chancen auf Heilung durch Gentherapie. Ein anderer wichtiger Anwendungsbereich sind erworbene Erkrankungen wie Tumore, Herzinfarkt oder Viruserkrankungen, bei denen man die genetische Steuerung des Krankheitsverlaufes kennt.
In der Testphase befindet sich derzeit nur die somatische Gentherapie. Im Gegensatz dazu würde bei der Keimbahn - Gentherapie das Gen in die Eizelle oder Spermien eingebracht wer- den und sich damit auf die Nachkommen übertragen. Obwohl der Transfer von Genen in Fortpflanzungszellen bei Tieren regelmäßig angewandt wird (zum Beispiel beim Pharming oder bei der Herstellung transgener Mäuse), ist er beim Menschen verboten und mit Haftstra- fen belegt.
Bei der somatischen Gentherapie werden Gene in ausgewählte Zellen eines erkrankten Gewe- bes oder Organs gezielt eingebracht, um krankheitsverursachende Defekte im Genom des Menschen auszugleichen. Dabei ist es wünschenswert, dass die eingeschleusten Gene in die DNA der Empfängerzellen stabil integriert werden und dadurch auch nach der Zellteilung in deren Tochterzellen aktiv sind. Der Begriff somatisch umfasst alle Zellen, die keine Ge- schlechtszellen sind und beschränkt die Therapie nur auf den Patienten selbst, so dass die Genveränderung nicht weitervererbt wird. Aus biomedizinischer Sicht entspricht die somati- sche Gentherapie beim Menschen deshalb einer Organ- oder Gewebetransplantation.
Der optimale experimentelle Ansatz zur Genübertragung ist die in vivo - Therapie, bei der alle Veränderungen im Körper des Patienten stattfinden und kein operativer Eingriff notwen- dig ist. Dieses mit einer medikamentösen Behandlung vergleichbare Konzept erfordert aber eine strikte Beschränkung der Manipulationen auf das Zielgewebe. Limitierender Faktor ist in diesem Zusammenhang noch der Mangel an geeigneten Transfersystemen, den sogenannten Vektoren, für die gewebsspezifische Übertragung der neuen Gene, da die bisherigen Techni- ken durch die geringe Effizienz, die ungenügende Trennschärfe und Stabilität der Integrati- onsvo rgänge nicht sicher genug sind.
Die gegenwärtigen Protokolle zur Anwendung der somatischen Gentherapie am Menschen lassen deshalb nur einen ex vivo - Ansatz zu, bei dem der Gentransfer außerhalb des Körpers stattfindet. Dafür müssen geeignete Zielzellen zur Verfügung stehen, die aus dem Körper ent- nommen werden, modifiziert und in funktionsfähiger Form in den Organismus zurückgeführt werden. Diese Voraussetzungen werden in idealer Weise von Knochenmarkzellen und in ge- ringem Maße von Hautzellen erfüllt, so dass die Therapieansätze zur Zeit überwiegend Gen- defekte für Krankheiten des blutbildenden Systems oder solche, die durch genetisch veränder- te Blutzellen beeinflussbar sind, erfassen. Da die Blutzellen ständig absterben und durch neue ersetzt werden, ist der dadurch erzielbare Therapieeinfluss allerdings nur kurzfristig.
In der ex vivo - Therapie beruhen die am häufigsten beschriebenen Transfersysteme für gene- tisches Material auf viralen Vektoren, bei denen die natürliche Eigenschaft der Viren zur In- fektion von Zellen ausgenutzt wird. Es werden verschiedene Virustypen eingesetzt, deren gemeinsames Konstruktionsmerkmal im Austausch auf den viralen DNA - Abschnitten durch das zu übertragende Gen beruht. Zusätzliche Modifikationen sollen sicherstellen, dass sich die rekombinanten Viren in der Wirtszelle nicht vermehren. Trotzdem wird als Sicherheisrisiko dieser Technik eine mögliche Rückbildung zu krankheitserzeugenden Viren oder eine poten- tielle erbgutverändernde Wirkung durch den zufälligen Integrationsort in Betracht gezogen. Physikalische DNA - Transportsysteme wie die Elektroporation oder die Biolistik schließen diese Risiken aus, haben aber einen deutlich niedrigren Wirkungsgrad als ihre viralen Kon- kurrenten. Bei der Elektroporation werden die Zellmembranen durch kurze Stromstöße perfo- riert und für DNA durchlässig gemacht, während man bei Biolistik mikroskopisch kleine, mit DNA überzogene Goldküge lchen direkt in die Zellen schießt. Mit beiden Techniken tritt hä u- fig nur ein kurzfristiger Effekt ein, der häufige Wiederholungen der gentherapeutischen Ein- griffe notwendig macht.
In den letzten drei Jahren stieg die Zahl der klinischen Gentherapiestudien stetig an. Der ü- berwiegende Anteil entfällt auf amerikanische Klinikzentren, was wieder die Dominanz der USA in der Biomedizin verdeutlicht, aber auch in Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und sogar in der Volksrepublik China wurden erste Schritte in dieses neue me- dizinische Zeitalter unternommen. Deutsche Kliniken waren in der Pionierphase der somati- schen Gentherapie nicht beteiligt und haben erst 1994, vier Jahre nach den USA, die ersten Schritte unternommen.
Das zweifellos umstrittenste Thema der biomedizinischen Forschung ist eine Gentherapie in der menschlichen Keimbahn. Darunter versteht man gentechnische Engriffe in die Keimzellen selbst, in die befruchtete Eizelle oder die totipotenten Zellen, die aus diesem Keim bei der ersten Teilung hervorgehen. Das Ziel solcher Therapieansätze besteht darin, die Nachkommen an Erbkrankheiten leidender Menschen von den ursächlich dafür verantwortlichen Gendefek- ten dauerhaft zu befreien. Im Gegensatz zur somatischen Gentherapie würde bei einer Keim- bahntherapie nicht ein nachweislich kranker Mensch behandelt, sondern vorbeugend dessen Kinder, obwohl in den meisten Fällen im voraus nicht bestimmt werden kann, ob sie tatsäch- lich das betreffende Krankheitsbild ausprägen. Damit verschwimmt die Grenze zwischen der Therapie schwerer Erkrankungen und der Eugenik, da auch das wissenschaftliche Know-how für die Medizin aller Erbanlagen eines Menschen und somit die "Züchtung nach Maß" erar- beitet würde.
Beim gegenwärtigen Stand der Technik kann noch nicht vorausgesagt werden, ob eine Keim- bahntherapie jemals möglich sein wird, und es sind bislang auch keine Versuche am Men- schen durchgeführt worden. Durch die Methoden der Reproduktionsmedizin bei der invitro - Fertilisation sind die gynäkologischen Grundlagen für derartige Eingriffe vorhanden, und der prinzipielle Ablauf von Gentransfer in befruchtete Eizellen wurde bei der Etablierung trans- gener Tiere erprobt. Aus diesen Tierexperimenten ist bekannt, daß die Fehlerquote derzeit in der Größenordnung von 99,9 % iegt, d.h., auf eine erfolgreiche Genübertragung entfallen mindestens 999 Fehlschläge. So ist es nicht möglich, aus einem Säugetiergenom gezielt ein defektes Gen herauszuschneiden und exakt an der richtigen Position ein gesundes Gen einzu- fügen. Der Einbau erfolgt vielmehr zufällig und kann durch Ausschalten wichtiger Gene so- wie durch Nachbarschaftswirkungen zu Mißbildungen der Embryonen oder neuen Krankhe i- ten führen. Aus diesen pragmatischen Gründen verbietet sich die Manipulation der menschli- chen Keimbahn, und in den meisten Industrieländern existieren Verbote durch staatliche Re- gelungen. In Deutschland wurden Experimente zur menschlichen Keimbahntherapie durch das Embryonenschutzgesetz vom 1. Januar 1991 untersagt, und in den USA besteht im "National Institutes of Health Recombinant DNA Advisory Committee (NIHRAC)" eine wirksame staatliche Institution, um wissenschaftlichem Missbrauch vorzubeugen.
Allerdings lagern zu Tausenden in den USA, Großbritannien und Australien menschliche Embryonen bis zum Alter von etwa zwei Wochen in flüssigem Stickstoff. Denn die Ärzte heben dort Embryonen auf, die nach Reagenzglas - Befruchtungen übrig blieben. Jetzt ava n- cieren die Überzähligen zu begehrtem Rohstoff. Denn aus frühen menschlichen Embryona l- stadien lassen sich heute Kulturen embryonaler Stammzellen (ES -Zellen) anlegen. Sie gelten für manche als Hoffungsträger, denn sie könnten die Therapie von Krankheiten wie Parkinson oder Multiple Sklerose ermöglichen.
Letztendlich ist es eine Minderheit, die die Risiken aber auch Vorteile dieser zukunftsweisenden Entwicklung erahnt. Der Eingriff in das menschliche Erbgut ist einer der Schritte auf dem Wege der Entschlüsselung der Schöpfungsgeschichte des Homo sapiens und die Wiederlegung sämtlicher religiöser Lehren. Doch wie vielen ist das eigentlich bewusst?
3.3.3 Gentechnik in der Öffentlichkeit
Am Ende stellt sich allerdings doch die Frage, wie die Öffentlichkeit, die breite Masse, Gen- technik beurteilt. Die Einstellungen betreffen eher die Gentechnik insgesamt als einzelne An- wendungen, die überwiegend entweder sehr entschieden befürwortet oder abgelehnt werden. In einer wissenschaftlichen Studie mussten sich allerdings die Befragten bei vorgegebenen Anwendungen entscheiden. Die höchste Zustimmung finden medizinische Anwendungen der Gentechnik. Die Verwendung gentechnischer Methoden zur Diagnose unheilbarer Krankhe i- ten findet bei 45 % der Befragten volle Zustimmung und immerhin noch bei 29 % eine ve r- haltene Zustimmung. Insgesamt nur 7 % beurteilen diese Anwendung gentechnischer Metho- den negativ. Ähnlich positiv werden auch Anwendungen der Gentechnik zur Therapie von Zellkrankheiten bewertet, die von insgesamt 70 % (38 % "sehr gut", 32 % "eher gut") befür- wortet werden. Auch hier ist es nur eine vergleichsweise kleine Minderheit von 9 %, die sich ablehnend äußert.
Etwas geringer ist die Zustimmung zum Einsatz der Gentechnik bei der Herstellung von Impfstoffen sowie zum Einsatz gentechnisch veränderter Bakterien, die zum Abbau von Ölbe- lastungen im Boden eingesetzt werden. Beide Anwend ungen werden von knapp zwei Dritteln der Befragten (63 %) positiv bewertet, wobei bei Mikroorganismen im Umweltschutz die et- was abgeschwächte Befürwortung ("halte ich für eher gut") überwiegt. Insgesamt positiv wird auch der Einsatz von genetischen Diagnosemethoden gesehen, um in der Schwangerschaft körperliche oder geistige Krankheiten von ungeborenen Kindern erkennen zu können. Aller- dings werden nicht alle Anwendungen der Gentechnik in der Medizin, der Pharmazie und der pharmazeutischen Forschung so positiv bewertet. Der Einsatz gentechnischer Methoden zur Züchtung von Laboratorien für die Pharmaforschung wird von fast jedem zweiten Befragten (43 %) entschieden abgelehnt.
Tabelle : Anteile befürwortender Beurteilungen von Anwendungen der Gentechnik (geordnet nach Prozentwerten der Befürwortung)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Kritischer als auf die anderen Anwendungsbereiche reagieren die Befragten auf die sogenannte "Grüne Gentechnik", die Anwendung gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft.
Die Statistik sagt allerdings nichts über den Kenntnisstand der Befragten über Gentechnik aus, somit bleibt die „Aufklärung“ nur eine Vermutung. Allerdings gibt es für Interessierte sehr wohl Möglichkeiten sich zu informieren; Fachzeitschriften und Internet sind nur einige Beispiele. Aber auch die Presse versucht über neue Entwicklungen und ethisch fragwürdige Forschungsergebnisse zu berichten.
3.3.3.1 Dezemberdiskussion 2000: Klonen in Großbritannien
„Britische Entscheidung ein ethischer Dammbruch“, so lautete eine Überschrift in der Frankfurter Allgemeine Zeitung am Donnerstag, dem 21. Dezember 2000. Gleich darunter steht der Inhalt des Artikels in Kurzform „Breite Kritik in Deutschland, Klonen von Embryonen, Schröder gegen Scheuklappen in der Gentechnik.“
Was haben die Engländer getan, was niemand zuvor im konservativen Europa wagte?
In Großbritannien wurden die juristischen Grenzen der wissenschaftlichen Nutzung von Ze l- len menschlicher Embryos neu gesetzt. Nach einer „leidenschaftlichen Debatte“, so heißt es in den Zeitungen, hat das Unterhaus einer Vorlage der Regierung mit 366 gegen 174 Stimmen zugestimmt. Es war eine der seltenen Entscheidungen, bei denen der Fraktionszwang aufge- hoben war. Deshalb debattierten und stimmten die Abgeordneten nicht automatisch im Ein- klang mit ihren Parteiführern. Labour - Premierminister Blair unterstützte die Vorlage mit den meisten Mitgliedern seiner Fraktion, doch 76 Labour - Abgeordnete stimmten dagegen.
Das Unterhaus hatte aber genau gesehen nicht etwas grundlegend Neues zu verabschieden, sondern ein altes Gesetz zu ergänzen. Das „Gesetz zur menschlichen Befruchtung und Embryologie“ von 1990 sollte im Parlament so umgestaltet werden, dass es der medizinischen Forschung angepasst werden kann.
Nach den Regeln von 1990 ist es beispielsweise erlaubt, die Zellen 14 Tage alter Embryos, die von einer künstlichen Befruchtung „übrigbleiben“, zur medizinischen Forschung zu ve r- wenden. Nach der Ergänzung vom 19.12.2000 dürfen Stammzellen, die in der Debatte beschrieben wurden als „Bündel von 100 Zellen, die auf einer Nadelspitze Platz haben“, menschlichen Embryos entnommen werden, die nur vier oder fünf Tage alt sind, deren Potential also wesentlich mehrdeutiger ist.
Die Entscheidung des britischen Unterhauses, das Klonen menschlicher Embryonen für thera- peutische Zwecke zu erla uben, ist in Deutschland auf große Ablehnung gestoßen. Unter den Gegnern waren außer der Bundesforschungsministerin E. Bulman (SPD) und Gesundheitsmi- nisterin A. Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) auch der Vorsitzende der katholischen Deut- schen Bischofskonferenz Lehmann und der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Kock. Allerdings schien der Bundeskanzler G. Schröder nicht annähernd so ab- geneigt und sprach sich gegen „ideologische Scheuklappen und grundsätzliche Verbote“ in der Bio- und Gentechnik aus. Er plädierte sogar dafür, das deutsche Embryonenschutzgesetz zu überarbeiten und eine Diskussion um die in vielen EU - Ländern schon praktizierte PID zuzulassen.
Die Meinungen über diese gewagte Entscheidung werden auch in der deutschen Bevölkerung mindestens genauso weit auseinandergehen wie in der Politik. Viele Kranke hoffen dadurch auf neuartige Heilungsmethoden, während die Gesunden ihre Angst vor einem „menschlichen Dolly“ bekunden und diesen Schritt der eigentlich so prüden Briten kategorisch able hnen.
Auf der einen Seite ist eine 14 Tage alte befruchtete Eizelle gerade einmal stecknadelkopfgroß und menschliche Züge sind nicht im entferntesten erkennbar, auf der anderen Seite weiß jeder Mensch, dass sich daraus ein gesundes Baby entwickeln könnte, dem man seine Entstehung durch derartige Gentests von vornherein verhindert. Sicherlich wird die Gentechnik die Politiker noch vor schwerwiegende Entscheidungen stellen, bei denen sie zwischen ihrem eigenem Gewissen, der Wissenschaft und den Meinungen ihrer Wählerschaft zu entscheiden haben. Man kann nur hoffen, dass sie die richtige wählen.
3.3.3.2 Persönliche, moralische Bewertung
Ich dachte, die Facharbeit bringt Licht in mein Dunkel, aber nun habe ich das Gefühl, ich ste- he in einer geistigen „Wackelkontaktzone“, bei der das Licht ständig an und wieder aus geht. Die Gentechnik ist ein derart großes Fachgebiet mit so vielen Möglichkeiten, die in ihren Ausmaßen noch gar nicht richtig realisiert wurden. Sie ist Hoffnungsträger der Kranken, der Opfer des Forschritts, aber gleichzeitig wird sie auch als Apokalypse, als der menschenve r- nichtende Schritt angesehen, der die Science - Fiction - Filme wahr werden lässt. Sollen wir oder sollen wir nicht? Gibt es noch einen Gott, der uns die Entscheidung abnimmt? Oder sind wir die unbesiegbaren Herrscher dieser Welt? Die Vorteile der Gentechnik liegen auf der Hand. In der Landwirtschaft bilden Pflanzen durch sie höhere Resistenzen gegen abiotische und biotische Stressoren aus, und es ist ein entscheidender Beitrag zur Sicherung der Welter- nährung durch standortangepasste Pflanzen möglich. Die Entwicklung besserer Impfstoffe oder neuer diagnostischer Verfahren zur Krankheitsfrüherkennung sind weitere Vorteile der Gentechnik. Auch die Untersuchung des Erbmaterials zwecks der Therapieentwicklung zum Beispiel bei Krebs, Erbkrankheiten und Immunschwächen hat positive Seiten.
Aber ohne Nebenwirkungen wird auch die gezielte Manipulation unseres Erbguts nicht ble i- ben. "Selbst schlechte Gene haben ihre guten Seiten - wir kennen sie oft nur noch nicht". Zum Beispiel Mukoviszidose: Menschen, bei denen auf beiden Chromosomensätzen das entspre- chende Gen defekt ist, leiden unter einer schweren Stoffwechselkrankheit. Unbehandelt ster- ben sie schon als Kinder. Die Krankheit ist aber so weit verbreitet, dass sie einen Vorteil für "heterozygote" Träger haben muss. Das sind Menschen mit einem gesundem und einem kranken "Mukoviszidose-Gen". Experimente an Mäusen haben gezeigt, dass diese Genkombination sie vor dem Tod durch Cholera schützt. Diese Krankheit war früher weit verbreitet und damit ein wichtiger Evolutionsfaktor.
Zweites Beispiel: Aids. Etwa zehn Prozent der weißen Europäer und Amerikaner haben einen Defekt in ihrem Immunsystem, was die meisten von ihnen aber nicht bemerken. Doch für diejenigen, die sich mit HIV infiziert haben, erweist sich der Gen-Fehler als Lebensretter. Er bewirkt, dass sie weitgehend immun gegen das Virus sind und Aids daher bei ihnen nicht ausbricht.
Weil wir noch so wenig wissen über die zahlreichen Funk tionen unserer Gene, warnt der Mo- lekularbiologe Jürgen Brosius aus Münster eindringlich vor massiven Eingriffen. "Wir sollten verstehen, dass unsere Beurteilung, ob ein Gen gut oder schlecht ist, nur für die Gegenwart relevant ist. Unter anderen Bedingunge n, wie verändertem Klima, könnten Gene, die wir he u- te so schnell wie möglich loswerden wollen, lebenswichtig werden. Deshalb ist die genetische Variabilität einer unserer größten Schätze, und sie sichert unser Überleben. "Brosius glaubt, dass wir sogar in einen evolutionären Engpass geraten könnten, wenn wir unsere genetische Vielfalt drastisch reduzieren. Wenn zum Beispiel in einem künstlichen Gen eine Anfälligkeit für neue Infektionserreger verborgen wäre, und viele Menschen trügen dieses Gen - dann könnt e dies das Ende der künstlichen geformten Menschheit bedeuten. Denn Monokultur ist immer ein Problem, das sieht man in der Landwirtschaft wie in der Computerbranche. Wir würden uns der Möglichkeit berauben, auf künftige Umweltherausforderungen reagieren zu können.
So oder so, wie es auch kommen mag, wir sollten nie vergessen, was einen Menschen aus- macht und ihn von einem Tier unterscheidet, nämlich die Fähigkeit zu Denken, zu Fühlen und zu Sprechen. Deshalb kann und darf es nicht das Ziel der Wissenschaft sein, diese Wesens- merkmale zu verändern oder gar zu zerstören. Neue Menschen braucht dieses Land nicht.
Aber dennoch gibt es ohne Forschung und ihre „Versuchung“ keinen Reiz für Entdeckungen, für Streben und Weiterentwicklung. Dies würde einen Stillstand in der Evolution bedeuten und wäre damit ein Rückschritt und Untergang.
„Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen - ein Ozean.“
Isaac Newton
So sehr wir uns auch bemühen, unser Sein, die Welt und das Weltall zu erforschen, wie müs- sen uns irgendwann mit der Unendlichkeit abfinden, die uns umgibt, die wir nicht begreifen können und damit, dass wir die letzten Fragen nach dem Sinn des Lebens und unserer Exis- tenz nie ergründen werden, obwohl wir laufend weiter forschen nach einem Ziel im Unendli- chen, das wir aber niemals erreichen werden. Daraus folgt auch unsere Endlichkeit.
„Das ist der Weisheit letzter Schluss: nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. [...]“
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen.“
J. W. v. Goethe, Faust II
Sowohl das Zitat von Newton als auch das aus Goethes “Faust” spiegeln den Charakter der ewigen Forschung wider. Aber: Die letzte Ungewissheit wird bleiben und gehört zu unserem Leben!
4 Zusammenfassung
„Der Mensch - Zukunft Gesundheit und Rolle der Gentechnik“ dies ist ein Thema, das in eine moderne, technisierte, aber auch risikoreiche und ethisch unsichere Welt führt. Wann ist man heute „gesund“? Wann darf von „Krankheit“ gesprochen werden?
Hat die Entschlüsselung der Gene einen Kampf um die besten Erkenntnisse entfacht, unabhängig vom therapeutischen Nutzen?
Das sind Fragen, auf die Antworten nur schwer zu finden sind, da sie Stecknadeln in einem Haufen aus Vorurteilen, wissenschaftlichen Befunden, Vermutungen und Widerlegungen sind.
Dennoch kann man sich auf ein paar wesentliche Fakten einigen:
Der Mensch ist wirklich erst kerngesund, wenn er sich körperlich, geistig und sozial wohl fühlt. Der Einklang dieser Komponenten ist von entscheidender Bedeutung, da bei einer Un- vollständigkeit psychische oder physische Krankheiten die Folge sein können. Bedauerli- cherweise ist das häufig der Fall, und so sind in den Industrieländern Herz- und Gefäßerkran- kungen die häufigsten Todesursachen. Die Entwicklungsländer haben mit wiederkehrenden gefährlichen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose, Pest oder Malaria zu kämpfen, die lange Zeit als besiegt galten.
Allerdings kann zumindest in der ersten Welt ein entscheidender Beitrag zur eigenen Gesund- heitsvorsorge geleistet werden. Durch Einhaltung des empfohlenen Impfkalenders, ausgewo- gene Ernährung und regelmäßige sportliche Betätigung lassen sich die meisten „Wohlstand s- krankheiten“ wie Bluthochdruck oder Herz- Kreislaufstörungen verhindern. Eine besonders wichtige Rolle in der Prävention und Therapie von Krankheiten wird in Zukunft die Gentech- nik spielen. Neue Menschen braucht dieses Land zwar nicht, aber dafür werden Lösungswege für die Bekämpfung von bisher unheilbaren Krankheiten wie Aids oder Mukoviszidose drin- gend benötigt. Die Gefa hr von Missbrauch dieser neuen Technologie wird sicherlich mit der Aufdeckung von immer mehr Geheimnissen unseres Erbgutes steigen, aber gerade deswegen ist die Gentechnik von besonders großer Bedeutung für die Menschheit. Durch sie erlangt die Moral wieder eine höhere Bedeutung, es erfolgt eine Rückbesinnung auf ethische Grundsätze. Neue Entdeckungen in der Forschung und angebliche wissenschaftlich Erfolge werden nicht mehr einfach hingenommen, sondern kritisch nach ihrem therapeutischen Nutzen hinterfragt.
Im 20. Jahrhundert sind auf neue Entdeckungen wie z. B. die des Urans oder der Ammoniaksynthese auch gleich Taten gefolgt. Die neu angewendeten Kriegstechniken im ersten Weltkrieg wie Kampfgaseinsätze und der Flugangriff oder der Atombombenabwurf 1945 sind nur wenige Beispiele dafür. Das letzte Jahrhundert kann auch als Zeit der verlorengegangenen Moral oder Menschlichkeit bezeichnet werden. Fängt die Menschheit nun wieder an, ausgelöst durch die Erfolge in der Gentechnik, sich an ein Gefühl zu erinnern, dass schon ausgestorben schien? Wohin wird der Mensch in Zukunft gehen? Wie lange wird die Menschheit in ihrer ursprünglichen Form noch existieren?
Das sind Fragen, die viele gar nicht beantwortet haben möchten, die aber vielleicht bald beantwortet werden müssen.
5 Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 www.merian.fr.bw.schule.de/beck/skripten/12/bs12.htm
Abb. 2 www.merian.fr.bw.schule.de/beck/skripten/12/bs12.htm
Abb. 3 www.merian.fr.bw.schule.de/beck/skripten/12/bs12.htm
Abb. 4 www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/tuberkulose.html
Abb. 5 www.m-ww.de/krankheiten/infektionskrankheiten/tuberkulose.html
Abb. 6 www.m-ww.de/krankheiten/erbkrankheiten/theorie.html
Abb. 7 www.m-ww.de/sexualitaet_fortpflanzung/geburt/praenatal.html
6 Internetadressen
www. aerzteblatt.de/archic/artikel.asp?id=21123 www. expo2000.de - Tuberkulose
www. fu-berlin.de
www. gbm.uni- frankfurt.de
www. klinikum.rwh-aachen.de - Krankheitserreger, Tuberkulose, Ernährung, Impfungen www. klinikum.rwh-aachen.de - Tuberkulose
www. lifescience.de/bioschool/sheets/30.html www. lifescience.de/ratgeber/mitte/index3.html www. merian.fr.bw.schule.de
www. quarks.de/antibiotika/02.htm www. schlaganfall- hilfe.de
www. sozialarbeit.fh-dortmund.de - Thema: Prävention
7 Literaturverzeichnis
ANTONOVSKY, A.: Health stress and Coping. London:: Jossey Bass, 1979 BLAXTER, M.: Heath and Lifestyles. London, 1990, S. 113 ff
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT: Gentechnik - Chancen und Risiken. Referat Öffentlichkeitsarbeit, Bonn, Oktober, 1993
EPPING DR, B: Was möglich ist, wird auch gemacht. Bild der Wissenschaft. 10/2000
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Breite Kritik an britischer Entscheidung. 21.12.2000
GASSEN; H. G.; KEMME, M.: Gentechnik. Die Wachstumsbranche der Zukunft. Fischer Taschenbuch Verlag
HAMPEL, J.; RENN, O.: Gentechnik in der Öffentlichkeit. Wahrnehmung und Bewertung einer umstrittenen Technologie. Campus Verlag Frankfurt/New York
HIMMEL, M. J.: Lebensweisheiten. ars Edition,1998
KÜHN, H.: Healthismus. Eine Analyse der Präventionspolitik und Gesundheitsförderung in den U. S. A., Berlin, Ed. Sigma, 1993
OPHOLZER, A.: Die Arbeitswelt als Ursache gesundheitlicher Ungleichheit: Ergebnisse der sozialepidemiologischen Forschung. Opladen: Leske & Buldrich, 1994
SCHRÖDER, E.: Gesundheitspflege als Aufgabe von Gesetzgebung und Verwaltung. Der öffentliche Gesundheitsdienst 12. Jahrgang Heft 9 12 /1950 s. 317-35
SCHWOERER; M.: Bild der Wissenschaft. 10/2000
Häufig gestellte Fragen zu "Gesundheit und Gentechnik"
Was bedeutet Gesundheit gemäß der Weltgesundheitsorganisation (WHO)?
Gesundheit ist ein Zustand körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Individuelle Lebensverhältnisse spielen ebenfalls eine Rolle.
Welche grundlegenden Bedingungen sind laut WHO für die Gesundheit wichtig?
Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Ökosystem, eine sorgfältige Behandlung der vorhandenen Energiequellen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld für die Gesundheit?
Unterschiedliche Lebensgewohnheiten und -bedingungen im sozialen Bereich prägen den gesundheitlichen Zustand. Faktoren wie Mangel an Nahrung, Armut, soziale Isolation, und Einsamkeit können das Bewältigungsverhalten erheblich beeinflussen.
Wie beeinflusst der Arbeitsplatz die Gesundheit?
Arbeitsbedingungen haben einen wesentlichen Einfluss. Hohe Arbeitsbelastung kann zur Entstehung chronischer Erkrankungen beitragen, besonders in Verbindung mit einer niedrigen beruflichen und sozialen Stellung.
Welchen Einfluss hat der geistige Zustand auf die Gesundheit?
Der geistige Zustand spielt eine entscheidende Rolle. Wohlbefinden hilft, Stress besser zu verarbeiten, fördert Ausgeglichenheit und eine positive Einstellung zum Körper. Sport und andere Freizeitaktivitäten können hierbei helfen.
Was versteht man unter Infektionskrankheiten?
Das Eindringen, Vorhandensein sowie die Vermehrung von Krankheitserregern im menschlichen Körper, sofern die Immunabwehr dagegen nicht ausreichend ist. Erreger können Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten sein.
Was sind chronische Erkrankungen?
Langsam und lange verlaufende Erkrankungen. Der Begriff "chronisch" sollte erst nach einer Laufzeit von über sechs Monaten verwendet werden.
Was ist Tuberkulose (TBC)?
Eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien (Mycobacterium tuberculosis) übertragen wird. Die Infektion erfolgt meist durch Tröpfcheninfektion. Gut ernährte Menschen erkranken ungleich seltener als unterernährte Menschen in schlechten sozialen Verhältnissen.
Wie wird Tuberkulose behandelt?
Mit einer Kombination aus Medikamenten wie Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Streptomycin, Pyrazinamid über einen Zeitraum von ca. 9 Monaten. Die WHO setzt auf die DOTS-Strategie (Directly Observed Treatment, Short Course), bei der die Medikamenteneinnahme unter Aufsicht erfolgt.
Welche Bereiche umfasst die Gesundheitsvorsorge?
Luft- und Klimaverhältnisse, das soziale Umfeld, und der seelische Zustand jedes Individuums.
Welche Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge gibt es?
Vermeiden von Risikofaktoren wie Rauchen, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, aber auch Impfungen und regelmäßige Arztbesuche.
Welche Arten von Impfungen gibt es?
Aktive und passive Impfungen. Aktive Impfungen (Lebend- und Totimpfstoffe) regen den Körper zur Bildung von Antikörpern und Gedächtniszellen an. Passive Impfungen führen dem Körper Antikörper von außen zu.
Welche Bedeutung hat die Ernährung für die Gesundheit?
Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Energiezufuhr ist für die Sicherstellung der Körperfunktionen unerlässlich. Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate liefern Energie, während Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Ballaststoffe andere wichtige Funktionen erfüllen.
Warum ist Sport wichtig für die Gesundheit?
Regelmäßige sportliche Aktivität trainiert die Gefäße, hält sie elastisch, wirkt Arteriosklerose entgegen und reduziert Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Zuckerkrankheit. Sport sollte jedoch Spaß machen und dem Alter sowie dem Gesundheitszustand angepasst sein.
Was ist Gentechnik?
Methoden zur Untersuchung und Änderung des Erbmaterials auf molekularer Ebene. Ziel ist es, Gene unabhängig von ihrer Herkunft beliebig miteinander zu kombinieren, um neue Eigenschaften zu erzeugen.
Welche Anwendungen der Gentechnik gibt es in der Humanmedizin?
Gewinnung von Arzneimitteln und Impfstoffen durch rekombinante Mikroorganismen und Zellkulturen, Entwicklung von Impfstoffen gegen Tropenkrankheiten, Verbesserung der Diagnostik, sowie Ansätze zur Therapie von Erbkrankheiten.
Was sind Erbkrankheiten?
Genetisch bedingte Erkrankungen, die von den Vorfahren auf ihre Nachkommen übertragen werden. Sie werden in chromosomale, monogene und polygene Erkrankungen unterteilt.
Was ist Pränataldiagnostik?
Medizinische Untersuchungen während der Schwangerschaft, um mögliche Schädigungen oder Erkrankungen des ungeborenen Kindes zu erkennen. Dazu gehören Ultraschall, Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese), Chorionzottenbiopsie und Präimplantationsdiagnostik (PID).
Welchen Zweck verfolgt das Gentechnikgesetz?
Den Menschen und seine Umwelt vor möglichen Gefahren der Gentechnik zu schützen und gleichzeitig den rechtlichen Rahmen für die Entwicklung genetische Projekte zu schaffen.
Was ist ein Gentest und genetischer Fingerabdruck?
Ein Gentest dient zur Diagnose von Krankheiten, während ein genetischer Fingerabdruck zur Identifizierung von Personen anhand von DNA-Abschnitten ohne Informationsgehalt verwendet wird.
Was ist Keimbahn- und somatische Gentherapie?
Die somatische Gentherapie zielt darauf ab, Gene in ausgewählte Zellen eines erkrankten Gewebes oder Organs einzubringen. Die Keimbahntherapie betrifft gentechnische Eingriffe in die Keimzellen selbst, in die befruchtete Eizelle oder die totipotenten Zellen. Nur die somatische Gentherapie wird derzeit getestet.
Wie wird Gentechnik in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Medizinische Anwendungen der Gentechnik finden die höchste Zustimmung, während der Einsatz gentechnischer Methoden in der Landwirtschaft kritischer gesehen wird.
- Citar trabajo
- Franziska Maser (Autor), 2001, Der Mensch - Zukunft Gesundheit und Rolle der Gentechnik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102211