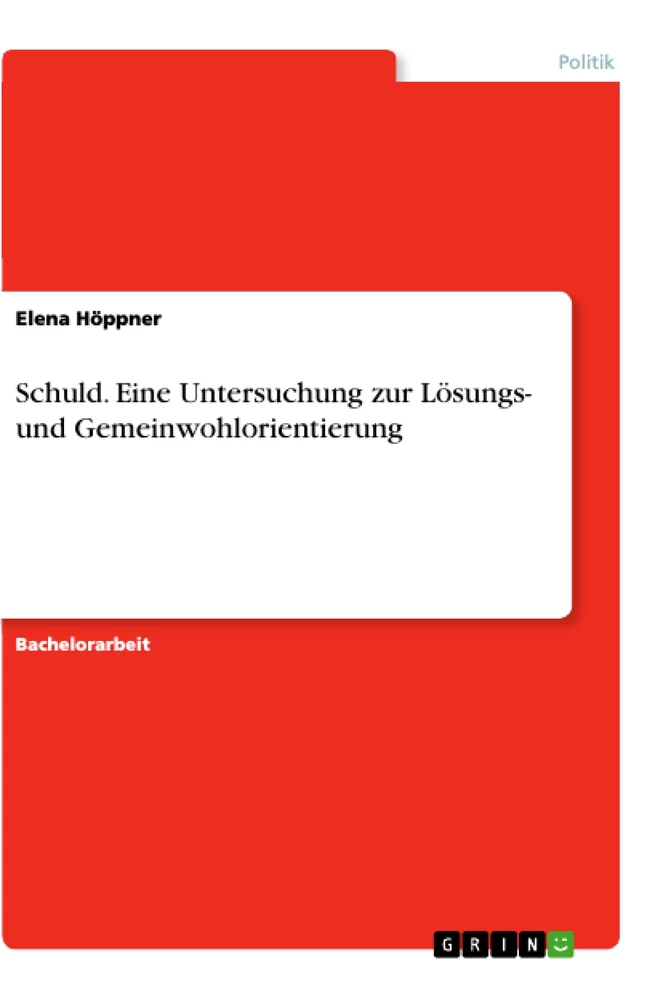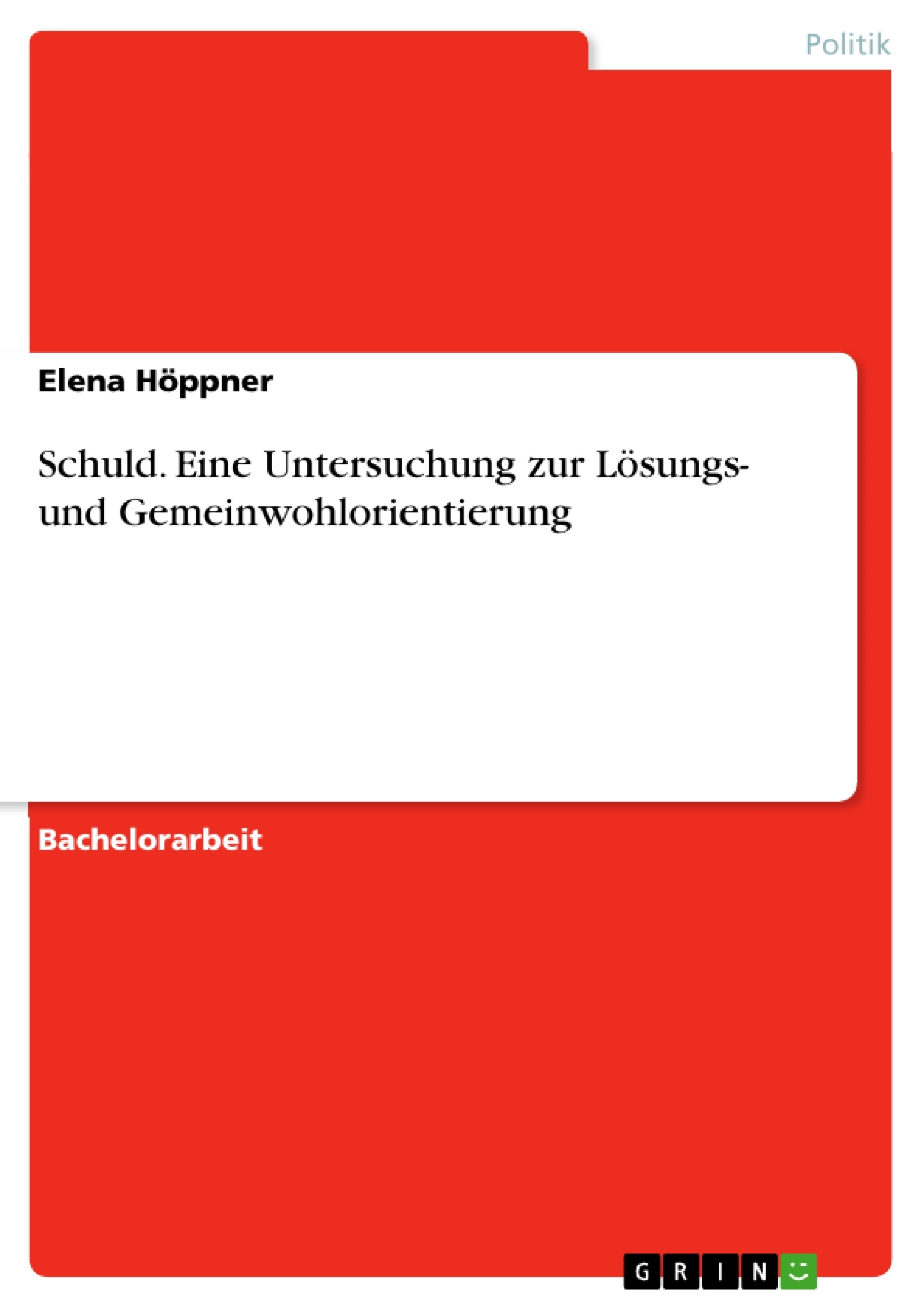Diese Arbeit behandelt die Frage, inwiefern die Kategorie "Schuld“ vereinbar mit der Orientierung am Gemeinwohl ist – oder inwiefern ein schuldbasiertes Vorgehen ein dem Gemeinwohl zuträgliches Vorgehen, welches als effektiv oder zweckmäßig bezeichnet werden kann, verhindert. Damit einher geht die Überlegung, inwiefern das Prinzip der Schuld die Basis für gesellschaftliche, politische und rechtliche Weichenstellungen bildet, sodass eine Orientierung an konstruktiver Problemlösung in den Hintergrund tritt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen „Schuld“: Grundlagen und Einordnung
- 2.1 Definition des Schuldbegriffs
- 2.1.1 Sprachliche Begriffsbetrachtung und fachwissenschaftsübergreifende Definition
- 2.1.2 Betrachtung des Schuldbegriffs in den Einzelwissenschaften
- 2.2 Historische Betrachtung von Schuld
- 2.2.1 Schuld in der griechischen Antike
- 2.2.2 Schuld in der jüdisch-christlichen und christlich-augustinischen Tradition
- 2.2.3 Schuld in der Moderne
- 2.3 Bestimmung des Phänomens: Schuld als Mechanismus
- 2.1 Definition des Schuldbegriffs
- 3. Die Funktionsfähigkeit von Schuld
- 3.1 Stand der Forschung und Einordnung der eigenen Theoriegrundlage
- 3.2 Zugrundeliegender Maßstab des Gemeinwohls
- 3.3 Untersuchung der Funktionsfähigkeit von Schuld im deutschen Strafrecht
- 3.2.1 Vorkommen und Wirkungsweise von Schuld im deutschen Strafrecht
- 3.2.2 Beurteilung des Schuldvorkommens und -wirkens
- 4. Klärung der Fragestellung
- 5. Methodisches Vorgehen
- 6. Ergebnisse
- 6.1 Ineffektivität des Schuldprinzips im Bereich der Sanktionsumsetzung - Untersuchung am Beispiel des Strafvollzugs
- 6.2 Ineffektivität des Schuldprinzips aufgrund struktureller Probleme - Untersuchung am Beispiel der Ersatzfreiheitsstrafe
- 7. Diskussion
- 8. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit des Schuldprinzips mit einer gemeinwohlorientierten Lösungsfindung auf gesellschaftlicher Ebene. Sie hinterfragt, inwieweit ein schuldbasiertes Vorgehen eine konstruktive Problemlösung behindert und alternative, effektivere Ansätze im Hinblick auf das Gemeinwohl in den Vordergrund rückt.
- Definition und historische Entwicklung des Schuldbegriffs
- Funktionsfähigkeit des Schuldprinzips im deutschen Strafrecht
- Empirische Untersuchung der Ineffektivität des Schuldprinzips anhand von Beispielen
- Vergleichende Analyse unterschiedlicher Strafvollzugssysteme
- Konflikt zwischen Schuldprinzip und Gemeinwohlorientierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vereinbarkeit des Schuldprinzips mit einer lösungsorientierten, gemeinwohlorientierten Vorgehensweise. Am Beispiel des Strafvollzugs in Norwegen und Deutschland wird der Unterschied zwischen vergeltungsorientierter und lösungsorientierter Strafjustiz aufgezeigt, wobei die deutlich niedrigere Rückfallquote in Norwegen als Argument für einen pragmatischeren Ansatz angeführt wird. Die Arbeit zielt darauf ab, die Zweckmäßigkeit des Schuldprinzips im Allgemeinen zu hinterfragen und dessen Auswirkungen auf gesellschaftliche, politische und rechtliche Entscheidungen zu untersuchen.
2. Das Phänomen „Schuld“: Grundlagen und Einordnung: Dieses Kapitel beleuchtet den komplexen Begriff der „Schuld“ aus verschiedenen Perspektiven. Es wird zunächst eine Definition des Begriffs im heutigen abendländischen Kulturraum versucht, wobei die Uneinheitlichkeit und Vielschichtigkeit des Begriffs hervorgehoben werden. Die Betrachtung des Schuldbegriffs in unterschiedlichen Einzelwissenschaften sowie seine historische Entwicklung in der griechischen Antike, der jüdisch-christlichen Tradition und der Moderne liefern einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Facetten des Phänomens „Schuld“ und bereiten den Boden für die spätere Analyse seiner Funktionalität.
3. Die Funktionsfähigkeit von Schuld: Dieses Kapitel untersucht die Funktionsfähigkeit des Schuldprinzips, insbesondere im deutschen Strafrecht. Es analysiert den Stand der Forschung, den zugrundeliegenden Maßstab des Gemeinwohls und die Wirkungsweise des Schuldprinzips bei der Strafverfolgung und -vollstreckung. Es werden kritische Punkte hinsichtlich der Effektivität des Schuldprinzips im Kontext des Gemeinwohls aufgezeigt und die Grundlage für die spätere empirische Untersuchung in Kapitel 6 gelegt.
Schlüsselwörter
Schuldprinzip, Gemeinwohlorientierung, Strafrecht, Strafvollzug, Lösungsorientierung, Effektivität, Resozialisierung, Vergeltung, Empirische Forschung, Norwegen, Deutschland, Ersatzfreiheitsstrafe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Vereinbarkeit des Schuldprinzips mit einer gemeinwohlorientierten Lösungsfindung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Vereinbarkeit des Schuldprinzips mit einer gemeinwohlorientierten Lösungsfindung auf gesellschaftlicher Ebene. Sie hinterfragt, inwieweit ein schuldbasiertes Vorgehen eine konstruktive Problemlösung behindert und alternative, effektivere Ansätze im Hinblick auf das Gemeinwohl in den Vordergrund rückt. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Effektivität des Schuldprinzips im deutschen Strafrecht, mit Beispielen aus dem Strafvollzug.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und historische Entwicklung des Schuldbegriffs, die Funktionsfähigkeit des Schuldprinzips im deutschen Strafrecht, eine empirische Untersuchung der Ineffektivität des Schuldprinzips anhand von Beispielen (insbesondere Strafvollzug), einen Vergleich verschiedener Strafvollzugssysteme (u.a. Norwegen und Deutschland) und den Konflikt zwischen Schuldprinzip und Gemeinwohlorientierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Das Phänomen „Schuld“: Grundlagen und Einordnung, Die Funktionsfähigkeit von Schuld, Klärung der Fragestellung, Methodisches Vorgehen, Ergebnisse (mit Unterpunkten zur Ineffektivität des Schuldprinzips im Strafvollzug und bei der Ersatzfreiheitsstrafe), Diskussion und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel ausführlicher beschrieben.
Welche konkreten Beispiele werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Ineffektivität des Schuldprinzips anhand von Beispielen aus dem deutschen Strafvollzug und der Ersatzfreiheitsstrafe. Der Vergleich mit dem norwegischen Strafvollzugssystem, das eine deutlich niedrigere Rückfallquote aufweist, dient als Argument für einen pragmatischeren, lösungsorientierten Ansatz.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist die Vereinbarkeit des Schuldprinzips mit einer lösungsorientierten, gemeinwohlorientierten Vorgehensweise. Die Arbeit hinterfragt die Zweckmäßigkeit des Schuldprinzips und dessen Auswirkungen auf gesellschaftliche, politische und rechtliche Entscheidungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schuldprinzip, Gemeinwohlorientierung, Strafrecht, Strafvollzug, Lösungsorientierung, Effektivität, Resozialisierung, Vergeltung, Empirische Forschung, Norwegen, Deutschland, Ersatzfreiheitsstrafe.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt das methodische Vorgehen in einem eigenen Kapitel. Es wird eine empirische Untersuchung der Ineffektivität des Schuldprinzips durchgeführt, unter anderem durch den Vergleich verschiedener Strafvollzugssysteme.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen werden im Kapitel "Diskussion" und "Ausblick" präsentiert. Die Arbeit soll aufzeigen, ob und inwieweit das Schuldprinzip einer gemeinwohlorientierten Lösungsfindung im Weg steht und welche alternativen Ansätze erfolgversprechender sind.
- Citar trabajo
- Elena Höppner (Autor), 2020, Schuld. Eine Untersuchung zur Lösungs- und Gemeinwohlorientierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022176