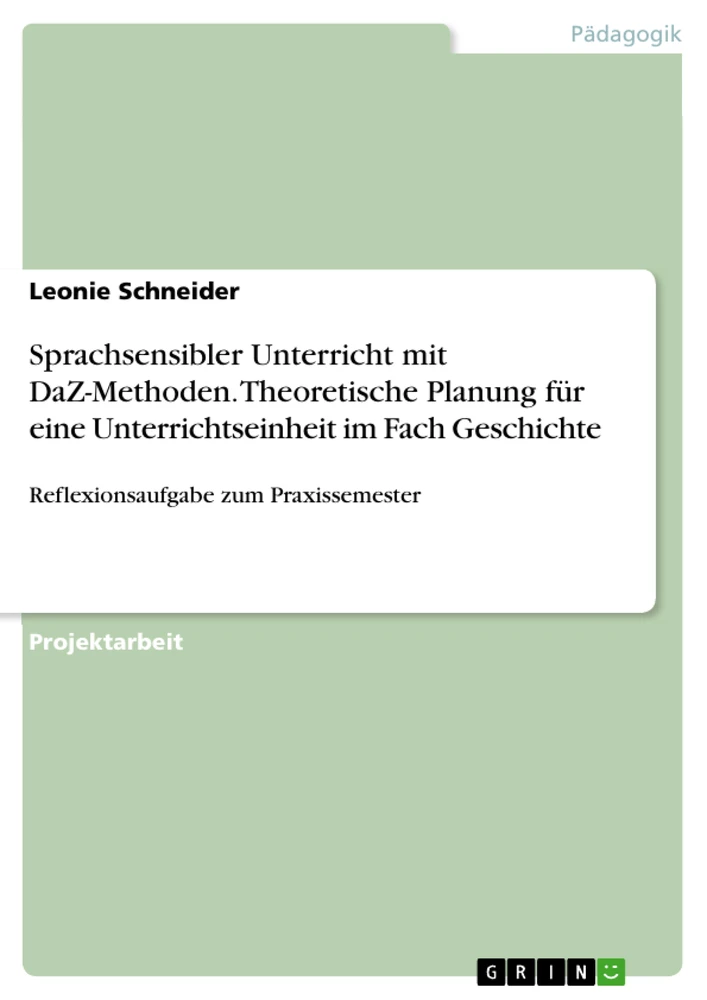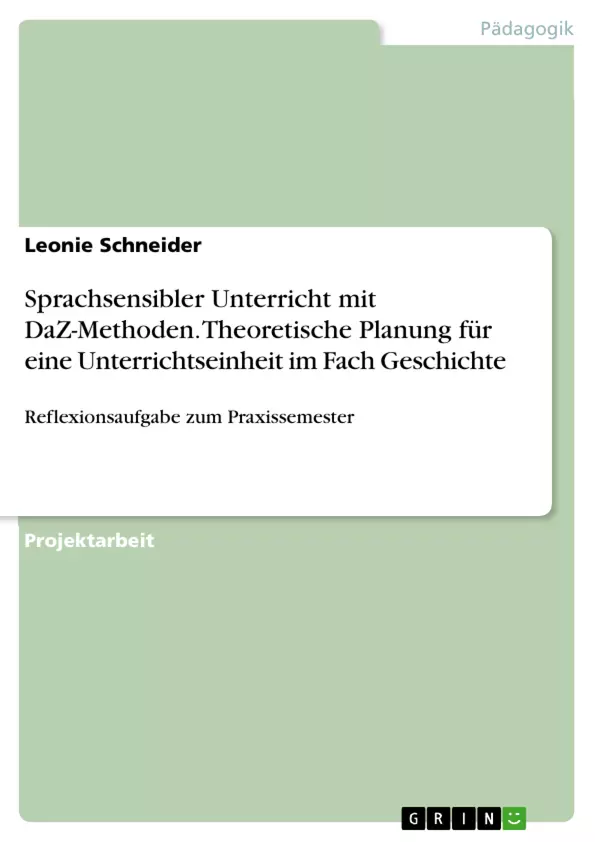In dieser Arbeit wird ein Praxismodell eines sprachsensiblen Unterrichts im Fach Geschichte vorgestellt und im Anschluss reflektiert.
Bei der behandelten Lerngruppe handelt es sich um einen Geschichtsleistungskurs, der insgesamt aus sechzehn SchülerInnen zusammengesetzt ist, von denen elf monolingual mit Deutsch als Muttersprache (DaM) und fünf in mehrsprachigen Haushalten aufgewachsen sind. Vier von fünf der bilingual aufgewachsenen SchülerInnen geben an, seit ihrer Geburt mit beiden Sprachen (etwa zu gleichen Teilen) regelmäßig in Kontakt gekommen zu sein, weshalb hier von einem ungesteuerten bilingualen Erstspracherwerb (L1) gesprochen werden kann.
Neben dem Deutschen sind besagte SchülerInnen mit den Familiensprachen Türkisch, Polnisch und Arabisch aufgewachsen (L1). Lediglich eine Schülerin gibt an, dass sie erst im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland kam und deshalb Deutsch als ihre Zweitsprache (L2/ DaZ) und Griechisch als Erstsprache (L1) einzustufen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1) Die sprachliche Heterogenität der Lerngruppe
- 2) Angestrebte fachliche Kompetenzen der Unterrichtseinheit
- 3) Die sprachlichen Anforderungen der fachlichen Ziele der Unterrichtseinheit
- 4) Die sprachlichen Fähigkeiten der SchülerInnen im Blick auf die Unterrichtsziele
- 5) Reflexion unter Bezugnahme sprachsensibler Unterrichtsmethoden
- 6) Die wesentlichen Merkmale meiner Praktikumsschule im Bezug auf Konzepte sprachlicher Bildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Reflexionsaufgabe analysiert die sprachliche Heterogenität einer Geschichtsleistungskursgruppe und die damit verbundenen Herausforderungen im Unterricht. Es wird eine theoretische Unterrichtseinheit zum Thema "Soziale Frage in der Industrialisierung" betrachtet und die angestrebten fachlichen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteilskompetenz) sowie die damit verbundenen sprachlichen Anforderungen beleuchtet. Die Aufgabe reflektiert den Einsatz sprachsensibler Methoden und die Rolle der Schule im Kontext sprachlicher Bildung.
- Sprachliche Heterogenität im Geschichtsunterricht
- Fachliche Kompetenzen im Geschichtsunterricht und deren sprachliche Voraussetzungen
- Sprachsensible Unterrichtsmethoden
- Rolle der Schule in der sprachlichen Bildung
- Theoretische Planung einer Unterrichtseinheit
Zusammenfassung der Kapitel
1) Die sprachliche Heterogenität der Lerngruppe: Dieses Kapitel beschreibt die Zusammensetzung der Lerngruppe, bestehend aus elf Schülern mit Deutsch als Muttersprache und fünf Schülern mit mehrsprachigen Hintergründen. Es wird detailliert auf den bilingualen Erstspracherwerb der mehrsprachigen Schüler eingegangen, wobei die Familiensprachen Türkisch, Polnisch, Arabisch und Griechisch genannt werden. Das Kapitel betont die insgesamt hohe sprachliche Leistungsfähigkeit der Gruppe, hebt aber gleichzeitig Herausforderungen hervor, insbesondere im Umgang mit Fachterminologie und Operatoren im Kontext der Geschichtswissenschaft. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit eines sprachsensiblen Unterrichtsansatzes im Fach Geschichte aufgrund der komplexen Textarbeit mit oft altertümlichen Quellentexten und fachspezifischer Terminologie.
2) Angestrebte fachliche Kompetenzen der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele einer geplanten (aber pandemiebedingt nicht durchgeführten) Doppelstunde zum Thema "Lösungsansätze der sozialen Frage in der Industrialisierung". Das Hauptlernziel besteht in der Bewertung verschiedener Lösungsansätze durch den Vergleich unterschiedlicher Akteursgruppen (Unternehmer, Politiker, Gewerkschaften, Kirche) anhand von Quellentexten. Es werden die angestrebten Kompetenzen – Sachkompetenz (Bewertung von Lösungsansätzen), Urteilskompetenz (Werturteilsbildung und argumentative Begründung) und Methodenkompetenz (problemorientierte Darstellung und adressatengerechte Präsentation) – detailliert erläutert. Die Einbindung einer Hausaufgabe zur Aktualisierung des Themas unterstreicht den angestrebten Verknüpfung von historischem Wissen und gegenwärtiger Relevanz.
3) Die sprachlichen Anforderungen der fachlichen Ziele der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel betont die zentrale Rolle von Sprache im Geschichtsunterricht, da im Klassenzimmer keine direkten historischen Erfahrungen möglich sind. Es wird hervorgehoben, dass die Konstruktion von Phänomenen durch Begriffe den historischen Diskurs erst ermöglicht. Der Konstruktcharakter der Geschichte wird ebenfalls thematisiert. Die Bedeutung eines fundierten Fachwortschatzes für die Kommunikation im Unterricht und das Verständnis komplexer historischer Sachverhalte wird unterstrichen. Das Kapitel verdeutlicht, wie sprachliche Fähigkeiten essentiell für den Erwerb fachlicher Kompetenzen im Geschichtsunterricht sind.
Schlüsselwörter
Sprachliche Heterogenität, DaZ, Geschichtsunterricht, Fachsprache, Sprachsensible Unterrichtsmethoden, Fachkompetenz, Soziale Frage, Industrialisierung, Quellenanalyse, Kompetenzorientierter Unterricht, Mehrsprachigkeit, Theoretische Unterrichtsplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Reflexionsaufgabe: Sprachliche Heterogenität im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Reflexionsaufgabe?
Die Reflexionsaufgabe analysiert die Herausforderungen der sprachlichen Heterogenität in einer Geschichtsleistungskursgruppe und deren Auswirkungen auf den Unterricht. Im Fokus steht eine theoretisch geplante Unterrichtseinheit zum Thema "Soziale Frage in der Industrialisierung".
Welche Aspekte werden in der Reflexionsaufgabe behandelt?
Die Aufgabe behandelt die sprachliche Heterogenität der Lerngruppe, die angestrebten fachlichen Kompetenzen (Sach-, Methoden-, Urteilskompetenz) der Unterrichtseinheit, die damit verbundenen sprachlichen Anforderungen, den Einsatz sprachsensibler Methoden und die Rolle der Schule im Kontext sprachlicher Bildung. Es wird eine detaillierte Analyse der geplanten Unterrichtseinheit inklusive einer Zusammenfassung der Kapitel durchgeführt.
Wie ist die Lerngruppe zusammengesetzt?
Die Lerngruppe besteht aus elf Schülern mit Deutsch als Muttersprache und fünf Schülern mit mehrsprachigen Hintergründen. Die Familiensprachen der mehrsprachigen Schüler sind Türkisch, Polnisch, Arabisch und Griechisch. Trotz der sprachlichen Vielfalt wird eine insgesamt hohe sprachliche Leistungsfähigkeit der Gruppe betont.
Welche fachlichen Kompetenzen werden in der Unterrichtseinheit angestrebt?
Die angestrebten Kompetenzen sind Sachkompetenz (Bewertung von Lösungsansätzen der sozialen Frage), Urteilskompetenz (Werturteilsbildung und argumentative Begründung) und Methodenkompetenz (problemorientierte Darstellung und adressatengerechte Präsentation). Die Schüler sollen verschiedene Lösungsansätze der sozialen Frage in der Industrialisierung aus der Perspektive unterschiedlicher Akteursgruppen (Unternehmer, Politiker, Gewerkschaften, Kirche) bewerten und vergleichen.
Welche sprachlichen Anforderungen ergeben sich aus den fachlichen Zielen?
Die sprachlichen Anforderungen umfassen den Umgang mit Fachterminologie, den historischen Quellentexten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte argumentativ zu präsentieren und zu diskutieren. Ein fundierter Fachwortschatz und die Fähigkeit, historische Konstrukte zu verstehen, sind essentiell für den Erfolg.
Welche Rolle spielen sprachsensible Unterrichtsmethoden?
Die Aufgabe betont die Notwendigkeit sprachsensibler Unterrichtsmethoden, um den unterschiedlichen sprachlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden und allen Schülern den Zugang zum Fachwissen zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Bewältigung der komplexen Textarbeit mit oft altertümlichen Quellentexten und der fachspezifischen Terminologie.
Welche Rolle spielt die Schule im Kontext sprachlicher Bildung?
Die Reflexionsaufgabe beleuchtet die Rolle der Schule bei der Förderung der sprachlichen Bildung und wie die Schule auf die sprachliche Heterogenität der Schüler eingehen kann. Es wird die Notwendigkeit eines sprachsensiblen Ansatzes im Geschichtsunterricht hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Reflexionsaufgabe?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Heterogenität, DaZ, Geschichtsunterricht, Fachsprache, Sprachsensible Unterrichtsmethoden, Fachkompetenz, Soziale Frage, Industrialisierung, Quellenanalyse, Kompetenzorientierter Unterricht, Mehrsprachigkeit, Theoretische Unterrichtsplanung.
- Quote paper
- Leonie Schneider (Author), 2020, Sprachsensibler Unterricht mit DaZ-Methoden. Theoretische Planung für eine Unterrichtseinheit im Fach Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022339