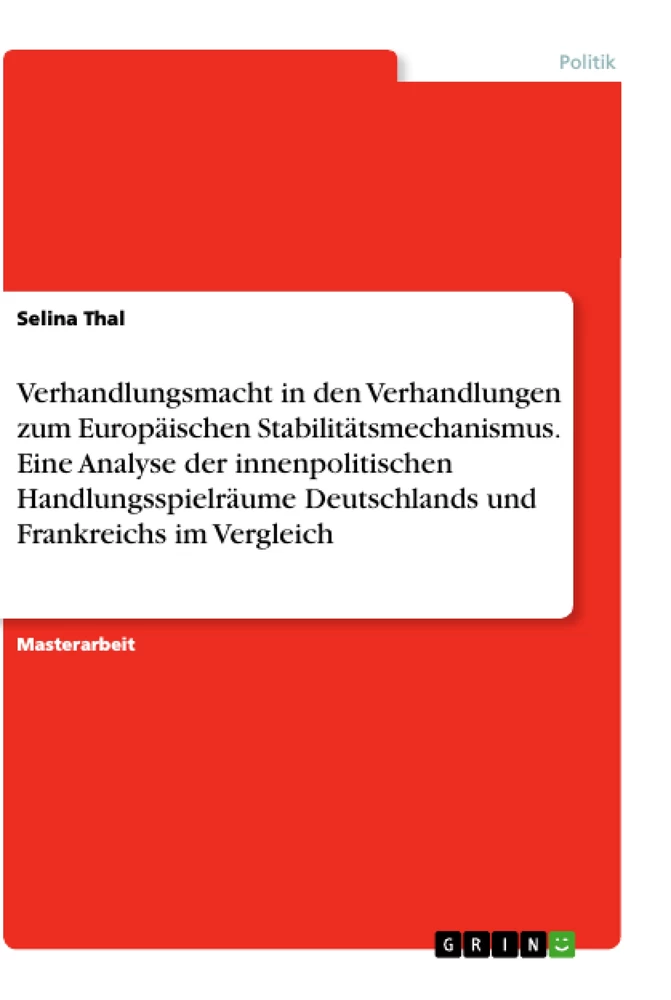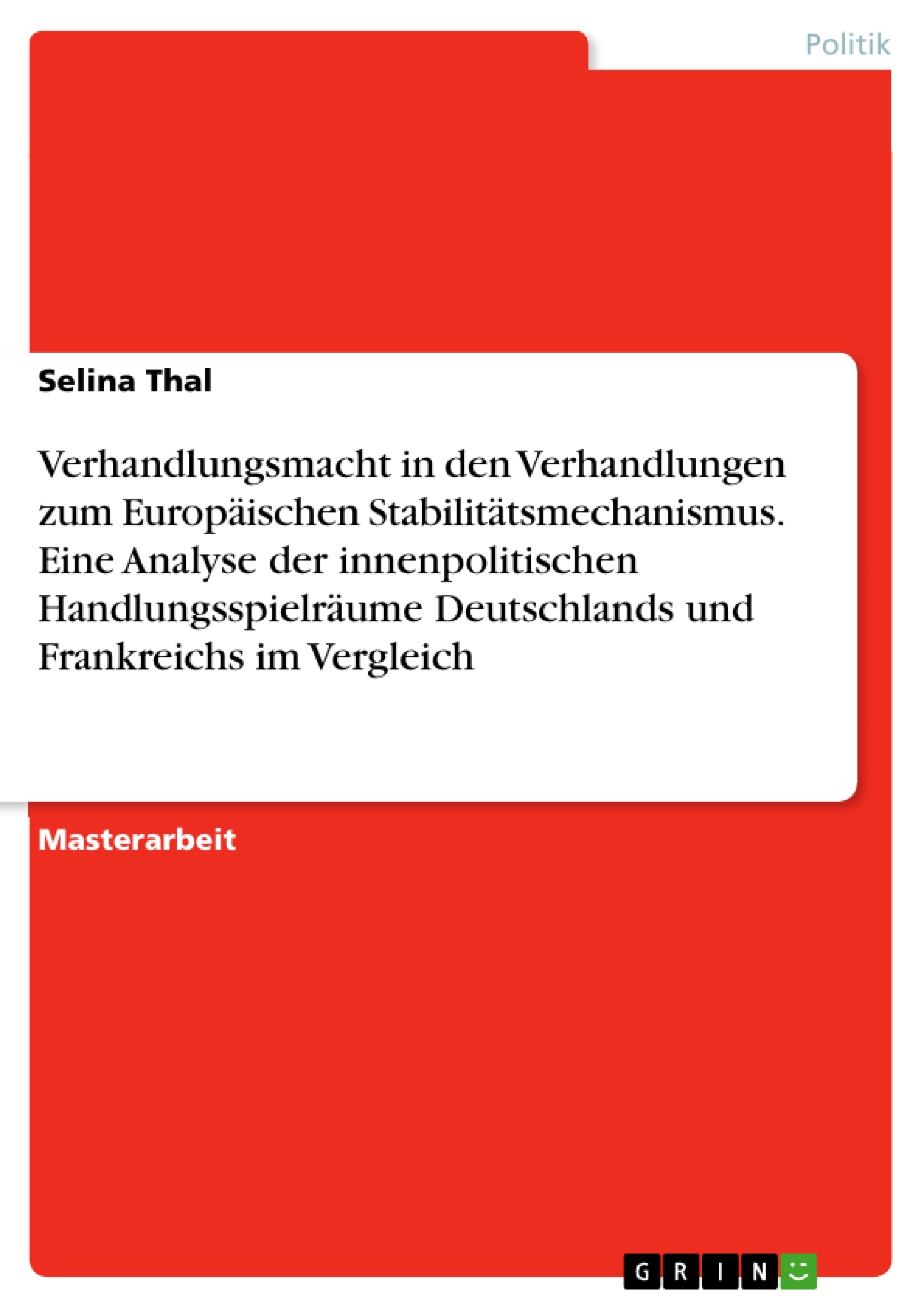In den Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) konnten sich Frankreich und Deutschland nur ungleich durchsetzen und das obwohl beide Länder als größte Anteilseigner ein ähnlich hohes finanzielles Risiko tragen. Wie ist dieser Unterschied in der Verhandlungsmacht auf zwischenstaatlicher Ebene zu erklären? Den theoretischen Rahmen für die Beantwortung dieser Frage bietet der erweiterte Zwei-Ebenen-Ansatz, der für eine vergleichende Perspektive in politischen „Krisenzeiten“ fruchtbar gemacht werden soll.
Die Lösung der Wirtschafts- und Finanzkrise hing im Wesentlichen von der Kompromissfähigkeit der beiden einflussreichsten europäischen Regierungen ab. Die deutsch-französische Zusammenarbeit wurde insbesondere in dieser turbulenten Zeit vielfach als konfliktreich und kurz nach Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise als wenig dynamisch rezipiert. Die Gründe für diesen Befund seien die unterschiedlichen wirtschafts- und fiskalpolitischen Traditionen, die damit einhergehenden unterschiedlichen Visionen eines wirtschaftspolitischen Europas und die in der Konsequenz existenten Divergenzen zwischen geeigneten Strategien, institutionellen Präferenzen und den zu ergreifenden politischen Maßnahmen gewesen. Die Analysen zum deutsch-französischen Bilateralismus erfolgten daher vorrangig in Form einer Deskription der "Höhen und Tiefen" in der Zusammenarbeit während der Eurokrise. Gleichzeitig thematisiert Schild die gegenseitigen Zugeständnisse in den Verhandlungen, ohne jedoch nach der Erfolgsbilanz der durchgesetzten Positionen oder nach deren Voraussetzungen zu fragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie
- 2.1 Der Zwei-Ebenen-Ansatz
- 2.2 Der Prinzipal-Agenten-Ansatz
- 2.3 Zusammenfassung und Hypothesen
- 3. Forschungsdesign
- 3.1 Begründung der Fallauswahl
- 3.2 Operationalisierung
- 3.3 Quellen
- 4. Der Europäische Stabilitätsmechanismus
- 4.1 Verhandlungsverlauf und Ergebnisse
- 4.2 Positionen der französischen und deutschen Regierung
- 4.3 Erfolg der Verhandlungspositionen im Vergleich
- 5. Frankreich: Determinanten des innerstaatlichen Win-Sets
- 5.1 Die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation
- 5.2 Salienz
- 5.3 Glaubhaftigkeit kostenträchtiger Sanktionsdrohungen
- 5.4 Fazit
- 6. Deutschland: Determinanten des innerstaatlichen Win-Sets
- 6.1 Die institutionellen Regeln der formalen Ratifikation
- 6.2 Salienz
- 6.3 Glaubhaftigkeit kostenträchtiger Sanktionsdrohungen
- 6.4 Fazit
- 7. Die innerstaatlichen Win-Sets im Vergleich
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die unterschiedliche Durchsetzungsfähigkeit Frankreichs und Deutschlands in den Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), obwohl beide Länder als größte Anteilseigner ein vergleichbares finanzielles Risiko tragen. Der erweiterte Zwei-Ebenen-Ansatz dient als theoretischer Rahmen, um die innerstaatlichen Restriktionen (Win-Sets) beider Regierungen zu analysieren und deren Einfluss auf die internationale Verhandlungsmacht zu erklären. Die Hypothese lautet: Ein kleineres innerstaatliches Win-Set führt zu größerer Verhandlungsmacht.
- Vergleichende Analyse der Verhandlungsmacht Deutschlands und Frankreichs beim ESM
- Anwendung des erweiterten Zwei-Ebenen-Ansatzes auf internationale Krisenverhandlungen
- Bestimmung der innerstaatlichen Restriktionen (Win-Sets) beider Regierungen
- Einfluss ökonomischer und politischer Machtasymmetrien auf die Verhandlungsergebnisse
- Rolle der Wahlbevölkerung als Prinzipal in politischen Ausnahmezuständen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der unterschiedlichen Verhandlungsmacht Deutschlands und Frankreichs im Rahmen der Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus ein. Es formuliert die Forschungsfrage und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf dem erweiterten Zwei-Ebenen-Ansatz basiert. Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den Gründen für die unterschiedliche Durchsetzungskraft beider Länder trotz ähnlicher Risikolage. Die Einleitung legt den Grundstein für die gesamte Untersuchung und betont die Relevanz des Themas im Kontext europäischer Krisenbewältigung.
2. Theorie: Das Kapitel erläutert den theoretischen Rahmen der Arbeit, wobei der Zwei-Ebenen-Ansatz und der Prinzipal-Agenten-Ansatz im Detail vorgestellt werden. Es wird analysiert, wie innerstaatliche Faktoren die Handlungsspielräume (Win-Sets) der Regierungen beeinflussen und sich auf deren Verhandlungsmacht auf internationaler Ebene auswirken. Die Kapitelstruktur dient der systematischen Einführung in die theoretischen Grundlagen, die im weiteren Verlauf der Arbeit angewendet werden. Die Hypothesen werden aus dem theoretischen Kontext abgeleitet. Es wird dargelegt wie der Zwei-Ebenen Ansatz in einer vergleichenden Perspektive zur Erklärung internationaler Verhandlungsergebnisse verwendet werden kann, und wie der Prinzipal-Agenten Ansatz dabei mitwirkt.
3. Forschungsdesign: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, einschließlich der Begründung der Fallauswahl (Deutschland und Frankreich), der Operationalisierung der zentralen Konzepte und der verwendeten Quellen. Es legt dar, wie die Daten erhoben und analysiert wurden, um die Forschungsfrage zu beantworten. Die detaillierte Beschreibung der Forschungsmethodik dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die Wahl der Länder wird begründet und die gewählte Operationalisierung der Kernkonzepte erläutert.
4. Der Europäische Stabilitätsmechanismus: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Darstellung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), einschließlich des Verhandlungsverlaufs und der Ergebnisse. Die Positionen der französischen und deutschen Regierung werden gegenübergestellt und ihre jeweiligen Erfolge analysiert. Die Analyse des ESM als institutionellen Kontext bildet die Grundlage für das Verständnis der Verhandlungsdynamiken und der unterschiedlichen nationalen Interessen. Es wird detailliert auf den Verlauf der Verhandlungen eingegangen und die Ergebnisse im Detail dargestellt.
5. Frankreich: Determinanten des innerstaatlichen Win-Sets: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Analyse der Faktoren, die das innerstaatliche Win-Set Frankreichs in Bezug auf den ESM beeinflusst haben. Es werden die institutionellen Regeln der Ratifikation, die öffentliche Meinung (Salienz) und die Glaubwürdigkeit potenzieller Sanktionen untersucht. Die Analyse untersucht die institutionellen Rahmenbedingungen, die öffentliche Debatte und die Glaubwürdigkeit der Regierung in Bezug auf ihre Verhandlungsposition. Es wird detailliert erklärt wie diese Faktoren das Win-Set beeinflusst haben.
6. Deutschland: Determinanten des innerstaatlichen Win-Sets: Ähnlich wie Kapitel 5, konzentriert sich dieses Kapitel auf die Analyse der Faktoren, die das innerstaatliche Win-Set Deutschlands beeinflusst haben. Es wird die Ratifikationsprozedur, die öffentliche Meinung und die Glaubwürdigkeit staatlicher Sanktionen untersucht und im Vergleich zu Kapitel 5 analysiert. Dieser Abschnitt untersucht die institutionellen Strukturen, die öffentliche Wahrnehmung und die Glaubhaftigkeit der deutschen Regierung bezüglich ihrer Verhandlungsposition. Ein Vergleich mit den französischen Faktoren ermöglicht weitere Einblicke.
7. Die innerstaatlichen Win-Sets im Vergleich: In diesem Kapitel werden die innerstaatlichen Win-Sets Frankreichs und Deutschlands vergleichend analysiert. Die Ergebnisse der vorherigen Kapitel werden zusammengeführt, um die Unterschiede in den Handlungsspielräumen beider Regierungen und deren Auswirkungen auf die Verhandlungsmacht zu beleuchten. Der Vergleich der Ergebnisse liefert eine umfassende Analyse der Unterschiede in den Handlungsspielräumen beider Länder und deren Konsequenzen für deren Verhandlungsmacht.
Schlüsselwörter
Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Verhandlungsmacht, Zwei-Ebenen-Ansatz, Prinzipal-Agenten-Ansatz, Win-Set, innerstaatliche Restriktionen, Deutschland, Frankreich, Vergleichende Analyse, Internationale Verhandlungen, Politische Krisen, Ökonomische Machtasymmetrien, Politische Machtasymmetrien, Ratifikation, Salienz, Sanktionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Verhandlungsmacht Deutschlands und Frankreichs beim ESM
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die unterschiedliche Durchsetzungsfähigkeit Deutschlands und Frankreichs bei den Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), trotz vergleichbarer finanzieller Risiken als größte Anteilseigner. Sie untersucht die innerstaatlichen Restriktionen (Win-Sets) beider Regierungen und deren Einfluss auf die internationale Verhandlungsmacht.
Welchen theoretischen Rahmen verwendet die Arbeit?
Die Arbeit nutzt den erweiterten Zwei-Ebenen-Ansatz als theoretischen Rahmen, um die innerstaatlichen Faktoren zu analysieren, die die Handlungsspielräume der Regierungen beeinflussen. Zusätzlich wird der Prinzipal-Agenten-Ansatz herangezogen.
Welche Hypothese wird aufgestellt?
Die zentrale Hypothese lautet: Ein kleineres innerstaatliches Win-Set führt zu größerer Verhandlungsmacht.
Welche Länder werden im Vergleich untersucht?
Die Arbeit vergleicht die Verhandlungspositionen und die innerstaatlichen Win-Sets Deutschlands und Frankreichs.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Theorie (inkl. Zwei-Ebenen- und Prinzipal-Agenten-Ansatz), Forschungsdesign, Darstellung des ESM, Analyse des französischen Win-Sets, Analyse des deutschen Win-Sets, Vergleich der Win-Sets und Schlussbetrachtung.
Was wird im Kapitel "Forschungsdesign" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Methodik, die Fallauswahl (Deutschland und Frankreich), die Operationalisierung der Konzepte und die verwendeten Quellen. Es erläutert die Datengewinnung und -analyse.
Was wird im Kapitel zum ESM erläutert?
Das Kapitel präsentiert eine detaillierte Darstellung des ESM, einschließlich des Verhandlungsverlaufs, der Ergebnisse und der Positionen der französischen und deutschen Regierung.
Wie werden die innerstaatlichen Win-Sets analysiert?
Die Analyse der innerstaatlichen Win-Sets berücksichtigt die institutionellen Regeln der Ratifikation, die öffentliche Meinung (Salienz) und die Glaubwürdigkeit potenzieller Sanktionen für beide Länder.
Was ist das Ergebnis des Vergleichs der Win-Sets?
Das Kapitel "Die innerstaatlichen Win-Sets im Vergleich" führt die Ergebnisse der Einzelanalysen zusammen und beleuchtet die Unterschiede in den Handlungsspielräumen und deren Auswirkungen auf die Verhandlungsmacht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM), Verhandlungsmacht, Zwei-Ebenen-Ansatz, Prinzipal-Agenten-Ansatz, Win-Set, innerstaatliche Restriktionen, Deutschland, Frankreich, Vergleichende Analyse, Internationale Verhandlungen, Politische Krisen, Ökonomische Machtasymmetrien, Politische Machtasymmetrien, Ratifikation, Salienz, Sanktionen.
- Quote paper
- Selina Thal (Author), 2016, Verhandlungsmacht in den Verhandlungen zum Europäischen Stabilitätsmechanismus. Eine Analyse der innenpolitischen Handlungsspielräume Deutschlands und Frankreichs im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022413