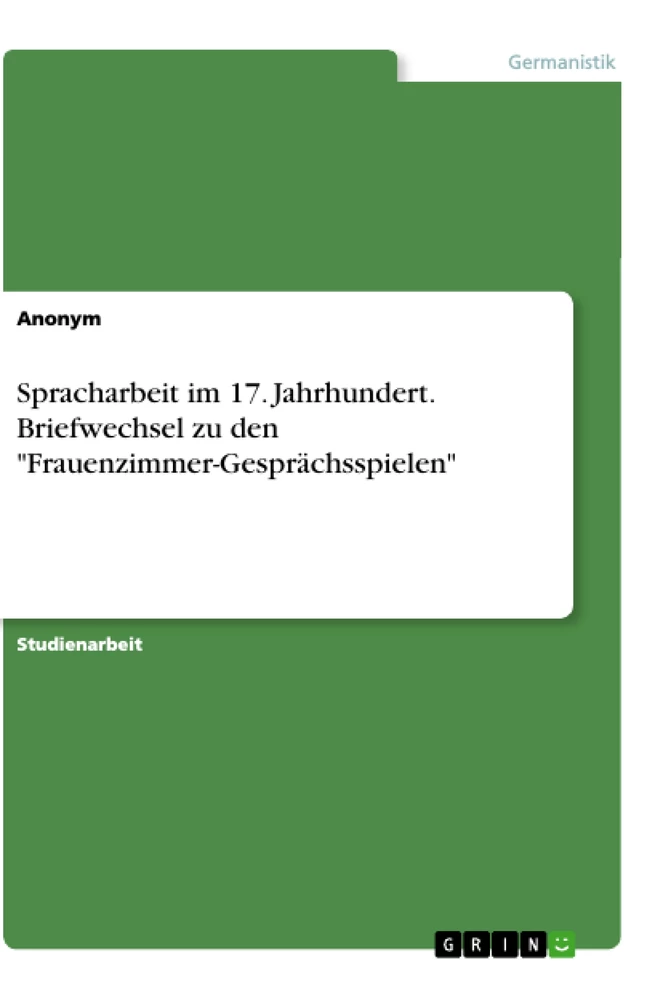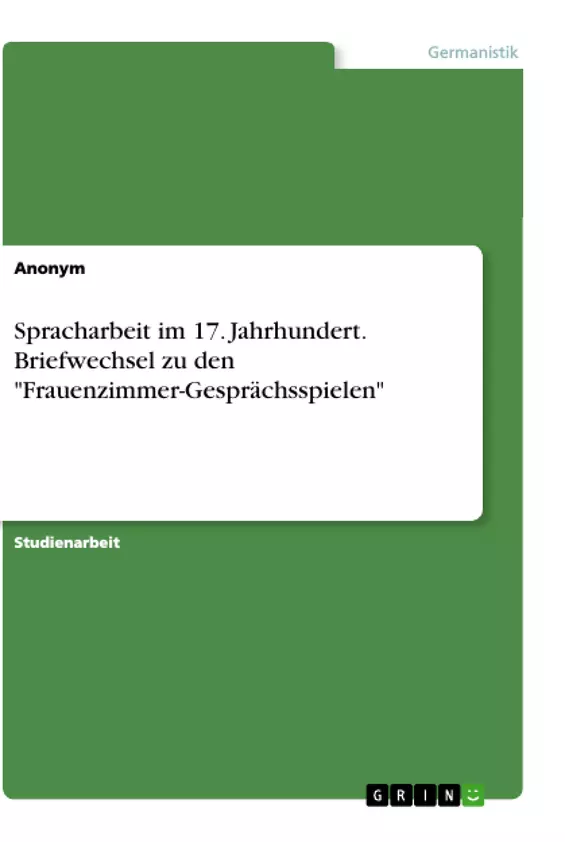Diese Arbeit untersucht, was Spracharbeit ist und wer sie betrieben hat. Dazu wird die wichtigste Sprachgesellschaft des 17. Jahrhunderts vorgestellt, die 'Fruchtbringende Gesellschaft'. Genauer werden die Lebensläufe von Justus Georg Schottelius und Georg Philipp Harsdörffer vorgestellt. Danach wird ein Briefwechsel der 'Fruchtbringenden Gesellschaft' zu den "Frauenzimmer‐ Gesprächsspielen" analysiert.
Hierbei liegt der Fokus darauf, wie durch Metaphern und andere rhetorische Mittel die Spracharbeit in den Briefen verwirklicht wird. Die verschiedenen Faktoren, die die Spracharbeit ausmachte, kann man in den Briefen sehr gut aufzeigen und herausarbeiten. Spracharbeit im 17. Jahrhundert bezieht sich auf ganz verschiedene Aspekte der Sprache. Insbesondere
wird eine ontologische Motiviertheit der sprachlichen Zeichen angenommen. Dies bedeutet, dass die sprachlichen Zeichen einen direkten Bezug zur Wirklichkeit haben.
Vor allem Lautmalerei ist ein rhetorisches Mittel, in dem sich die Motiviertheit der Zeichen ganz offen zeigt. Hier ist die Lautstruktur des Wortes in direkter Verbindung mit dem zu bezeichnenden Gegenstand (z.B. Kuckuck, knacken, etc.). Es gilt eine prinzipielle Rückführbarkeit der Sprachzeichen auf Naturlaute. Außerdem wird das Deutsche immer wieder, auch durch sein fortgeschrittenes Alter, mit dem Hebräischen verglichen, um ihm so mehr Wichtigkeit neben anderen Sprachen zu verleihen.
Man will die deutsche Sprache so gesellschaftsfähiger machen und ihr mehr Prestige verleihen. Es wird eine sehr enge Verbindung zwischen Sprache und Verhaltensnormen angenommen. Schottelius, ein Mitglied der 'Fruchtbringenden Gesellschaft', ging sogar davon aus, dass sich Änderungen des Verhaltens eines Volkes immer auf Sprachveränderungen zurückführen lassen. Der deutschen Sprache wird außerdem, auch durch die Motiviertheit der Zeichen, eine welterschließende Funktion zugerechnet. Nur durch die Sprache kann also die Welt für die Menschen erschließbar werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist mit Spracharbeit gemeint?
- Wer beschäftigte sich mit Spracharbeit?
- Georg Philipp Harsdörffer
- Justus Georg Schottelius
- Analyse eines Briefwechsels der FG zu den Frauenzimmer-Gesprächsspielen
- Harsdörffers Vorrede an die FG und Bitte um Mitgliedschaft
- Ausschreiben der FG an Harsdörffer mit Aufnahme in die FG
- Übereignungsschrift Harsdörffers an die FG und Annahme der Mitgliedschaft
- Zuschreiben Harsdörffers an die FG und Bitte um Korrektur des dritten Teils
- Sonett von Fürst Ludwig an Diederich von dem Werder bzgl. der Frauenzimmergesprächsspiele
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die „Spracharbeit“ im 17. Jahrhundert in Deutschland, fokussiert auf die Fruchtbringende Gesellschaft und deren Mitglieder. Sie klärt den Begriff der Spracharbeit, stellt wichtige Persönlichkeiten vor und analysiert einen Briefwechsel bezüglich der „Frauenzimmer-Gesprächsspiele“ als Beispiel für die damaligen sprachlichen und kulturellen Bestrebungen.
- Definition und Facetten der Spracharbeit im 17. Jahrhundert
- Die Fruchtbringende Gesellschaft und ihre Rolle in der Sprachpflege
- Analyse rhetorischer Mittel und sprachlicher Strategien in der Korrespondenz
- Verbindung zwischen Sprache, Kultur und gesellschaftlichen Normen
- Das Verhältnis des Deutschen zu anderen europäischen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsfokus der Arbeit: die Klärung des Begriffs „Spracharbeit“ im 17. Jahrhundert, die Vorstellung der Fruchtbringenden Gesellschaft und die Analyse eines Briefwechsels, um die damaligen sprachlichen Praktiken zu verdeutlichen. Die Arbeit untersucht, wie Metaphern und rhetorische Mittel die Spracharbeit in den Briefen zum Ausdruck bringen und welche Faktoren diese ausmachen.
Was ist mit Spracharbeit gemeint?: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte der Spracharbeit im 17. Jahrhundert. Es beschreibt die ontologische Motiviertheit sprachlicher Zeichen, die enge Verbindung zwischen Sprache und Verhaltensnormen, und die welterschließende Funktion der Sprache. Die Kapitel analysiert sprachpflegerische Ziele wie die Bereinigung des Deutschen von Fremdwörtern und die sprachreflexiven Praktiken, die die Erkundung der deutschen Sprachstrukturen und die Erweiterung des Textsortenrepertoires zum Ziel hatten. Die drei großen Strömungen dieser Zeit – Sprachuniversalismus, Sprachmystik und ontologisierender Sprachpatriotismus – werden kurz vorgestellt.
Wer beschäftigte sich mit Spracharbeit?: Dieses Kapitel stellt die Fruchtbringende Gesellschaft vor, die im 17. Jahrhundert die Spracharbeit institutionalisierte. Es beschreibt die Gründung der Gesellschaft, ihre Entwicklung und den Einfluss wichtiger Mitglieder wie Christian Gueintz und Justus Georg Schottelius auf die Sprachnormierung. Das Kapitel hebt die Bedeutung der Aufnahme von Nicht-Adeligen in die Gesellschaft hervor und markiert das Ende der intensiven Spracharbeit mit dem Tod wichtiger Mitglieder.
Schlüsselwörter
Spracharbeit, 17. Jahrhundert, Fruchtbringende Gesellschaft, Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius, Sprachpflege, Sprachnormierung, Rhetorik, Metaphern, Deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Sprachphilosophie, Ontologische Motiviertheit, Sprachpatriotismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Spracharbeit im 17. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der „Spracharbeit“ im 17. Jahrhundert in Deutschland, insbesondere im Kontext der Fruchtbringenden Gesellschaft. Sie untersucht den Begriff der Spracharbeit, stellt wichtige Persönlichkeiten vor und analysiert einen Briefwechsel als Beispiel für die damaligen sprachlichen und kulturellen Bestrebungen. Der Fokus liegt auf der Analyse rhetorischer Mittel und sprachlicher Strategien in der Korrespondenz sowie der Verbindung zwischen Sprache, Kultur und gesellschaftlichen Normen.
Was versteht man unter „Spracharbeit“ im 17. Jahrhundert?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten der Spracharbeit, darunter die ontologische Motiviertheit sprachlicher Zeichen, den engen Zusammenhang zwischen Sprache und Verhaltensnormen sowie die welterschließende Funktion der Sprache. Sie analysiert sprachpflegerische Ziele wie die Bereinigung des Deutschen von Fremdwörtern und die sprachreflexiven Praktiken zur Erkundung deutscher Sprachstrukturen und Erweiterung des Textsortenrepertoires. Die drei großen Strömungen dieser Zeit – Sprachuniversalismus, Sprachmystik und ontologisierender Sprachpatriotismus – werden ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielte die Fruchtbringende Gesellschaft?
Die Fruchtbringende Gesellschaft wird als Institution vorgestellt, die die Spracharbeit im 17. Jahrhundert institutionalisierte. Die Arbeit beschreibt ihre Gründung, Entwicklung und den Einfluss wichtiger Mitglieder wie Christian Gueintz und Justus Georg Schottelius auf die Sprachnormierung. Die Bedeutung der Aufnahme von Nicht-Adeligen und das Ende der intensiven Spracharbeit mit dem Tod wichtiger Mitglieder werden hervorgehoben.
Welche Persönlichkeiten werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit stellt wichtige Persönlichkeiten der Spracharbeit im 17. Jahrhundert vor, insbesondere Georg Philipp Harsdörffer und Justus Georg Schottelius. Ihre Beiträge zur Sprachpflege und Sprachnormierung werden im Kontext der Fruchtbringenden Gesellschaft erläutert.
Welche Textstelle wird im Detail analysiert?
Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist die detaillierte Analyse eines Briefwechsels der Fruchtbringenden Gesellschaft (FG) bezüglich der „Frauenzimmer-Gesprächsspiele“. Diese Analyse dient als Beispiel für die damaligen sprachlichen Praktiken und zeigt, wie Metaphern und rhetorische Mittel die Spracharbeit in den Briefen zum Ausdruck bringen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel wie Einleitung, Klärung des Begriffs „Spracharbeit“, Vorstellung wichtiger Persönlichkeiten (insbesondere im Kontext der Fruchtbringenden Gesellschaft), Analyse des Briefwechsels zu den „Frauenzimmer-Gesprächsspielen“ und ein Fazit. Die Kapitel beinhalten detaillierte Erläuterungen zu den jeweiligen Aspekten der Spracharbeit im 17. Jahrhundert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Arbeit prägnant zusammenfassen, sind: Spracharbeit, 17. Jahrhundert, Fruchtbringende Gesellschaft, Georg Philipp Harsdörffer, Justus Georg Schottelius, Sprachpflege, Sprachnormierung, Rhetorik, Metaphern, Deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Sprachphilosophie, Ontologische Motiviertheit, Sprachpatriotismus.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2015, Spracharbeit im 17. Jahrhundert. Briefwechsel zu den "Frauenzimmer-Gesprächsspielen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022624