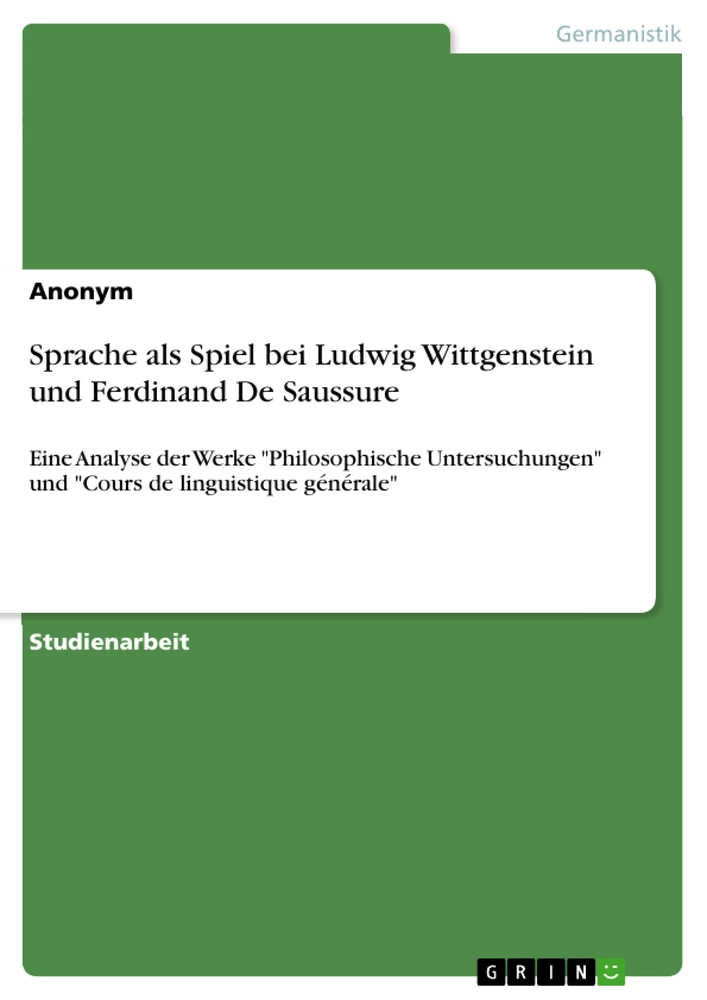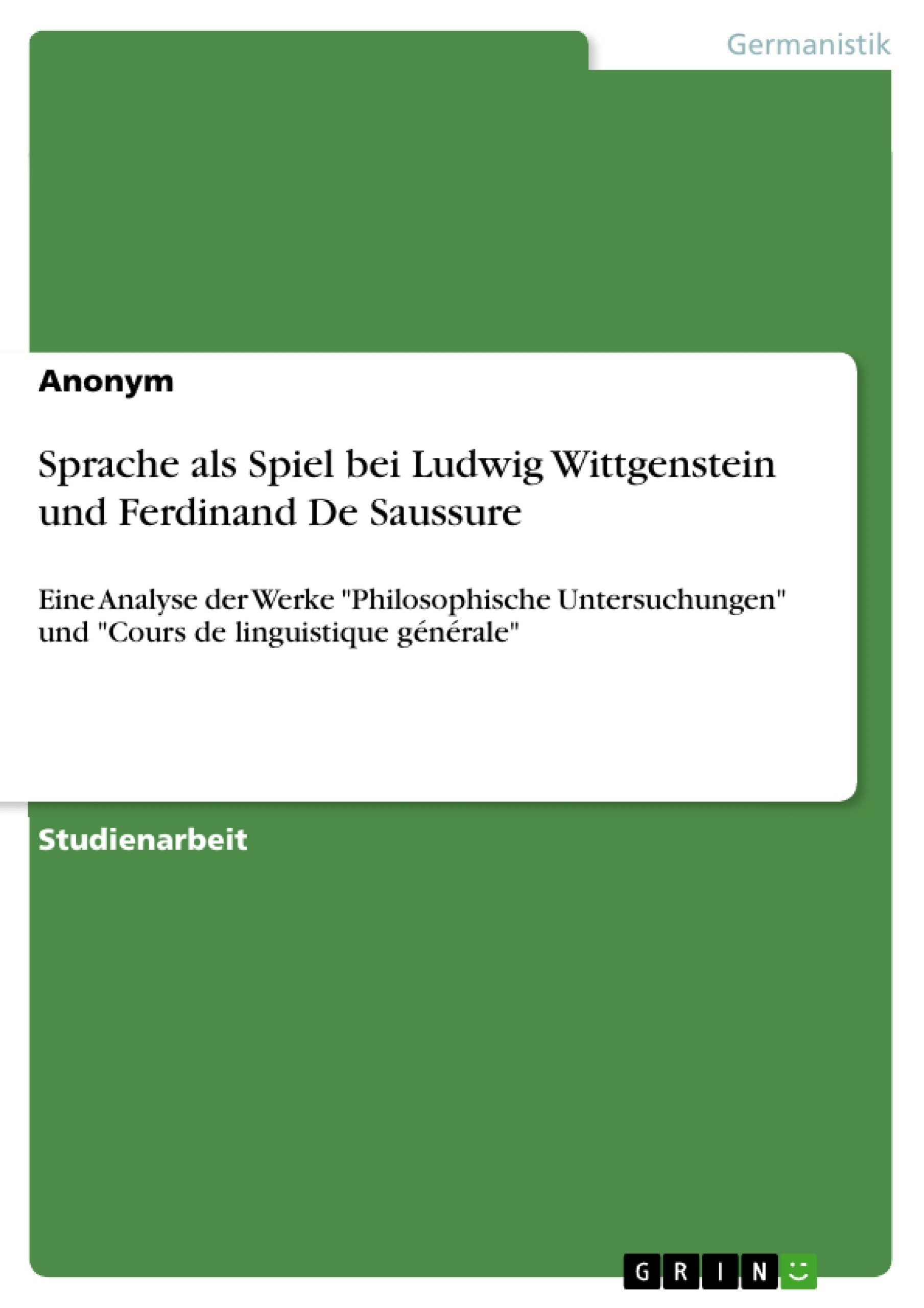In der Seminararbeit sollen die beiden Werke „Philosophische Untersuchungen“ von Wittgenstein und „Cours de linguistique générale“ von Saussure bezüglich der Darstellung der Sprache durch ihre jeweilige Analogie zum Spiel verglichen werden.
Mit Hilfe dieser Spiel-Metapher beleuchten der Philosoph und der Linguist ihre jeweilige Auffassung von Sprache. Während Saussure das System der Sprache untersucht und auf das Spiel, vor allem das Schachspiel, als erklärende Metapher verweist, betrachtet Wittgenstein sein ganzes Werk über sogenannte „Sprachspiele“. Inwiefern die Vergleiche genutzt werden, um die jeweilige Ansicht dessen darzustellen, was Sprache bedeutet, wird im Hauptteil der Arbeit aufgezeigt. Ein wichtiger Unterschied, der dem Verständnis des folgenden Hauptteils dient, ist die unterschiedliche Absicht der Beiden. Wittgenstein betrachtet das Thema aus einem philosophischen Blickwinkel und möchte keine Theorie erstellen. Sein Ziel ist die Beschreibung der Sprache in ihrem alltäglichen Gebrauch. Saussure, als Linguist, stellt eine allgemeine Theorie der Sprache im Sinne eines Zeichensystems auf, die als Semiotik bezeichnet wurde. So ist die Methode, mit der Wittgenstein und Saussure vorgehen, grundsätzlich verschieden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Sprachauffassung Wittgensteins
- Sprachspiele
- Sprachgemeinschaft und Anwendungskontext
- Die Bedeutung der Worte
- Allgemeine Sprachauffassung Saussures
- Sprache als Spiel in den PU von Wittgenstein
- Sprache als Spiel bei Saussure
- Zusammenfassung/Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit vergleicht die Werke Philosophische Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein und Cours de linguistique générale von Ferdinand de Saussure im Hinblick auf ihre Darstellung von Sprache durch die Analogie zum Spiel. Die Arbeit beleuchtet, wie Wittgenstein und Saussure ihre jeweilige Auffassung von Sprache mithilfe der Spielmetapher verdeutlichen.
- Wittgensteins Sprachspiel-Konzept und seine Bedeutung für die alltägliche Sprachverwendung
- Saussures Theorie der Sprache als Zeichensystem und seine Verwendung des Schachspiels als Metapher
- Die unterschiedlichen Ziele und Methoden von Wittgenstein und Saussure bei der Untersuchung von Sprache
- Die Rolle von Sprachgemeinschaften und Anwendungskontexten in Wittgensteins Sprachphilosophie
- Der Zusammenhang zwischen Wortgebrauch und Bedeutung in Wittgensteins Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die beiden Philosophen Ludwig Wittgenstein und Ferdinand de Saussure sowie deren Hauptwerke im Kontext der Philosophie der Sprache vor. Sie erläutert die Wahl der Spielmetapher als Vergleichspunkt für die beiden Ansätze.
- Allgemeine Sprachauffassung Wittgensteins: Dieser Abschnitt beleuchtet Wittgensteins Sprachphilosophie anhand seiner "Sprachspiel"-Theorie. Er untersucht die Bedeutung von Sprachgemeinschaft und Anwendungskontext für die Sprachverwendung sowie den Zusammenhang zwischen Wortgebrauch und Bedeutung.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Sprachspiel, Zeichen, Sprachgemeinschaft, Anwendungskontext, Bedeutung, Semiotik, Sprachphilosophie, Strukturalismus, Wittgensteins Philosophische Untersuchungen, Saussures Cours de linguistique générale.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzen Wittgenstein und Saussure die Spiel-Metapher für die Sprache?
Wittgenstein nutzt „Sprachspiele“, um den Gebrauch der Sprache im Alltag zu beschreiben, während Saussure das Schachspiel als Analogie für das Sprachsystem als Zeichensystem verwendet.
Was ist der Hauptunterschied in der Absicht der beiden Denker?
Wittgenstein verfolgt einen philosophischen Ansatz ohne feste Theorie, um den alltäglichen Gebrauch zu beschreiben. Saussure hingegen entwickelt als Linguist eine allgemeine Theorie (Semiotik).
Was versteht Wittgenstein unter einem „Sprachspiel“?
Es beschreibt die Einheit aus Sprache und den Handlungen, in die sie verwoben ist, wobei die Bedeutung eines Wortes durch seinen Gebrauch in der Praxis entsteht.
Wie definiert Saussure die Sprache als Zeichensystem?
Für Saussure ist Sprache ein strukturiertes System von Zeichen, deren Wert durch ihre Differenz zu anderen Zeichen im System bestimmt wird.
Welche Rolle spielt die Sprachgemeinschaft bei Wittgenstein?
Die Sprachgemeinschaft legt den Anwendungskontext fest; Regeln der Sprache sind soziale Praktiken, die innerhalb einer Gemeinschaft gelernt und angewendet werden.
Warum ist die Methode der beiden grundlegend verschieden?
Wittgenstein arbeitet deskriptiv und kontextbezogen („Philosophische Untersuchungen“), während Saussure strukturalistisch und systemorientiert vorgeht („Cours de linguistique générale“).
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Sprache als Spiel bei Ludwig Wittgenstein und Ferdinand De Saussure, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022628