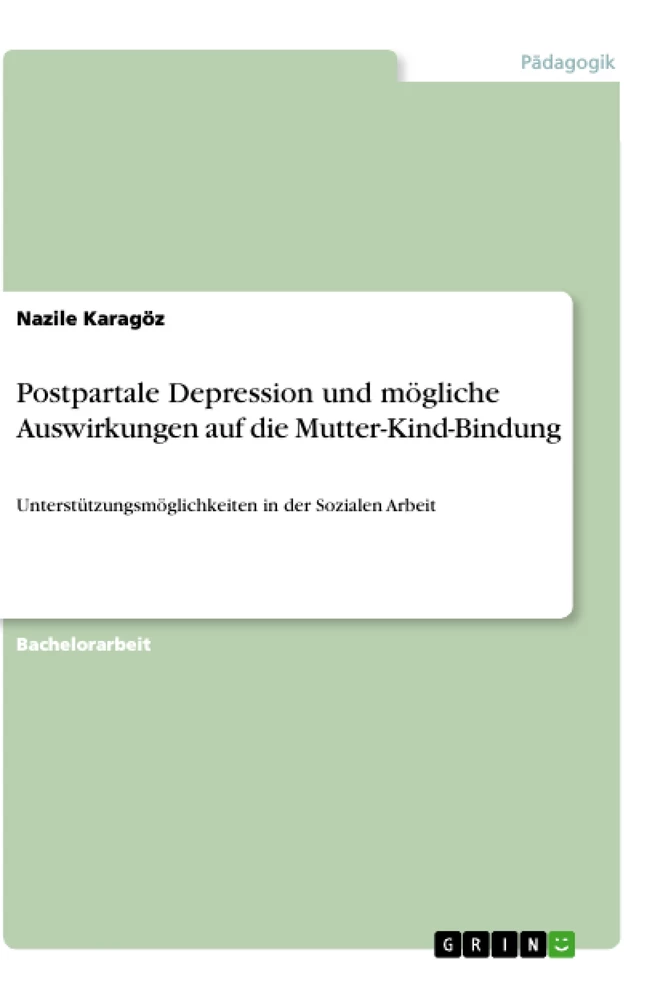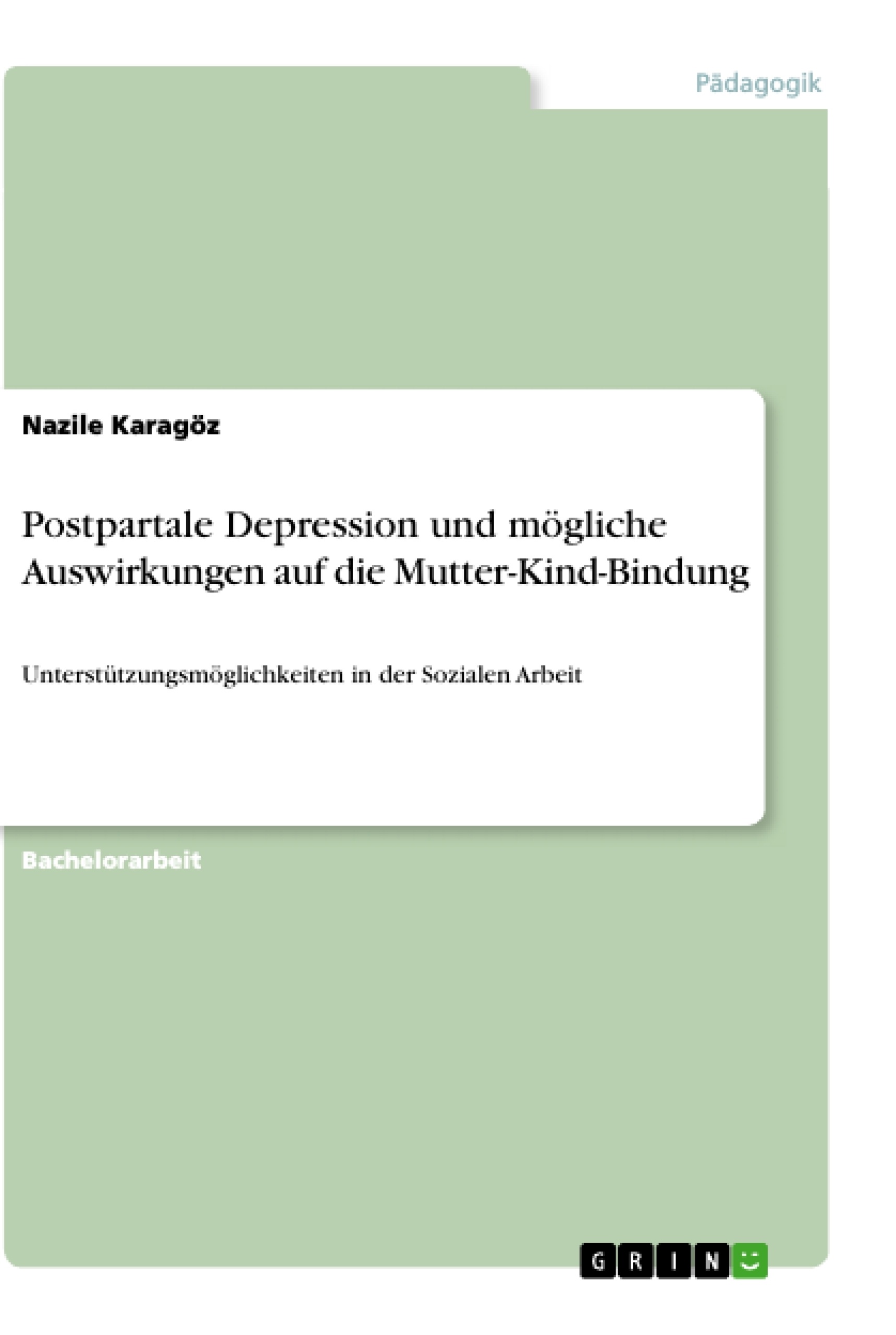Eine Schwangerschaft und Geburt sind besondere Ereignisse im Leben, womit die Entwicklung einer zweiten Identität beginnt. Diese Veränderungsprozesse geschehen auf psychosozialer und biologischer Ebene. Selbstzweifel kommen, wenn die Mutter die in der Gesellschaft vorherrschenden übertriebenen Erwartungen einer „perfekten Mutter“ nicht erfüllen kann. Dadurch bildet sich die erste Grundlage für die Entstehung einer depressiven Erkrankung in der Postpartalzeit.
1 EINLEITUNG
2 POSTPARTALE DEPRESSION
2.1 RISIKOFAKTOREN EINER POSTPARTALEN DEPRESSION
2.2 SYMPTOME EINER POSTPARTALEN DEPRESSION
2.3 PRÄVALENZ UND VERLAUF POSTPARTALER DEPRESSION
3 ABGRENZUNG DER POSTPARTALEN DEPRESSION VON BABY-BLUES UND
POSTPARTALER PSYCHOSE
3.1 ENTWICKLUNG, PRÄVALENZ UND SYMPTOME VON BABY-BLUES
3.2 ENTWICKLUNG, PRÄVALENZ UND SYMPTOME VON DER POSTPARTALEN PSYCHOSE
4 BEDEUTUNG DER BINDUNG FÜR DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG
4.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN
4.2 BINDUNGSTHEORIE
4.3 DAS INNERE ARBEITSMODELL UND DIE MENTALISIERUNGSFÄHIGKEIT
4.4 BINDUNGSMUSTER
4.4.1 Sichere Bindung
4.4.2 Unsicher-vermeidende Bindung
4.4.3 Unsicher-ambivalente Bindung
4.4.4 Desorganisierte Bindung
4.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KINDLICHEN BINDUNGSMUSTERN MIT SPÄTEREN SOZIALEN
BEZIEHUNGSVERHALTEN
5 AUSWIRKUNGEN DER MÜTTERLICHEN POSTPARTALEN DEPRESSION AUF DAS
KIND UND DIE FRÜHE BINDUNG
5.1 INTERAKTIONSVERHALTEN DER POSTPARTAL DEPRESSIVEN MUTTER MIT DEM KIND
5.2 AUSWIRKUNGEN DER POSTPARTALEN DEPRESSION AUF DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG
5.3 INTERAKTIONSVERHALTEN VON KINDERN POSTPARTAL DEPRESSIVER MÜTTER
5.4 ZUSAMMENHANG DES MÜTTERLICHEN INTERAKTIONSVERHALTENS MIT DEM BINDUNGSAUFBAU
6 HILFEMÖGLICHKEITEN FÜR MÜTTER MIT POSTPARTALEN DEPRESSIONEN IN
DER SOZIALEN ARBEIT
6.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN
6.2 BEHANDLUNGSBEDÜRFTIGKEIT DER POSTPARTALEN DEPRESSION
6.3 ,,EPDS" FÜR METHODISCHE FRÜHERKENNUNG VON POSTPARTALEN ERKRANKUNGEN
6.4 RESSOURCENORIENTIERTE SOZIALE ARBEI
6.5 VERSTEHEN PSYCHISCHER VORGÄNGE
6.6 KOOPERATION VON JUGENDHILFE UND PSYCHIATRIE
6.7 ALLGEMEINER SOZIALER DIENST
6.8 PRÄVENTIVE ANGEBOTE FÜR EINEN SICHEREN BINDUNGSAUFBAU
6.8.1 Frühe Hilfen
6.8.2 Schwangerschaftsberatungsstellen
6.8.3 Familienhebammen
6.8.4 Schreibaby-Ambulanz
6.8.5 Bindungsbasierte Hilfen
6.8.7 Modellprojekte
6.9 INTERVENTION
6.9.1 Hilfen zur Erziehung und Kindeswohlgefährdung
6.9.2 Systemische Familientherapie
6.9.3 Traumabehandlung für Säuglinge und Kleinkinder
6.9.4 Stationäre Mutter-Kind-Behandlung
7 SCHLUSS
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 POSTPARTALE DEPRESSION.
- 2.1 RISIKOFAKTOREN EINER POSTPARTALEN DEPRESSION..
- 2.2 SYMPTOME EINER POSTPARTALEN DEPRESSION.
- 2.3 PRÄVALENZ UND VERLAUF POSTPARTALER DEPRESSION.
- 3 ABGRENZUNG DER POSTPARTALEN DEPRESSION VON BABY-BLUES UND POSTPARTALER PSYCHOSE............
- 3.1 ENTWICKLUNG, PRÄVALENZ UND SYMPTOME VON BABY-BLUES.
- 3.2 ENTWICKLUNG, PRÄVALENZ UND SYMPTOME VON DER POSTPARTALEN PSYCHOSE.
- 4 BEDEUTUNG DER BINDUNG FÜR DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG.
- 4.1 BEGRIFFSDEFINITIONEN.
- 4.2 BINDUNGSTHEORIE.
- 4.3 DAS INNERE ARBEITSMODELL UND DIE MENTALISIERUNGSFÄHIGKEIT
- 4.4 BINDUNGSMUSTER..
- 4.4.1 Sichere Bindung
- 4.4.2 Unsicher-vermeidende Bindung.
- 4.4.3 Unsicher-ambivalente Bindung..
- 4.4.4 Desorganisierte Bindung...
- 4.5 ZUSAMMENHANG ZWISCHEN KINDLICHEN BINDUNGSMUSTERN MIT SPÄTEREN SOZIALEN BEZIEHUNGSVERHALTEN
- 5 AUSWIRKUNGEN DER MÜTTERLICHEN POSTPARTALEN DEPRESSION AUF DAS KIND UND DIE FRÜHE BINDUNG.
- 5.1 INTERAKTIONSVERHALTEN DER POSTPARTAL DEPRESSIVEN MUTTER MIT DEM KIND.
- 5.2 AUSWIRKUNGEN DER POSTPARTALEN DEPRESSION AUF DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG
- 5.3 INTERAKTIONSVERHALTEN VON KINDERN POSTPARTAL DEPRESSIVER MÜTTER
- 5.4 ZUSAMMENHANG DES MÜTTERLICHEN INTERAKTIONSVERHALTENS MIT DEM BINDUNGSAUFBAU
- 6 HILFEMÖGLICHKEITEN FÜR MÜTTER MIT POSTPARTALEN DEPRESSIONEN IN DER SOZIALEN ARBEIT..
- 6.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN
- 6.2 BEHANDLUNGSBEDÜRFTIGKEIT DER POSTPARTALEN DEPRESSION
- 6.3 „EPDS\" FÜR METHODISCHE FRÜHERKENNUNG VON POSTPARTALEN ERKRANKUNGEN
- 6.4 RESSOURCENORIENTIERTE SOZIALE ARBEIT
- 6.5 VERSTEHEN PSYCHISCHER VORGÄNGE.
- 6.6 KOOPERATION VON JUGENDHILFE UND PSYCHIATRIE.
- 6.7 ALLGEMEINER SOZIALER DIENST
- 6.8 PRÄVENTIVE ANGEBOTE FÜR EINEN SICHEREN BINDUNGSAUFBAU
- 6.8.1 Frühe Hilfen...
- 6.8.2 Schwangerschaftsberatungsstellen
- 6.8.3 Familienhebammen.
- 6.8.4 Schreibaby-Ambulanz.
- 6.8.5 Bindungsbasierte Hilfen..
- 6.8.7 Modellprojekte..
- 6.9 INTERVENTION.
- 6.9.1 Hilfen zur Erziehung und Kindeswohlgefährdung
- 6.9.2 Systemische Familientherapie........
- 6.9.3 Traumabehandlung für Säuglinge und Kleinkinder...\n
- 6.9.4 Stationäre Mutter-Kind-Behandlung.
- Die Risikofaktoren und Symptome der PPD
- Die Bedeutung der Bindung für die kindliche Entwicklung
- Die Auswirkungen der PPD auf das Interaktionsverhalten der Mutter und das Kind
- Die Bedeutung von Hilfsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit, die Prävention und Intervention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die postpartale Depression (PPD) und ihre möglichen Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung. Sie betrachtet dabei die Rolle der Sozialen Arbeit in der Unterstützung von Müttern mit PPD.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt die postpartale Depression vor und beleuchtet ihre Risikofaktoren, Symptome und die Prävalenz sowie ihren Verlauf. Kapitel 3 grenzt die postpartale Depression von den anderen beiden postpartalen Erkrankungen, der postpartalen Dysphorie und der postpartalen Psychose, ab.
Kapitel 4 konzentriert sich auf die Bindungstheorie und -forschung. Hierbei werden die verschiedenen Bindungsmuster und ihre Auswirkungen auf das spätere soziale Verhalten des Kindes erläutert. Kapitel 5 untersucht die Auswirkungen der mütterlichen PPD auf das Kind und die frühkindliche Bindung.
Kapitel 6 befasst sich mit den Hilfsmöglichkeiten für Mütter mit PPD in der Sozialen Arbeit. Es werden sowohl präventive Angebote als auch Interventionsmaßnahmen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Postpartale Depression, Mutter-Kind-Bindung, Soziale Arbeit, Risikofaktoren, Symptome, Prävalenz, Bindungstheorie, Interaktionsverhalten, Hilfsmöglichkeiten, Prävention, Intervention.
- Quote paper
- Nazile Karagöz (Author), 2020, Postpartale Depression und mögliche Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Bindung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1022864