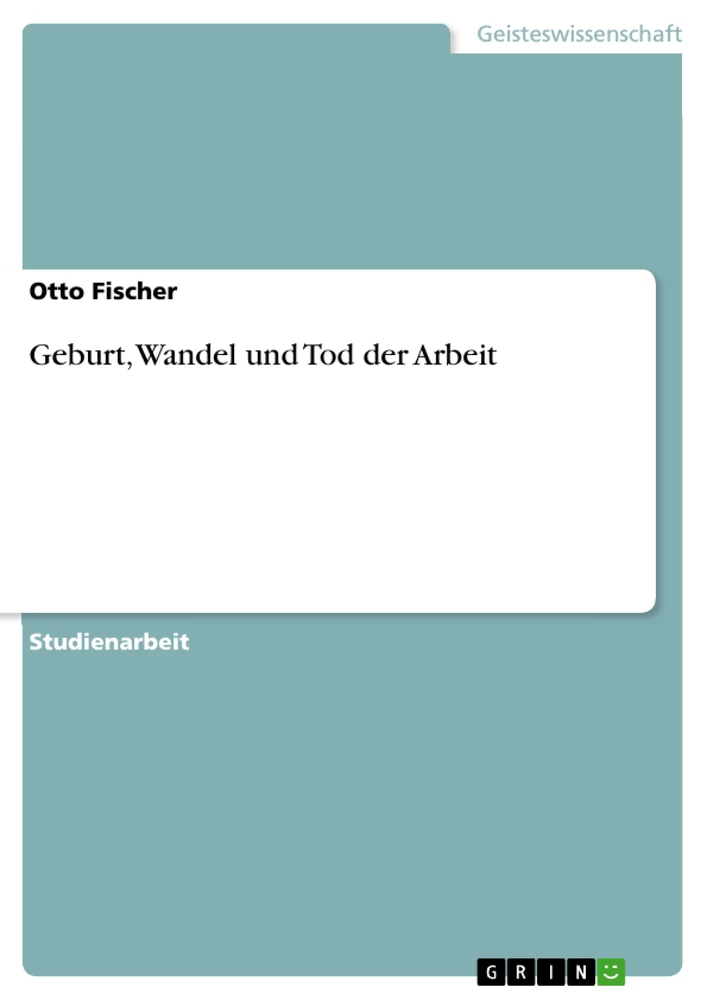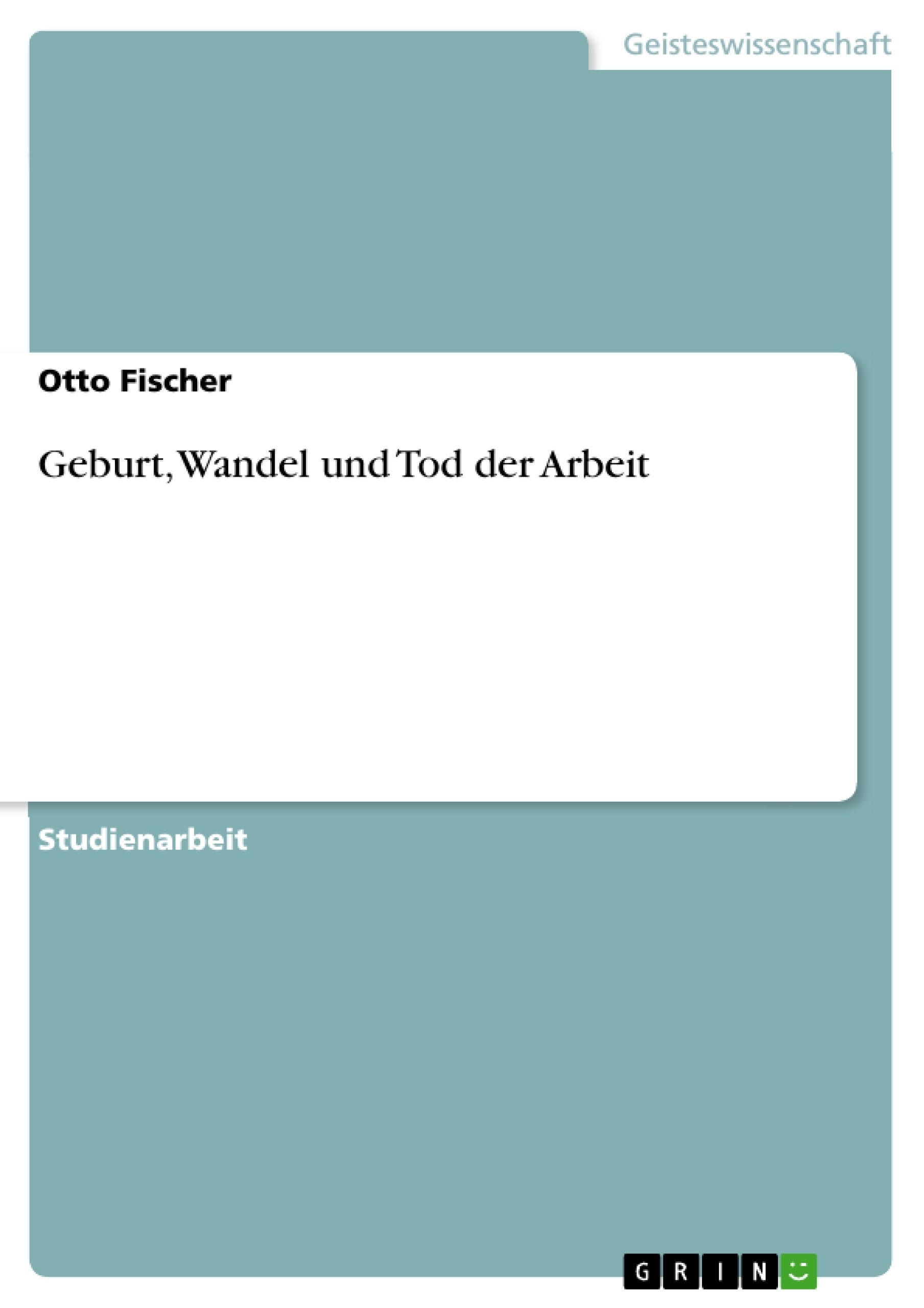Die Geburtsstunde der Arbeit und der Freizeit
Um am Leben zu bleiben, muss ein gewisses System, eine gewisse Ordnung aufrecht erhalten werden. Im Chaos kann kein Leben erblühen. Unser Körper besteht aus einer relativ strengen Ordnung von Zellen, die sich wiederum aus einer speziellen Ordnung von Molekülen zusammensetzt. Um aber Ordnung aufrecht zu erhalten, braucht es eine stetige Energiezufuhr. Jeder kann dies nachvollziehen, wenn er seine eigene Wohnung in Ordnung bringt. Es bedarf eines stetigen Energieaufwands, damit man den Kampf gegen das Chaos gewinnt. Genauso braucht unser Körper kontinuierliche Energiezufuhr, um seine Ordnung, sprich Leben, aufrecht zu erhalten. Hierzu dient der menschliche Stoffwechsel. Nahrung, ein anderes Wort für Energie, wird zugeführt und nach der Verbrennung wieder ausgeschieden. Da uns aber die Brathendeln nicht automatisch in den Mund fliegen, müssen wir dafür etwas tun. Hier liegt meiner Meinung nach die Geburtsstunde von „Arbeit“. Wir müssen etwas tun, um zu leben. Stillstand ist gleich Tod.
Unsere Vorfahren haben sich recht schnell und ausdauernd auf ihren zwei Beinen bewegen müssen, um diesen Stoffwechsel in Gang zu halten. Den ganzen Tag hetzten sie in der Wildnis umher, beschäftigt mit der Suche nach Nahrung, die hauptsächlich aus Fleisch bestand. Jedes Mitglied der kleinen, umherziehenden Gruppe war mit der Nahrungsbeschaffung befaßt. Fiel ein Mitglied dieser Gruppe aus und musste von den anderen Mitgliedern mitversorgt werden, wie zum Beispiel bei Schwangerschaft einer Frau, war dies existenzbedrohend für die ganze Gruppe. Menschliches Leben stand noch auf sehr wackligen Beinen, das bei der kleinsten Erschütterung schon sehr ins Wanken kam. Erst mit dem Ackerbau kam eine gewisse Sicherheit und Stabilität ins Leben der Menschen. Jetzt konnten sich einzelne Mitglieder durch einen sehr bescheidenen Überfluss an Nahrungsmitteln anderen Aufgaben widmen. Diese Entwicklung war auch sicher der Startschuss für nachhaltige Kulturentwicklung. Muss ich mir nicht ständig überlegen, mit was ich mir in den nächsten Stunden den Magen fülle, kann ich Höhlenwände bemalen oder Riten feiern. Es gab freie Zeit. Die Anfänge der Freizeit waren geboren.
Die Wandlung der Arbeit
Einmal aus der eisernen Klammer der täglichen Notwendigkeiten befreit, konnte Arbeit Wandlungen erfahren. Die erste Änderung betraf die Arbeitsteilung. Es musste nicht jeder jeden Tag jagen gehen oder am Feld arbeiten. Verschiedene Personen konnten sich verschiedenen Tätigkeiten widmen.
Sehr schön kann man diese Entwicklung an der antiken Gesellschaftsordnung beobachten, die in Sklaven und freie Menschen zerfiel. Die Sklaven mussten hauptsächlich die sogenannten niedrigen Arbeiten erledigen, die körperlichen Einsatz erforderten. Dazu zählte alles, was das materielle Überleben sichert. Diese Art von Arbeit war in der damaligen Zeit nicht sonderlich angesehen. Ein wirklich freier Mensch widmete seine Zeit der Kunst, der Philosophie und der Wissenschaft. Sein Wirkungskreis war das öffentliche Leben, das im politischen Handeln in seiner Polis mündete. Auch noch heute wird die sogenannte geistige Arbeit höher bewertet als die körperliche.
Im Mittelalter wurde noch eine symbolische Ebene eingezogen. Arbeit gehörte zu der von Gott gewollten Weltordnung. Wenn man ein Gott gefälliges Leben führen wollte, um danach in den Himmel zu kommen, hatte man zu arbeiten. Davon zeugt auch die Benediktinerregel „Ora et labora“, was soviel heißt wie „Bete und arbeite“. Verschärft wurde dieser Grundsatz noch einmal bei den Zisterziensern, wo der Spruch umgewandelt wurde in „Ora est labora“, was soviel bedeutet wie „Arbeit ist gleich Gebet“. Die Arbeit wurde also zum Gebet erhoben. Müßiggang war ihrem Glauben nach der Feind der Seele - Teufelswerk.
Doch bei dieser Arbeit durfte man nicht allzu reich werden, daeher ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt, als ein Reicher in den Himmel, wie wir in der Bibel nachlesen können. Darum schenkten damals die Reichen ihr Vermögen knapp bevor sie starben der Kirche. Ihr „Stein“ gewordenes schlechtes Gewissen können wir heute in so manchem Kirchenbau bewundern. Also, Arbeit diente damals schon nicht mehr nur der Reproduktion der Lebensgrundlagen, sondern so abstrakten Zielen wie Himmel und Gott.
Diese „göttliche“ Einstellung zu Arbeit hat sich noch bis in unsere Zeit hinüber retten können. Von älteren Menschen kann man heute noch Sprüche hören wie „Wenn man nichts arbeitet, stiehlt man dem Herrgott den Tag“.
Doch schon am Beginn der Neuzeit erfuhr Arbeit eine weitere Wandlung hin zum Profanen. Man arbeitete nicht mehr „um Himmels willen“, sondern um sich persönlich zu bereichern. Sehr schön, glaube ich, kann man dies im Theaterstück „Jedermann“ von Hugo von Hoffsmannsthal nachvollziehen. Der Hauptprotagonist kümmert sich nicht mehr um Freundschaft, Barmherzigkeit, Familie und Gott. Das einzige, was ihn interessiert, ist Geld und das Vergnügen. Erst als der Tod „Jedermann“ ruft, wird ihm bewusst, dass das Leichenhemd keine Taschen hat.
Reichtum und Wohlstand waren auch sicher die Triebfedern für die Innovationen der industriellen Revolution. Menschen und Maschinen werden nur mehr für die Gewinnmaximierung eingesetzt. Der „Homo Ökonomicus“ wurde geboren. Dieser Begriff kommt aus der Wirtschaftstheorie und bedeutet, dass Menschen ausschließlich nach wirtschaftlichen und damit rationellen Gesichtspunkten handeln. Der Mensch soll berechenbar sein. Es geht längst nicht mehr um die Entfaltung des waisen Homo sapiens, sondern nur noch um den Homo ökonomicus, der einfach Arbeiter, Kunde und Verbraucher ist.
Der Tod der Arbeit
Doch wie ist es heute? Hecheln wir immer noch kilometerweit jedem Bissen nach, wie unsere Urahnen in der Savanne? Bei weitem nicht. Ein Grossteil unserer Arbeit, die wir uns antun, ist nicht mehr für unser unmittelbares (Über)Leben notwendig. Das erste Mal in der Geschichte der Menschheit könnten wir mit einem minimalen Aufwand unsere Lebensbedürfnisse decken. Die Zahlen der letzten hundert Jahre sprechen hier eine deutliche Sprache. Waren noch um 1900 zirka Zweidrittel der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig, produzieren heute drei oder vier Prozent der Bevölkerung die benötigte Nahrung.
Doch da sich auch unsere Ansprüche dramatisch gestiegen sind, müssen die Menschen noch immer ein ganzes Stück des Tages arbeiten. Angeheizt werden diese Bedürfnisse noch durch strategischen Einsatz von Werbung, vermittelt über die Massenmedien. Diese versucht permanent, uns zum Kauf von Dingen zu überreden, die wir im Grunde gar nicht brauchen würden. Modernes Marketing ist der Stachel in unserem Fleisch, der uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Doch kann man diese Arbeit für nicht lebensnotwendige Dinge im ursprünglichen Sinn noch als Arbeit bezeichnen? Oder ist heute Arbeit, um es ein wenig spöttisch zu formulieren, nur mehr Müßiggang mit ernster Miene? Schon die Sprache der Politiker ist verräterisch und entlarvt einiges. Sie sprechen nicht mehr von Arbeitspolitik, sondern von Beschäftigungspolitik. Beschäftigung hat den Anflug des Zeitvertreibes. Das ist nicht mehr die Arbeit, wo es um das harte Überleben geht. Beschäftigen kann ich mich mit allerlei, mal mit diesem, mal mit jenem, ohne dass mich der existenzielle Druck dazu zwingt.
Heutzutage wird Arbeit zum Selbstzweck erhoben. Menschen ziehen in unserer Zeit ganz anderen Nutzen aus ihrer Arbeit wie in vergangenen Tagen. Dieser Nutzen liegt auf psychologischer Ebene. Aus ihrer Arbeit schöpfen sie ihr Selbstwertgefühl und ihr soziales Prestige. Ist man ohne Arbeit, fehlt die gesellschaftliche Anerkennung. Welchen Stellenwert Arbeit in unserer Gesellschaft hat, kann man an diversen Talkshows ablesen. Das Muster ist immer das gleiche. Meistens sitzen ein bis zwei heruntergekommene Arbeitslose auf der Anklagebank, denen latent bis ganz offen mit viel Emotion und Aggression von der Mehrheit vorgeworfen wird, sie seien zu nichts nutze - sie seien Sozialschmarotzer, die nichts für die Gesellschaft leisten - sie kümmerten sich nicht um Arbeit - usw.. Hier wird von der Gesellschaft massiv Druck auf Menschen ausgeübt, die Arbeitsmoral hochzuhalten, obwohl es in dieser Intensität wahrscheinlich gar nicht nötig wäre.
Doch wie wird die Zukunft der Arbeitswelt aussehen? Aus der Geschichte können wir erkennen, dass zuerst die Landwirtschaft und danach die Industrie immer weniger Menschen benötigte. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft die Industrie genauso viel Leute beschäftigen wird, wie heute in der Landwirtschaft, nämlich drei bis vier Prozent. Doch was sollen diese freigesetzten Menschen tun? Der einzige wachsende Sektor in der Arbeitswelt, der diese Menschen aufnehmen kann, ist der Dienstleistungssektor. Doch auch hier hält moderne Technik zwar noch zaghaft, aber doch, Einzug. Die ersten Roboter bringen zum Beispiel in Spitälern schon das Essen. Es wird zwar geraume Zeit dauern, bis auch in diesem Bereich moderne Technik voll durchschlägt. Aber, ich denke, sie wird sich durchschlagen.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Die Geburtsstunde der Arbeit und der Freizeit"?
Der Text untersucht die Entstehung und Wandlung der Arbeit im Laufe der Menschheitsgeschichte. Er beginnt mit der Notwendigkeit von Arbeit zum Überleben, die sich aus der Notwendigkeit der Energieaufnahme ergibt, und verfolgt ihre Entwicklung von der Nahrungssuche in der Urzeit bis zu modernen Vorstellungen von Beschäftigung und Selbstverwirklichung.
Wie beschreibt der Text die Entstehung von Arbeit?
Der Text argumentiert, dass Arbeit ihren Ursprung in der Notwendigkeit hat, Energie zu gewinnen, um das Leben aufrechtzuerhalten. Unsere Vorfahren mussten sich ständig auf die Suche nach Nahrung begeben, und diese Tätigkeit wird als die Geburtsstunde der Arbeit betrachtet. Stillstand wird gleichbedeutend mit Tod gesehen.
Was war die Rolle des Ackerbaus in der Entwicklung der Arbeit und Freizeit?
Mit dem Ackerbau kam eine gewisse Sicherheit und Stabilität ins Leben der Menschen. Der Überschuss an Nahrungsmitteln ermöglichte es einigen, sich anderen Aufgaben als der reinen Nahrungssicherung zu widmen. Dies führte zur Entstehung von Freizeit und begünstigte kulturelle Entwicklungen wie Höhlenmalerei und Rituale.
Wie hat sich die Arbeit im Laufe der Zeit verändert?
Die Arbeit erfuhr im Laufe der Zeit mehrere Wandlungen, beginnend mit der Arbeitsteilung. In der Antike teilte sich die Gesellschaft in Sklaven, die körperliche Arbeit verrichteten, und freie Menschen, die sich der Kunst, Philosophie und Politik widmeten. Im Mittelalter wurde Arbeit als Teil der göttlichen Ordnung betrachtet und als Weg zur Erlösung angesehen. In der Neuzeit verlagerte sich der Fokus auf persönliche Bereicherung und Gewinnmaximierung, was zur Entstehung des "Homo Ökonomicus" führte.
Was ist der "Homo Ökonomicus"?
Der "Homo Ökonomicus" ist ein Begriff aus der Wirtschaftstheorie, der einen Menschen beschreibt, der ausschließlich nach wirtschaftlichen und rationalen Gesichtspunkten handelt. Dieser Mensch soll berechenbar sein und wird hauptsächlich als Arbeiter, Kunde und Verbraucher betrachtet.
Was meint der Text mit dem "Tod der Arbeit"?
Der Text argumentiert, dass ein Großteil der heutigen Arbeit nicht mehr für das unmittelbare Überleben notwendig ist. Dank technologischer Fortschritte und gesteigerter Ansprüche arbeiten die Menschen jedoch immer noch lange, oft an Dingen, die sie eigentlich nicht brauchen. Der Text deutet an, dass moderne "Arbeit" manchmal nur "Müßiggang mit ernster Miene" sein könnte und dass der Begriff "Arbeitspolitik" durch "Beschäftigungspolitik" ersetzt wurde.
Welchen Stellenwert hat Arbeit in der heutigen Gesellschaft?
Heutzutage wird Arbeit oft zum Selbstzweck erhoben. Menschen ziehen psychologischen Nutzen aus ihrer Arbeit, wie Selbstwertgefühl und soziales Prestige. Arbeitslosigkeit wird gesellschaftlich stigmatisiert und mit Vorwürfen der Nutzlosigkeit und des Sozialschmarotzertums verbunden.
Wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus?
Der Text prognostiziert, dass immer weniger Menschen in der Landwirtschaft und Industrie benötigt werden. Der Dienstleistungssektor könnte diese freigesetzten Menschen aufnehmen, aber auch hier hält die moderne Technik Einzug. Obwohl menschliche Wärme in sozialen Berufen wichtig bleibt, stellt sich die Frage, ob diese am Arbeitsmarkt gehandelt werden kann.
Welche Frage bleibt am Ende des Textes offen?
Am Ende bleibt die Frage offen, wohin die stetigen Veränderungen in der Arbeitswelt führen werden. Die Entwicklungen liegen im Nebel der Zukunft und sind schwer vorherzusagen.
- Citation du texte
- Otto Fischer (Auteur), 2001, Geburt, Wandel und Tod der Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102311