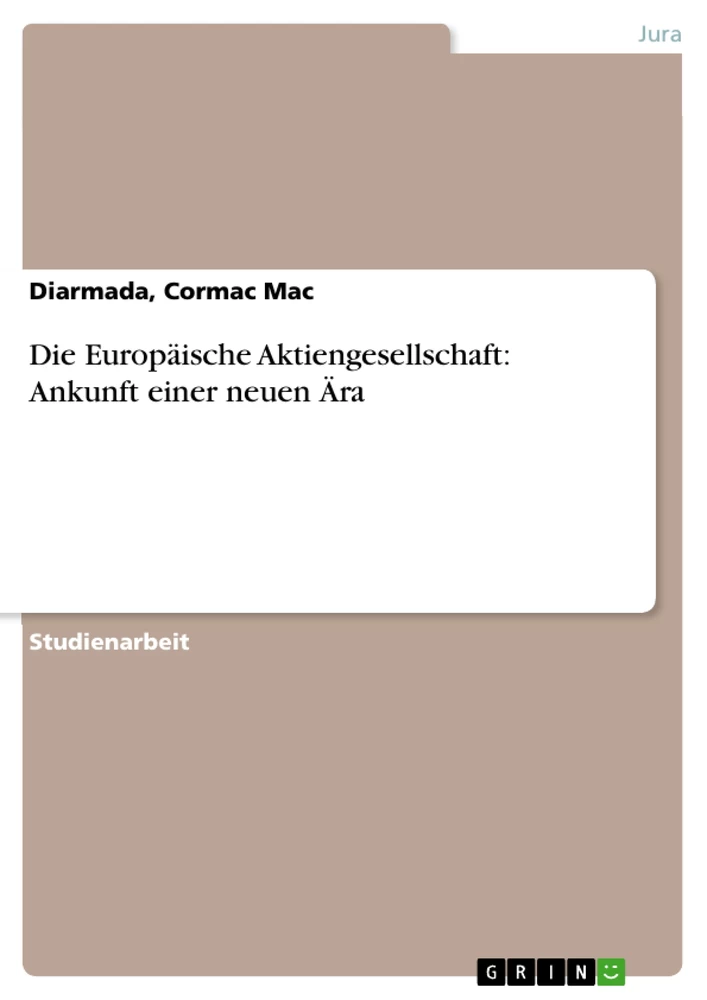Gliederung:
1: Einleitung
1.1 Was für eine Gesellschaft is die S.E.?
1.2 Vorteile?
1.3 Nachteile?
1.4 Jetztiger Stand
2: Vorgeschichte
2.1 Thibièrge und Sanders
2.2 Kommission- Denkschrift
3: Entwürfe
3.1 Entwurf von 1970
3.2 Entwurf von 1975
3.3 Entwurf von 1989
3.3.1 Geänderte Rechtsgrunglage
3.3.2 Teilung in einer Verordnung und einer Richtlinie
3.3.3 Kürzung in der Verordnung
3.3.3.1 Verweisung auf nationales Recht
3.3.3.2 Verweisung auf harmonisiertes europäisches Recht
3.3.3.3 Unmittelbare Verweisung auf Richtlinien
3.3.4 Gründungsmechanismen
3.3.5 Organisation
3.3.5.1 Monastisches System
3.3.5.2 Dualistisches System
3.3.6 Mitbestimmung
3.3.7 Zusammenfassung
3.4 Entwurf von 1991
3.4.1 Rechtsgrundlagen
3.4.2 Organisation
3.4.3 Sitzverlegung
3.4.4 Verweisung auf nationales Recht
3.4.5 Gründungsmechanismen
3.4.6 Mitbestimmung
3.4.7 Haftung
3.4.8 Zusammenfassung
3.5 Entwurf von 2000
3.5.1 Einführung
3.5.2 Mitbestimmung
3.5.2.1 Mitbestimmung in einer Holding-SE
3.5.2.2 Mitbestimmung in einer Verschmelzungs-SE
4: Resumé
4.1 Zusammenfassung
4.2 Ist die S.E. überhaupt Wünschenswert?
1 1.1 Von der Societas Europeae oder Europ ä ischen Aktiengesellschaft (ferner SE genannt) wird seit Jahrzehnten gesprochen, aber was für ein Wesen ist diese Gesellschaft? Sie soll eine grenzenüberschreitende, in mehreren Ländern der Europäischen Union tätige, auf ein einheitliches europäisches Recht basierende und auf Aktien gebildete Gesellschaft sein, welche die Entwicklung des Europäischen Binnenmarkts zur Vollendung bringt.
1.2 Dadurch wird ermöglicht, daß Gesellschaften, die in bis zu fünfzehn Mitgliedsstaaten durch ein Netz von Tochter- und Holdinggesellschaften aktiv sind, eine einzige Europäische Gesellschaft gründen können, deren Vorteile nicht unerheblich sein werden. Erstens, muß nur ein Rechtssystem, anstelle von fünfzehn berücksichtigt werden. Das führt zu erheblichen Kosteneinsparungen1 und vermindert die Leistungsschwäche, die so ein System mit seinen zusätzlichen Management-Ebenen mit sich bringt. Außerdem wird es europäischen Aktiengesellschaften besser ermöglicht, gegen US Großkonzerne zu konkurrieren. Obwohl es ja schon möglich ist, eine Verschmelzung von Gesellschaften aus verschiedenen EU Länder zu vollziehen, oder für eine Gesellschaft ihren Sitz in einen anderen Mitgliedstaat zu verlegen, würden solche Maßnahmen viel leichter und kostengünstiger durch den Mechanismus einer SE erreicht.
1.3 Utopisch gesehen ist die Idee der SE eine perfekte Lösung für viele Probleme, die die EU immer noch plagen. Leider waren die Mitgliedstaaten, insbesondere das Vereinigte Königreich und Deutschland, nicht bereit, ihre Autorität schlichtweg an Europa abzutreten. Über Jahre hinweg wurde das Statut zur SE vielfach geschwächt und heute bleibt uns nur ein unübersichtlicher, unsicherer, viel auf nationales Recht verweisender Kern übrig2.
1.4 Am 20. Dezember 2000, hat der EU-Ministerrat sich nach über dreißig jährenigen Diskussion politisch geeinigt. Die SE soll endlich Wirklichkeit werden. Die Zusage des Europäischen Parlaments ist notwendig. Ab 2004 wird die Möglichkeit bestehen, SEs zu gründen.
2 2.1 Der erste Anstoß zur SE kam bekanntlich 1959, als Thibièrge, ein französischer Notar, eine soci é t é par actions de type europ é en vorschlug. Kurz danach nahm Pieter Sanders als Thema seiner Antrittsvorlesung an der Universität Rotterdam, „ Auf dem Weg zu einer europ ä ischen Aktiengesellschaft “.3 Als er zum Gutachter für die SE von der EWG-Kommission ernannt wurde, begann diese sich mit der Frage einer Europäischen Aktiengesellschaft zu beschäftigen.
2.2 1966 veröffentlichte die Kommission ihre ersten Gedanken zu diesem Thema in ihrer: „ Denkschrift der Kommission der Europ ä ischen Wirtschaftsgemeinschaft ü ber die Schaffung einer europ ä ischen Handelsgesellschaft “.4
3 3.1 „Die SE soll[te]... als feste Insel europäischen Rechts im Wasser der sie umgebenden nationalen Rechte schwimmen...“, so schrieb Prof. Lutter vom Verordnungsvorschlag, der 1970 von der Kommission veröffentlicht wurde5. Es wurde damals vorgesehen, daß ein einheitliches europäisches Recht geschaffen wird, was auf erheblichen Wiederstand innerhalb der Mitgliedstaaten stieß. Die Verordung von 1970, sowie die von 1975, strebte das utopische Ziel an, das ganze Gebiet zu regeln, inklusive von Grundsätzen, Gründung, Struktur, Beschlußfassung, Auflösung der SE, Konzern-, Rechnungslegungs-, Betriebverfassungs-, Steuer-, und Mitbestimmungsrecht. Seit dem 1989 Entwurf hat die Kommission dies endlich aufgeben und versucht seitdem nur die realistischen Gebiete unter einem Hut zu bringen. Diese Verordnung wurde auf Art. 235 EWGV gestützt: problematisch, weil eine absolute Mehrheit gebraucht wird, um solche Art. 235 Verordungen von dem Europäischen Rat verabschieden zu können. Der Rat konnte sich nicht über bestimmte Aspekte der Verordnung einigen. Vor allem:
- Ein dualistisches Verwaltungssystem für die Aktiengesellschaft wurde vorgesehen, d.h. ein System mit Vorstand und Aufsichtsrat. Mitgliedsstaaten mit monastischen Systeme reagierten negativ darauf und der Vorschlag wurde begraben.
- Ein Konzernrecht, das im Ausland zu erheblichen Störungen führen sollte, werde auch nicht gerade vom Rat begrüßt. Beziehungen zu außereuropäischen Staaten blieben weiterhin ökonomisch zu wichtig dafür.
- Es gab große Probleme mit der Frage der Mitbestimmung von Arbeitnehmern, was der Fall bis letzes Jahr gewesen ist. In den verschieden Mitgliedstaaten gibt es grobgesagt drei verschiedene Modelle der Arbeitnehmermitbestimmung, das Deutsche, das Französische und das Englische.6 Kein Mitgliedstaat wollte sich von seinem Modell verabschieden.
- Es gab viele ungeklärte steuerrechtliche Fragen.
Das Europäische Parlament hat dann Stellung zu dem Entwurf genommen und viele Änderungen vorgeschlagen. Am wichtigsten darunter war der Vorschlag eines Drei-Bänke-Modells für die Mitbestimmungsfrage. Die Kommission hat diesen Vorschlag in ihrem Entwurf von 1975 aufgenommen.
3.2 Die wichtigste Neuheit, die in dem Entwurf von 1975 verfaßt wurde war, wie oben erwähnt, das Drei-Bänke-Modell der Mitbestimmung. Dabei handelt es sich darum, daß die SEs ein Modell haben, das dem deutschen angeglichen wird, d.h. mit Aufsichtsorgan, in dem Vertreter der Arbeitnehmer anwesend sind. Demnach würde die „Dritte Bank“ die Mitbestimmung der Arbeitnehmer ermöglichen. Der Entwurf fiel beim Rat auf unfruchtbaren Boden und bis 1988 wurde nichts weiteres unternommen.
3.3 Mit dem Entwurf von 1989 kam der größte Durchbruch bezüglich strukturrechtlichen Regelungen. Da ihr Entwurf jahrelang beim Rat geblieben sei und hoffnungslos aussah, entschied sich die Kommission, wieder Frage anzugreifen. Zu diesem Zweck entwickelte diese einen völlig und radikal neuen Entwurf. Als wichtigen Unterschied läßt sich die Verlegung von der Rechtsgrundlage der Verordnung von Art. 235 zu Art. 100a EWGV wohl erkennen. Unerwartet war auch, daß die Verordung in einer Verordnung und einer Richtlinie geteilt wurde. Die auf Art. 54 Abs. 3 lit. g gestützte Richtline sollte die Frage der Mitbestimmung weiterhin regeln. Auch von erheblicher Wichtigkeit ist die Tatsache, daß hier vielfach auf nationales und schon- implementiertes Europarecht angewiesen ist.
3.3.1 Warum ist die Rechtsgrundlage geändert worden? Art. 235 EWGV ist diese Rechtsgrundlage, die am besten paßt. Das hat die Kommission schon 1970 bemerkt. Eindeutig liegt diese abrupte Richtungsänderung an der Tatsache, daß eine absolute Mehrheit im Ministerrat gebraucht wird, um Verordungen, die auf diese Grundlage gestützt sind, zu verabschieden. Anderseits braucht man nur eine qualifizierte Mehrheit um gemäß Art. 100a Verordnungen in Kraft zu setzen. So hoffte die Kommission, die Schwierigkeiten, die bisher ein Kompromiß unmöglich gemacht hatten, zu überwinden. So leicht geht es aber nicht. Es gibt Probleme mit der Wahl vom Art. 100a als Rechtsgrundlage:
- Als oberste Schwierigkeit ist die Tatsache, daß Art. 100a als Mittel der Rechtsangleichung zur Verfügung steht. Hier wird kein Recht angeglichen, sondern neues, supranationales Recht geschaffen. Darf konsequent Art. 100a überhaupt für so einen Zweck benutzt werden? Anscheinend auch laut vieler Kommentatoren nicht.7
- Nach Art. 100a Abs. 2, dürfen keine steuerrechtlichen und arbeitnehmerschutzrechlichen Maßnahmen unter diesen Artikel geregelt werden. Aber gerade das ist passiert. Unter Art. 133 des 1989 Entwurfes findet man eine steuerrechtliche Vorschrift, die die SE zuläßt, Verluste im Ausland mit Gewinnen im Sitzstaat der SE zu verrechnen.
Wie soll man das alles in Einklang bringen? Die House of Lords Select Committee on the European Communities erklärte die Rechtsgrundlage erstaunlicherweise für rechtsgemäß. Das Europäische Parlament hat die Rechtsmäßigkeit der Grundlage auch zugestimmt, was einen Verfassungskonflikt in der Gemeinschaft vermeiden könnte.
3.3.2 Die Teilung der Verordnung in einer Verordnung und einer Richtlinie hat auch viele überrascht. Nun sollte die Mitbestimmungsfrage in einer gesonderten Richtlinie statt in der Verordung selbst geregelt werden. Diese Richtlinie wurder ferner auf Art. 54 Abs. 3 lit. g EWGV gestützt. Hier gibt es auch Probleme:
- Vorgedacht unter Art. 54 Abs. 3 lit. g ist die Koordinierung und Harmonisierung von Bestimmungen über nationale Gesellschaften, nicht Supra-Nationale. Wie im Art. 100 a, führt es zu Schwierigkeiten.
- Unter diesem Artikel werden „ Dritte “ geschützt. Arbeitnehmer sind keine Dritte im Sinne dieses Artikels.
Wie konnte die Kommission solche Betrachtungen bloß übersehen? Zur Aufspaltung der Verordnung selber hat die Kommission die Ergänzung des Gesellschaftsrechts, die durch die SE folgen soll, als eine „ untrennbare Erg ä nzung “ bezeichnet. Aber die Verordnung ist getrennt worden. Die Richtlinie ist deswegen unerlaubt. Ferner ist diese Aufspaltung ein Mechanismus um das Bedürfnis einer absoluten Mehrheit zu überbrücken. Soll das erlaubt werden? Die Kommission will dadurch das Veto der Mitgliedstaaten unmöglich machen.
3.3.3 Der Entwurf von1989 kam mit weniger als der Hälfte der Artikel von 1975 zurecht. Der Entwurf von 1975 hatte 284 Artikel mit noch 50 in 4 Anhängen, d.h. 334 insgesamt. Im Vergleich dazu kam die Zahl der Artikel in dem Entwurf von 1989 zwischen Verordnung (137 Artikel) und Richtlinie (13 Artikel) auf gerade 150. Diese Kürzung ist durch die vielfachen Verweisung auf nationales und europäisches Recht ermöglicht worden.
3.3.3.1 Laut Art. 7 Abs. 1 der Verordnung sind Rechtsfragen, die in der Verordnung „ nicht ausdr ü cklich gereglt werden “ mit „ dem im Sitzstaat der SE f ü r Aktiengesellschafens geltenden Recht “ zu beantworten. Unter Art. 7 Abs. 1 des 1975 Entwurfs wurden alle Fragen, die sich mit den Gegenständen des Entwurfs befaßten, und die nicht dort geregelt waren, das nationale Recht entzogen. Dadurch verliert die SE ihre rechtliche Einheit. Jetzt werden die wesentlich unterschiedlichen nationalen Regelungen von 15 Mitgliedstaaten in das SE-Recht einbezogen. Noch dazu kommt die ausdrückliche Verweisung in unzähligen Bestimmungen der Verordnung8, daß das Recht der Mitgliedstaat in der die SE ihren Sitz hat, anzuwenden sei. Der Delaware Effekt kommt einem sofort in den Kopf. 9 Das würde zu vielen Problemen führen, wenn viele SE’s ihr Sitz von z.B. Deutschland nach Griechenland verlegen würden.
3.3.3.2 Es wird auch weiterhin auf harmonisiertes europäisches Recht verwiesen. Dadurch werden Teile vom europäischen Gesellschaftsrecht, die schon harmonisiert sind, einbezogen, um der Kommission Zeit zu ersparen. Aber auch hier wird von dem Konzept eines einheitlichen Europäischen Aktiengesellschaft abgewichen.
3.3.3.3 Hier wird nicht nur auf Richtlinien verwiesen, sondern auch auf ihre Vorschriften, die unmittelbar gelten. Hat die Kommission etwa vergessen, daß viele Auswahlmöglichkeiten in den Richtlinien vorliegen? Auf die 4.(Bilanz) und 7.(Konzern) Richtlinien wird unmittelbar verwiesen. Die 4. Richtlinie alleine gibt Gesellschaften mehr als vierzig Auswahlmöglichkeiten. Denn es gibt 15 Mitgliedstaaten, jeder mit seinem eigenen Rechtssystem, werden sich konsequent auch 15 SE-Typen entwickeln.
3.3.4 Nach dem Entwurf von 1989 gab es insgesamt vier Wege einer SE zu gründen.
- Durch die Verschmelzung von zwei Aktiengesellschaften in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten. Nur Aktiengesellschaften konnten sich diese Möglichkeit zunutze machen.
- Durch die Gründung einer Holding-SE, die zwei Aktiengesellschaften verschiedener Nationalitäten verwaltet.
- Durch die Gründung einer Tochtergesellschaft-SE. Anders als in den anderen Möglichkeiten war dieser Weg für alle Gesellschaften des privaten oder öffentlichen Recht offen.
- Eine bereits betstehende SE konnte eine Tochter-SE gründen.
3.3.5 Es wurde der SE die Entscheidsung freigelassen, ob diese eine monistisches oder ein dualistisches Unternehmensleitungssystem einführen wollte. Dadurch hoffte die Kommission, alle Mitgliedstaaten gerecht zu werden.
3.3.5.1 Unter dem monistischen System, wird das Verwaltungsorgan (Verwaltungsrat) die SE verwalten und nach außen hin vertreten. Zur Kontrolle soll das geschäftsleitende Ratsmitglied verantwortlich sein.
3.3.5.2 Ein dualistisches System, wie der Name andeutet, besteht aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat); der Aufsichtsrat kontrolliert den Vorstand.
3.3.6 Die Frage der Mitbestimmung war immer eine sehr umstrittene. Der Entwurf von 1975 ist letztendlich im wesentlichen an dieser Frage gescheitert. 1989 führte die Kommission drei Mitbestimmungsmodelle ein, von denen eine SE eins selber auswählen konnte, insoweit als dieses Modell in dem Sitzstaat schon erlaubt war. Die drei verschiedenen Mitbestimmungsarten (die Deutsche/Niederländische, die Französische und die Englische), die innerhalb der (damaligen) EG existierten, wurden hier eingeführt.
- Das erste Modell (Deutsch-Niederländische) ermöglicht die Arbeitnehmermitbestimmung durch das Aufsichtsorgan, denn ein Teil von dem Organ muß immer aus Arbeitnehmern bestehen. Nach diesem Modell, brauchen Leitungsorgane die Zustimmung des Aufsichtsorgans für viele Beschlüsse, gemäß Art. 72 Abs. 1 der SE-Verordnung. Deswegen ist dieses Modell am stärksten durch Arbeitnehmerschutz geprägt.
- Das zweite Modell (Französisch-Belgisch) sah vor, daß ein abgesondertes Arbeitnehmervertreterorgan unterhalb des Leitungsorgans existieren sollte. Hier wurde keine Zustimmung gemäß Art. 72 Abs. 1 vorgesehen.
- Das sogenannte Tarifmodell der anglo-sächsischen Länder besteht aus ausgehandelte Vereinbarungen zwischen den Gewerkschaften (Arbeitnehmern) und der Unternehmensleitung. Auch hier wurde keine Zustimmung gemäß Art. 72 Abs. 1 gebraucht. Von den drei Möglichkeiten war diese die schwächste auf der Seite des Arbeitnehmerschutzes.
3.3.7 Nach diesem Entwurf konnte von einem neuen europäischen Aktiengesellschaftsrecht nicht mehr die Rede sein. Was hier passiert ist, war ein Versuch von der Seite der Kommission ein unfruchtbarer Vorschlag zu erwecken. Aber ist sie dabei zu weit geraten? Man kann kaum mehr von der Schaffung einer SE reden, vielmehr von der Schaffung von „ 12 oder 24 oder 48 verschiedene SEs “10 In dem Versuch, die Idee einer SE den Mitgliedstaaten akzeptabel zu machen, hat die Kommission auf zuviel erforderliches verzichtet.
3.4 Die Verdünnung des SE-Statuts wurde 1991 weiter getrieben. Jetzt wurde noch stärker auf nationales Recht verwiesen, aber es wurden auch revolutionäre Vorschriften, wie etwa die Sitzverlegung ohne Auflösung eingebracht. Die Möglichkeit für GmbH Firmen eine SE zu gründen, wurden auch erweitert.
3.4.1 Die Rechtsgrundlagen blieben trotz viel Streit , meistens in den akademischen Kreisen Art. 100a und Art. 54 EWGV. Noch mehr Artikel wurden gestrichen und es blieben nur 108. Z.B.: 1989 konnte eine juristische Person gemäß Art. 69 Abs. 1 Mitglied eines Verwaltungsorgan sein. Später war das nur möglich, wenn das nationale Recht es erlaubte.
3.4.2 Ob ein monistisches oder ein dualistisches Verwaltungssystem existieren soll, wurde hier auch neu geregelt. Es blieb die Wahl zwischen den zwei Möglichkeiten, aber diesmal konnte der Staat und nicht die SE ein System bevorzugen. Es bleibt dem Staat offen entweder eins oder beide Systeme, der in ihrem Rechtsbereich ansässigen SE zur Verfügung zu stellen. Das wird den Delaware Effekt innerhalb der Gemeinschaft nur verstärken und ist als Weiterentwicklung nicht gerade zu befürworten.
3.4.3 Die Möglichkeit, den Sitz einer SE in einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen, ohne daß eine Auflösung und eine Neugründung erforderlich wären ist ein gewagter Schritt. Zwar ist es ein völlig neues Konzept aber ganz ohne Nachteile ist es auch nicht. Hier steht auch der Delaware Effekt im Frage. Früher, wenn eine Gesellschaft sich in einen anderen Staat verlegen wollte, mußte sie sich zuerst auflösen und danach neu gründen, was zu erheblichen Kosten und Zeitverschwendung führte. Danach kam die Neugründung. Ob viele SEs diese Vorschrift überhaupt nutzen werden ist auch fraglich. Eine Verlegung in einen Staat mit völlig anderen Regelungen braucht nicht nur Geld, sondern auch ein geändertes Management-Team und viel Zeit. Wäre es nicht leichter einfach eine Tochter-SE zu gründen?
3.4.4 Auch radikal verändert ist die Verweisung auf nationales Recht. Nach dem 1989 Modell, wenn eine Frage nicht in der Verordnung behandelt wurde, ist diese als zunächst auf die der Verordnung unterliegenden allgemeinen Grundsätzen des europäischen Rechts angewiesen. Das ist nicht mehr der Fall. Jetzt lautet die Hierarchie anwendbaren Recht
- Die Bestimmungen der Verordnung.
- Wenn die Verordnung Bestimmungen, die von den Parteien frei in der Satzung der SE eingebracht wurden das ausdrücklich erlaubt.
- Nationales AG-Recht wenn die Frage bisher nicht geregelt wurde
- Satzungsbestimmungen, die von dem nationalem Recht erlaubt wurden.
Ein einheitliches SE-Recht hat die Kommission damit aus rein politischen Gründen endgültig ausgeschlossen. Je mehr die Staaten selber das Recht der SE regeln können, desto rascher wird sich eine Übereinstimmung finden.
3.4.5 Es gab jetzt fünf Wege in der eine SE gegründet sein konnte in der Regelung von 1991: durch Verschmelzung, durch Gründung einer Holding- SE, durch Gründung einer Tochter-SE, durch Umwandlung und durch Gründung einer Tochter-SE von einer SE.
- Für die Verschmelzung kommen nur Aktiengesellschaft in Frage und zwar zwei oder mehr davon mit ihren Sitzen in anderen Mitgliedstaaten. Gemäß Art. 18, 19 der Verordnung ist ein Verschmelzungsplan nötig, der auch offengelegt werden muß. Danach sollte dieser Plan gemäß Art. 20 von einem Sachverständigen geprüft werden.
- Für die Gründung einer Holding-SE sind zwei oder mehr AGs oder zum ersten Mal auch zwei GmbHs aus verschiedenen Mitgliedstaaten erforderlich.
- Es gab keine Änderungen hier seit dem 1989 Entwurf.
- Auch neu seit 1989 war die Möglichkeit für eine AG mit einer Tochtergesellschaft in einem anderen Mitgliedland sich in eine SE umzuwandeln (Art. 37 a der Verordnung).
- Hier hat sich auch nichts geändert.
3.4.6 Die Mitbestimmungfrage blieb auch beim Alten.
3.4.7 Nach dem Entwurf von 1989 hafteten Mitglieder der Verwaltung für Schäden, die durch schuldhaftes Verhalten verursacht wurden. In dem 1991 Entwurf haften diejenigen für den Schaden, der durch eine Verletzung ihrer Pflichten entsteht. Schuldhaftes Verhalten ist ein subjektiver Maßstab, während Pflichtverletzung rein objektiv zu beurteilen ist.
3.4.8 War dieser Entwurf ein Schritt vorwärts in der Suche nach einem europäischen Aktiengesellschaftsrecht? Da die Vorschriften die ursprünglichen Entwürfe immer weiter verabschieden, steht ein erhebliches Fragezeichen darüber, ob es überhaupt wünschenswert ist, weiterhin so einer verminderten und geschwächten Gesellschaftstyp fortzuführen. Wie die hier steht ist die SE eine Art Gesellschaft zwischen einer nationalen und eine supranationalen die selber gar nicht weiß was sie sein soll. „ Genausogut k ö nnte man allen AGs in allen Mitgliedstaaten gestatten, sich SE zu nennen, wenn sie in mindestens zwei Mitgliedstaaten t ä tig sind... “11 meinte Rasner.
3.5 Der Entwurf von 1991 war ebenso erfolglos wie seine Vorgänger. Immer weiter blieb die SE stehen- ein hoffnungsloses Relikt von ehrgeizigeren Zeiten. Die sogenannte Davignon-Sachverst ä ndigengruppe wurde etabliert, um einen Kompromiß in der Frage der Mitbestimmung zu finden. 1997 legte der luxemburgische EU-Ratspräsident den Davignon Bericht den Mitgliedstaaten vor. Der Kompromißvorschlag wurde sehr auf das französische Modell der Mitbestimmung gestüzt. Deutschland, Österreich und Schweden lehnten diesen Vorschlag grundsätzlich ab. Langsam nach dem Treffen der Arbeitsminister der Mitgliedstaaten wurden Österreich und Schweden überzeugt das Modell zu akzeptieren. Als letzte Sperre blieb nur Deutschland übrig.
3.5.1 „ Die Europ ä ische Kommission hat die am 20. Dezember im EU-Ministerrat erzielte politische Einigung ü ber den Verordnungsvorschlag zum Statut der Europ ä ischen Aktiengesellschaft (SE) und ü ber die Richtlinievorschlag zur Stellung der Arbeitnehmer in der SE begr üß t.“ So wurde die endgültige Einigung im Rat über die SE in Nizza bekannt gegeben. Nach über 30 Jahren wurde der Traum endlich Realität aber zu welchem Preis?
3.5.2 Ein Gremium wird jetzt vorgesehen, welches die Arbeitnehmer vertreten soll, etwa nach dem französischen Modell. Es wird dann ausgehandelt, welche Rechte dieses Gremium hat. Findet keine Einigung statt, so werden die Standard-Vorschriften der Verordnung in Kraft treten. Laut dieser Vorschriften gibt es insbesondere eine Unterrichtspflicht von Seiten des Verwaltungsorgans.
3.5.2.1 Im Falle einer Holding-SE, wenn keine Einigung erreicht wird und die Arbeitnehmer vor der SE-Gründung ein Mitspracherecht bei Unternehmensbeschlüssen hatten, wird dieses Recht weiterbestehen.
3.5.2.2 Wo eine SE durch Verschmelzung gegründet wird und die Mitbestimmung für mindestens 25% der Arbeitnehmer vor der Verschmelzung galt, sind die Standardvorschriften über die Arbeitnehmermitbestimmung zu benutzen. Wenn die Geschäftsleiter und die Arbeitnehmer sich auf ein anderes Mitbestimmungsmodell einigen oder die Arbeitnehmer vor der Gründung keine Mitbestimmungsrechte hatten, kann das Mitbestimmungsmodell der SE, obwohl es von den Standardmodellen abweicht, eingetragen werden.
4 4.1 2004 soll die SE von dem Europäischen Parlament verabschiedet werden. Nach über 30 Jahren Besprechung und fünf Entwürfe sieht das Endprodukt sehr verändert aus. Kürzer als am Anfang und mehrmals auf nationales statt europäisches Recht angewiesen, bildet diese keine einheitliche Supranationalegesellschaft mehr.
4.2 Als solche, ist die SE überhaupt noch wünschenswert? Viele Kommentatoren verneinen diese Frage. Wir sollen abwarten bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist und dann die SE angemessen regeln. Aber die SE wie sie jetzt vorgesehen ist, bringt doch Vorteile für Europa. Als Symbol eines vereinheitlichten Europas ist die SE von grundlegender Wichtigkeit. Erhebliche Kosteneinsparung sind auch mit der SE verkoppelt, welche Europa einen Vorsprung im Vergleich zur Konkurrenz geben wird. Es kann auch argumentiert werden, daß die Regelungen, schlecht wie sie sind, heilbar sind. Wenn sich das Klima ändert und die Mitgliedstaaten bereit sind, einer SE zuzustimmen, die umfangreicher als die Bestehende ist, kann das nämlich schneller passieren, wenn die Grundregelungen schon getroffen worden sind. Wünschenswert ist die jetzige daher nicht gerade, aber trotzdem praktizierbar. Eine neue Ära ist mit der Einigung in Nizza eingetreten, was hoffentlich ein Blühen und Gedeihen der europäischen Wirtschaft mitsichbringt.
Literaturverzeichnis:
1. Hauschka, Dr. Christoph E., „ Die Europ ä ische Aktiengesellschaft (SE) im Entwurf der Kommission von 1991: Vor der Vollendung? “, EuZW 5/1992, s. 147
2. Hoffmann, Dr. Jochen, „ Die Bildung der Aventis S.A. - ein Lehrst ü ck des europ ä ischen Gesellschaftsrechts “, NZG 22/1999, s. 1077
3. Hommelhoff, Prof. Dr. Peter, „ Gesellschaftrechtliche Fragen im Entwurf eines SE-Statuts “, AG 10/1990, s. 422
4. Hopt, Klaus J., „ Europ ä isches Gesellschaftsrecht- Krise und neue Anl ä ufe “, ZIP 3/98, s. 96
5. Lutter, Prof. Dr. Marcus, „ Gen ü gen dievorgeschlagenen Regelungen f ü r eine ,Europ ä ische Aktiengesellschaft ’ ? “, AG 10/1990, s. 413
6. Merkt, Dr. Hanno, „ Europ ä ische Aktiengesellschaftsrecht: Gesetzgebung als Selbstzweck? “, BB 10/1992, s. 652
7. Monti, Mario, „ Statut der Europ ä ischen Aktiengesellschaft “, WM 13/1997, s. 607
8. Neßler, Volker, „ Wettbewerb der Rechtsordnungen oder Europ ä isierung?- Stand und Perspektiven des Europ ä ischen Gesellschaftsrechts “, ZfRV 1/2000, s. 1
9. Rasner, Dr. Henning, „ Die Europ ä ische Aktiengesellschaft (SE) - ist sie w ü nschenswert? “, ZGR 3/1992, s. 315
10.Trojan-Limmer, Dr. Ursula, „ Die ge ä nderte Vorschl ä ge f ü r ein Statut der Europ ä ischen Aktiengesellschaft (SE) “, RIW 12/1991, s. 1010
11.Graf von Bernstorff, Dr. Iur. Christoph, „ Das Unternehmensrecht in Europa (Teil I) “, EWS 11/1998, s. 397
12.Wiesner, Peter M., „ Ü berblick ü ber den Stand des Europ ä ischen Unternehmensrechts “, EuZW 20/1998, s.619
13. http://www.jura.uni-duesseldorf.de
14. http://www.europa.eu.int
15. http://www.eu-kommission.de
16. http://wirtschaft.aon.at
[...]
1 Die Kosteneinsparung ist auf bis zu 30 Mrd. US-$ geschätzt, so der Rat für Wettbewerbsfähigkeit unter dem Vorsitz von Ciampi.
2 Mehr dazu unter 3
3 AWD 1960, 1 ff.
4 Sonderbeilage zum Bulletin 9/10-1966 der EG
5 Prof. Dr. Marcus Lutter, „ Gen ü gen die vorgeschlagenen Regelungen f ü r eine ,Europ ä ische Aktiengesellschaft ’ ? “ , Die Aktiengesellschaft, Nr. 10, 1. Oktober 1990, s. 413
6 Mehr dazu unter 3.4
7 Siehe z.B. Lutter, ibid; Dr. Hanno Merkt, „ Europ ä ische Aktiengesellschaft: Gesetzgebung als Selbstzweck? “, Betriebs-Berater, 1992, Heft 10, s. 652.
8 z.B. in Art. 13, wo die Satzung der SE geregelt ist. Obwohl scheinbar eine Aufweisung auf europäisches Recht (Die 2. (Kapital) Richlinie von 1976), setzt diese Regelung nur ein Mindeststandard voraus.
9 Auch “race to the bottom” genannt. Der Begriff stammt aus dem USA, wo die Staat von Delaware viel flexiblere Gesellschaftsregelungen als andere Staaten hatte, was eine Flut von Gesellschaften in der Staat hinein auslöste.
10 Lutter, ibid
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Societas Europaea (SE)?
Die Societas Europaea (SE), auch Europäische Aktiengesellschaft genannt, ist eine grenzüberschreitende Aktiengesellschaft, die in mehreren Ländern der Europäischen Union tätig ist. Sie basiert auf einem einheitlichen europäischen Recht und soll die Entwicklung des Europäischen Binnenmarktes vollenden.
Welche Vorteile bietet die SE?
Die SE ermöglicht es Unternehmen, die in bis zu fünfzehn Mitgliedsstaaten durch ein Netz von Tochter- und Holdinggesellschaften aktiv sind, eine einzige Europäische Gesellschaft zu gründen. Dies führt zu Kosteneinsparungen, da nur ein Rechtssystem berücksichtigt werden muss. Außerdem wird es europäischen Aktiengesellschaften ermöglicht, besser mit US-Großkonzernen zu konkurrieren. Eine Sitzverlegung wird einfacher und kostengünstiger.
Welche Nachteile hat die SE?
Die Mitgliedstaaten, insbesondere das Vereinigte Königreich und Deutschland, waren nicht bereit, ihre Autorität an Europa abzutreten. Das Statut zur SE wurde vielfach geschwächt, so dass nur ein unübersichtlicher Kern übrigbleibt, der oft auf nationales Recht verweist.
Wann wurde die politische Einigung über die SE erzielt?
Der EU-Ministerrat hat sich am 20. Dezember 2000 nach über dreißigjährigen Diskussionen politisch geeinigt. Ab 2004 sollte die Möglichkeit bestehen, SEs zu gründen.
Wer hat den ersten Anstoß zur SE gegeben?
Der erste Anstoß zur SE kam 1959 von Thibièrge, einem französischen Notar, mit dem Vorschlag einer société par actions de type européen. Kurz danach nahm Pieter Sanders das Thema in seiner Antrittsvorlesung an der Universität Rotterdam auf: „Auf dem Weg zu einer europäischen Aktiengesellschaft“.
Welche Entwürfe zur SE gab es?
Es gab mehrere Entwürfe zur SE, darunter: Entwurf von 1970, Entwurf von 1975, Entwurf von 1989, Entwurf von 1991 und Entwurf von 2000.
Was waren die Hauptprobleme bei den Entwürfen zur SE?
Die Hauptprobleme betrafen das Verwaltungssystem (monistisch vs. dualistisch), das Konzernrecht, die Mitbestimmung von Arbeitnehmern und steuerrechtliche Fragen. Die Frage der Mitbestimmung war besonders umstritten.
Was war das Drei-Bänke-Modell der Mitbestimmung?
Das Drei-Bänke-Modell der Mitbestimmung, das im Entwurf von 1975 vorgeschlagen wurde, sah vor, dass die SEs ein Modell haben, das dem deutschen Modell angeglichen wird, d.h. mit Aufsichtsorgan, in dem Vertreter der Arbeitnehmer anwesend sind.
Warum wurde die Rechtsgrundlage der Verordnung geändert?
Die Rechtsgrundlage wurde von Art. 235 EWGV zu Art. 100a EWGV geändert, um die Schwierigkeiten zu überwinden, die bisher einen Kompromiss unmöglich gemacht hatten. Art. 100a erfordert nur eine qualifizierte Mehrheit im Ministerrat, während Art. 235 eine absolute Mehrheit benötigt.
Warum wurde die Verordnung in eine Verordnung und eine Richtlinie geteilt?
Die Verordnung wurde in eine Verordnung und eine Richtlinie geteilt, um die Frage der Mitbestimmung in einer gesonderten Richtlinie zu regeln. Die Richtlinie wurde auf Art. 54 Abs. 3 lit. g EWGV gestützt.
Welche Gründungsmechanismen für die SE gab es?
Nach dem Entwurf von 1989 gab es vier Wege, eine SE zu gründen: Verschmelzung, Gründung einer Holding-SE, Gründung einer Tochtergesellschaft-SE und Gründung einer Tochter-SE durch eine bereits bestehende SE.
Was waren die drei Mitbestimmungsmodelle im Entwurf von 1989?
Der Entwurf von 1989 führte drei Mitbestimmungsmodelle ein: das Deutsch-Niederländische Modell (Mitbestimmung im Aufsichtsorgan), das Französisch-Belgische Modell (abgesondertes Arbeitnehmervertreterorgan) und das Tarifmodell der anglo-sächsischen Länder (ausgehandelte Vereinbarungen).
Welche Änderungen gab es im Entwurf von 1991?
Im Entwurf von 1991 wurde noch stärker auf nationales Recht verwiesen, aber es wurden auch revolutionäre Vorschriften, wie die Sitzverlegung ohne Auflösung, eingebracht. Die Möglichkeit für GmbH-Firmen, eine SE zu gründen, wurde erweitert.
Was war die Davignon-Sachverständigengruppe?
Die Davignon-Sachverständigengruppe wurde etabliert, um einen Kompromiss in der Frage der Mitbestimmung zu finden. Ihr Bericht von 1997 wurde jedoch von einigen Mitgliedstaaten abgelehnt.
Wie sieht die Mitbestimmung in der endgültigen Einigung zur SE aus?
Es wird ein Gremium vorgesehen, welches die Arbeitnehmer vertreten soll. Es wird dann ausgehandelt, welche Rechte dieses Gremium hat. Findet keine Einigung statt, so werden die Standard-Vorschriften der Verordnung in Kraft treten.
- Citar trabajo
- Diarmada, Cormac Mac (Autor), 2001, Die Europäische Aktiengesellschaft: Ankunft einer neuen Ära, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102360