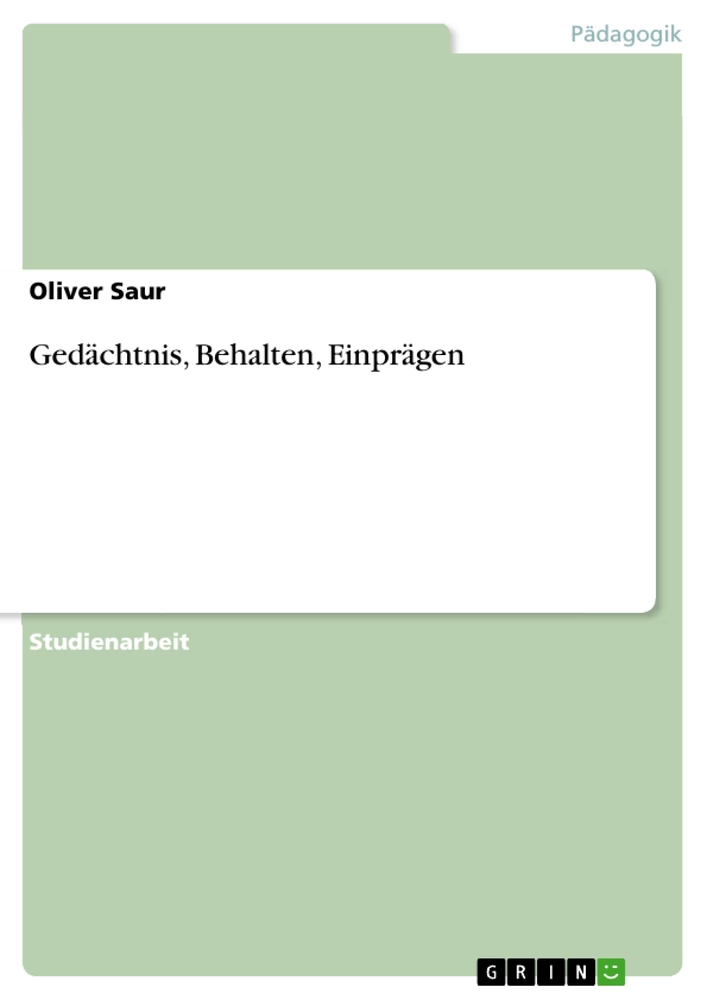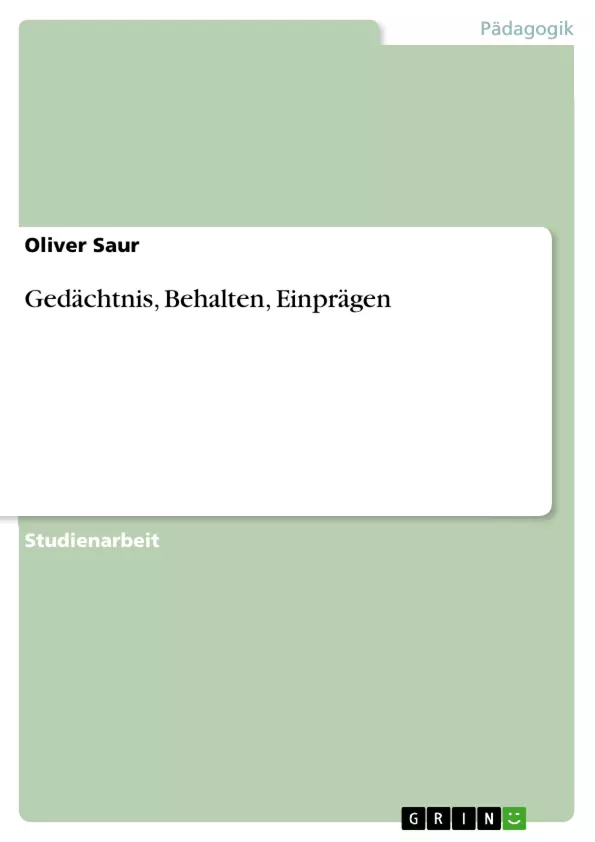Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Gedächtnis, Behalten, Einprä- gen“, welches wir deshalb ausgesucht haben, weil es nach unserer Meinung Erkennt- nisse beinhaltet, die für einen angehenden Lehrer eine fundamentale Bedeutung ha- ben. Gerade deshalb, weil der Lehrer zu einem großen Teil als Wissensvermittler gegenüber den Schülern fungiert, ihnen Inhalte und das Wissen, wie man sich Inhalte effektiv aneignet, vermittelt. Erst die aktuellen psychologischen Erkenntnisse über das menschliche Gedächtnis, bestimmter Einprägetechniken und Behaltensstrategien gewährleisten die Fähigkeit, den Schülern mit höchster Effizienz stoffliche Inhalte zu vermitteln, die auch nach langer Zeit noch abrufbar sind und den Schülern das Wis- sen zu vermitteln, wie man sich bestimmte stoffliche Inhalte selbstständig und mit höchster Effektivität aneignet.
Bei Untersuchungen in Bezug auf die Leistungen bei Gedächtnisaufgaben bei älteren und jüngeren Kindern stellte sich heraus, dass ältere Kinder bessere Leistungen er- zielten als jüngere Kinder. Diese Tatsache ist jedoch nicht auf eine unterschiedliche Gedächtniskapazität zwischen den verschiedenen Altersgruppen zurückzuführen, sondern vielmehr auf die unterschiedlichen Strategien der altersunterschiedlichen Kinder, sich bestimmte Informationen einzuprägen und abzurufen. Um sich be- stimmte Dinge effektiv einzuprägen, verwenden ältere Kinder Strategien, wie das verbale Memorieren, welches die Behaltensleistung verbessert. Jüngere Kinder hin- gegen benutzen solche Strategien nicht, wodurch ihre Behaltensleistung deutlich schlechter ist als die der älteren Kinder. Erst wenn die jüngeren Kinder aufgefordert werden, die Informationen mehrfach zu wiederholen verbessert sich auch bei ihnen die Behaltensleistung.
Wie in dem Beispiel nochmals deutlich wird, ist es sehr wichtig, dass der Lehrer In- formationen in einer solchen Art und Weise an die Schüler weitergibt, dass sie im Gedächtnis der Schüler für einen langen Zeitraum erhalten bleiben. Außerdem muß der Lehrer den Schülern zeigen, mit welchen Strategien sie sich Informationen selbstständig aneignen, damit die Inhalte fest im Gedächtnis der Kinder verankert werden.
Im folgenden soll grob der Aufbau des menschlichen Gedächtnisses und seine ein- zelnen „Speicherkomponenten“ dargestellt werden. Daraufhin möchten wir den Beg- riff „Behalten“ näher definieren, das „Einprägen“ theoretisch beleuchten und letztendlich praktische Strategien und Möglichkeiten zum effizienten Einprägen und Be- halten abhandeln.
2. Das Gedächtnis
Trivial betrachtet ist das menschliche Gedächtnis eine Art geistiger Aktenschrank, in dem eine Vielzahl von Informationen enthalten sind. So werden dort Daten und Er- eignisse gespeichert, die für unser Leben mehr oder weniger von Bedeutung sind und deren wiederholter Abruf zumeist für das tägliche Leben notwendig ist. Das Ge- dächtnis umfasst alles, was über unsere Sinne in unterschiedlichen zeitlichen Ab- ständen wahrgenommen wurde, was wir wissen und woran wir uns erinnern können. Beim menschlichen Gedächtnis muß zwischen zwei verschiedenen Faktoren unter- schieden werden, dem Wiedererkennen und dem Reproduzieren.
Das Wiedererkennen ist dafür zuständig, dass bestimmte wahrgenommene Ereignisse oder Informationen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens sammelt, immer wieder identifizieren kann, eben wiedererkennen kann. Diese Fähigkeit hat im Alltag eines Menschen eine wichtige Bedeutung. Man erkennt alte Bekannte wieder, das Kind erkennt seine Familie wieder, der Schüler erkennt früher gelernte Vokabeln einer beliebigen Fremdsprache wieder und kann diese gezielt einsetzen. Die Fähigkeit Dinge wiederzuerkennen bildet sich bereits im Säuglingsalter in der sechsten bis ach- ten Woche aus, wobei die Wiederekennensleistung mit zunehmenden Alter des Kin- des ansteigt. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Wiedererkennensleis- tung im Alter zunehmend abfällt, allerdings nicht so stark wie die Gedächtnisleis- tung.
Das freie Reproduzieren oder Erinnern unterscheidet sich vom Wiedererkennen da- durch, dass hierbei zuvor eingeprägte Wissensinhalte wiedergegeben werden ohne die Hilfestellung von bestimmten Reizen. Beim Erinnern muß der Mensch Informa- tionen aus dem Speicher abrufen, wobei er im Gegensatz zum Wiedererkennen keine Impulse oder Reize bekommt, sondern frei aus dem Gedächtnis gelerntes Wissen reproduziert. Demnach müssen beim Reproduzieren auch die Hinweisreize gespei- chert werden.
„Das Erinnern und Reproduzieren entwickelt sich später als das Wiedererkennen und verbessert sich bis zum Erwachsenenalter ständig, während sie im Alter wieder ab- nehmen“.
In der Psychologie wird zwischen drei verschiedenen Gedächtnisprozessen unter- schieden, dem Einspeichern bzw. Erwerb, dem Behalten und dem Abruf.
Das Erinnern bzw. der Erwerb bezeichnet die Aufnahme von Informationen, die wir zuvor wahrgenommen und registriert haben. Das Behalten ist dafür zuständig, dass Informationen dem Gedächtniss erhalten bleiben, jedoch ist dies nicht immer mög- lich, da bestimmte Informationen mit der Zeit verblassen oder durch neue Informati- onen verdrängt werden. Der Abruf ist der Prozeß, bei dem bestimmte Informationen, die im Gedächtnis abgelegt sind wieder aktiviert werden. Durch den Abruf werden dem Menschen Wissensinhalte wieder deutlich, sie werden praktisch in das Bewußt- sein geholt.
Damit wir, wie oben bereits erwähnt, Informationen speichern und auch wieder abru- fen können und damit diese Informationen mehr oder weniger lang in unserem Ge- dächtnis erhalten bleiben, dies ermöglichen drei Gedächtnissysteme gemäß eines psychologischen Gedächtnismodels. Diese Gedächtnissysteme haben eine Analogie zu einem Computer, wobei es sich beim menschlichen Gedächtnis jedoch nicht um einzelne Funktionseinheiten handelt, wie es bei einem Computer der Fall ist. Viel- mehr greifen die verschiedenen Systeme des menschlichen Gedächtnisses ineinander über (bei Computern ist dies nur bedingt möglich).
Zum besseren Verständnis lässt sich das Gedächtnis mit seinen drei Gedächtnissys- temen (drei Speicher) schematisch darstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Aus: „Einführung in die Gedächtnispsychologie“ von Ulrich Glowalla und Gudrun Häfele, Justus-Liebig-Universität Gießen, Fachbereich Psychologie, 7. Auflage, S.9)
Im folgenden sollen die drei Gedächtnissysteme chronologisch dargestellt werden.
2.1 Sensorisches Gedächtnis
Während einer sehr kurzen Zeit (ca. 1 Sekunde) erhalten wir anhand des sensori- schen Gedächtnisses ein nahezu vollständiges Abbild der uns umgebenden Informa- tionen. Dabei wird speziell auf auditive und visuelle Wahrnehmungen eingegangen und somit in ein visuelles und ein auditives sensorisches Gedächtnis unterschieden.
Sperling hat verschiedene Experimente durchgeführt, in denen er festgestellt hat, daß es ein kurzzeitiges visuelles sensorisches Gedächtnis gibt, welches alle vorhandenen visuellen Informationen aufnimmt. Dieses wird auch von Neisser (1967) als Ikon bezeichnet, ohne welches die Wahrnehmung erheblich schwieriger wäre. Da viele auf uns einwirkende Reize nur sehr kurz andauern, benötigt dieses Ikon eine Mög- lichkeit, die Reizinformationen für kurze Zeit zu speichern, damit sie erkannt und später analysiert werden können.
Ein Beispiel für ein Experiment nach Sterling wäre die Darbietung verschiedener Buchstabenreihen. Anschließend sollen die Versuchspersonen so viele Elemente (Items) wie möglich nennen, die sie aus der Darbietung behalten haben. Zwischen drei und sechs erinnerte Items sind hier die Regel, wobei die Versuchspersonen aber berichten, daß sie mehr Items gesehen haben, welche jedoch verblaßten, bevor sie wiedergegeben werden konnten.
Das auditive sensorische Gedächtnis wird von Neisser auch echoisches Gedächtnis genannt. Ein solches Gedächtnis wird zur Verarbeitung vieler Aspekte sprachlicher Information benötigt.
In Gesprächen wird sich z. B. oft auf auditive Nacheffekte verlassen. Obwohl der Sprecher schon weiterspricht, versetzt uns das auditive Abbild in die Lage, vorange- gangene Sprachlaute noch zu verarbeiten. Dies wird beispielsweise daran deutlich, wenn eine Person ins Lesen vertieft ist und von einer anderen Person eine Frage ge- stellt bekommt. Oft wird dann zurückgefragt „Was haben Sie gesagt?“ Jedoch bevor der Satz beendet ist, hört die Person die vorangegangene Frage noch einmal in einer Art innerem Echo und kann sie beantworten, ohne daß sie nocheinmal wiederholt wurde.
2.2 Die selektive Aufmerksamkeit
Nachdem die Informationen in das sensorische Gedächtnis gelangt sind, ist die selek- tive Aufmerksamkeit für die Auswahl dieser Informationen von besonderer Bedeu- tung, denn nur wenn wir unsere Aufmerksamtkeit auf bestimmte Informationen rich- ten, können wir diese auch weiterverarbeiten. Die übrigen Reize, denen diese Auf- merksamkeit nicht geschenkt wurde, gehen sehr schnell wieder verloren.
Die selektive Aufmerksamkeit richtet sich danach, welche Reize für das entspre- chende Individuum von größerer Bedeutung oder Interesse sind. Sie ist sehr wichtig, da auf den Menschen jede Sekunde eine große Fülle von Reizen einströmt, die er überhaupt nicht geballt verarbeiten könnte.
Ein Beispiel für die selektive Aufmerksamkeit ist ein Experiment von Nickerson und Adams (1979), welches zeigt, daß die Versuchspersonen das genaue Aussehen einer Geldmünze nur sehr schlecht wiedergeben können, obwohl sie tagtäglich eine solche in der Hand halten. Diese Münze als solche und ihren Wert können die Personen aber durchaus wiedererkennen und von einer anderen Münze unterscheiden. Hier zeigt die selektive Aufmerksamkeit sehr deutlich, daß wir wesentliche Merkmale verarbeiten und weniger bedeutsame Details nicht weiter beachten.
„Die Kapazitätsgrenzen der Aufmerksamkeit sind die eigentliche Ursache für die Grenzen der Wiedergabeleistung, wie sie in visuellen und auditiven Berichtsaufga- ben nachgewiesen wurden. Die gesamte Information gelangt in das sensorische Ge- dächtnis, aber damit sie behalten werden kann, muß jede Informationseinheit beach- tet und in eine dauerhaftere Form übertragen werden.“ (vgl. John R. Anderson, „Ko- gnitive Psychologie, Spektrum der Wissenschaft, 1989, Heidelberg, S. 52).
Hat sich die Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen gerichtet, gelangen diese ins Kurzzeitgedächtnis. Somit wirkt diese wie ein Filter zwischen sensorischem Ge- dächtnis und Kurzzeitgedächtnis.
2.3 Das Kurzzeitgedächtnis
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Gedächtnis, Behalten, Einprägen“ und dessen Bedeutung für angehende Lehrer. Es werden Erkenntnisse über das menschliche Gedächtnis, Einprägetechniken und Behaltensstrategien untersucht, um die Effizienz der Wissensvermittlung an Schüler zu verbessern.
Was sind die zentralen Punkte in Bezug auf Gedächtnisleistungen bei Kindern?
Ältere Kinder erzielen bessere Gedächtnisleistungen als jüngere Kinder, was vor allem auf unterschiedliche Strategien zur Informationsspeicherung und -abruf zurückzuführen ist. Ältere Kinder nutzen Strategien wie das verbale Memorieren, während jüngere Kinder dies seltener tun.
Welche Rolle spielt der Lehrer bei der Wissensvermittlung?
Der Lehrer sollte Informationen so vermitteln, dass sie langfristig im Gedächtnis der Schüler erhalten bleiben. Außerdem sollte der Lehrer den Schülern Strategien vermitteln, wie sie sich selbstständig Informationen aneignen können, damit die Inhalte fest im Gedächtnis verankert werden.
Wie ist das menschliche Gedächtnis aufgebaut?
Das menschliche Gedächtnis wird oft als eine Art geistiger Aktenschrank betrachtet, in dem Informationen gespeichert werden, die für unser Leben von Bedeutung sind. Es umfasst alles, was über unsere Sinne wahrgenommen wurde, was wir wissen und woran wir uns erinnern können.
Was ist der Unterschied zwischen Wiedererkennen und Reproduzieren?
Wiedererkennen bezieht sich auf die Fähigkeit, bestimmte wahrgenommene Ereignisse oder Informationen wiederzuerkennen. Reproduzieren (oder Erinnern) hingegen beinhaltet das Wiedergeben zuvor eingeprägter Wissensinhalte ohne die Hilfestellung von Reizen.
Welche Gedächtnisprozesse werden in der Psychologie unterschieden?
In der Psychologie werden drei Gedächtnisprozesse unterschieden: Einspeichern bzw. Erwerb (Aufnahme von Informationen), Behalten (Erhaltung von Informationen im Gedächtnis) und Abruf (Aktivierung von Informationen aus dem Gedächtnis).
Welche drei Gedächtnissysteme gibt es?
Es gibt drei Gedächtnissysteme: das sensorische Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis.
Was ist das sensorische Gedächtnis?
Das sensorische Gedächtnis speichert für eine sehr kurze Zeit (ca. 1 Sekunde) ein nahezu vollständiges Abbild der uns umgebenden Informationen. Es wird in ein visuelles und ein auditives sensorisches Gedächtnis unterschieden.
Was ist die selektive Aufmerksamkeit?
Die selektive Aufmerksamkeit ist für die Auswahl der Informationen wichtig, die aus dem sensorischen Gedächtnis weiterverarbeitet werden. Nur wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Informationen richten, können wir diese auch behalten.
Was ist das Kurzzeitgedächtnis (KZG)?
Das Kurzzeitgedächtnis (KZG), auch Kurzzeitspeicher oder Arbeitsspeicher genannt, enthält nur Informationen, die gerade genutzt werden. Informationen gelangen über das Langzeitgedächtnis oder über Reize aus unserer Umwelt (gefiltert durch die selektive Aufmerksamkeit) in das KZG.
- Citation du texte
- Oliver Saur (Auteur), 2001, Gedächtnis, Behalten, Einprägen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102414