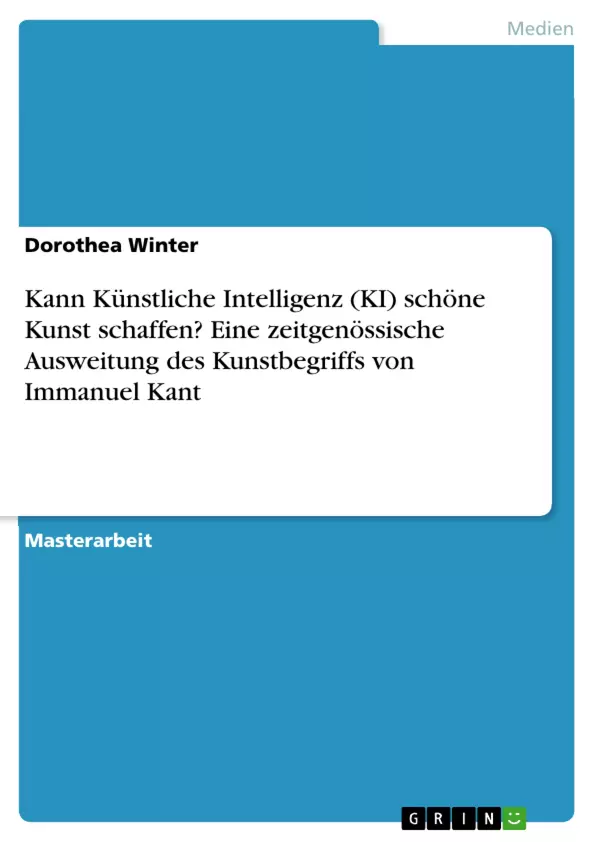Diese Arbeit widmet sich, grob gesagt, der Fragestellung, warum KI keine Kunst zu schaffen vermag. Da das Gesamtaufgabenfeld der Fragestellungen des Ästhetischen bezüglich der KI und ihrer Möglichkeiten in der philosophischen Forschung bislang eher weniger Beachtung gefunden hat, liegen deshalb kaum wissenschaftliche Forschungsarbeiten dazu vor.
Spätestens seit Künstliche Intelligenz (folgend: KI) im Zuge der digitalen Transformation in der globalen Gesellschaft, in Politik und Wirtschaft und damit mittelbar oder unmittelbar im Alltag jedes Einzelnen Einzug gehalten hat, hat sich die Beschäftigung mit ihr gewandelt: Was noch vor kurzem Forschungsgegenstand einiger weniger "weltfremder Nerds" in mathematikbasierten wissenschaftlichen Disziplinen, etwa der Informatik, war, hat sich binnen weniger Jahre zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen ausgedehnt.
Durch diese gesamtgesellschaftliche Bedeutungszunahme hat sich auch der wissenschaftliche Fokus auf KI insofern verändert, als er sich vom Forschungsfeld primär mathematisch orientierter Wissenschaftsdisziplinen zur Problemstellung von Geistes- und Sozialwissenschaften ausgeweitet hat: Fragen, die vor wenigen Jahren ausschließlich unter Informatikern diskutiert wurden, beschäftigen heute Soziologen, Politologen – und Philosophen. So ist es beispielsweise unter anderem diesem neuen Problembewusstsein zuzuschreiben, dass der Freistaat Bayern 50 Professuren einrichten will, die sich mit den im Zusammenhang der zunehmenden Verbreitung von KI in unserer Gesellschaft aufkommenden Fragen unter unterschiedlichen wissenschaftlichen Aspekten auseinandersetzen sollen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Methodische Vorbemerkungen
2 Verortung der Forschungsfrage
2.1 Die philosophiehistorische Einordnung der Forschungsfrage in der Traditionslinie des Kunstbegriffs: Von der rs/yn zur schönen Kunst Kants
2.2 Die Stellung der Kritik der Urteilskraft im kritischen Gesamtwerk Kants
3 Was ist schöne Kunst im kantischen Sinne?
3.1 Die Stellung der schönen Kunst in der Kritik der Urteilskraft
3.2 Was ist schön? Das Schöne als Produkt des ästhetischen Geschmacksurteils
3.3 Was ist Kunst? Kunst in Abgrenzung zu Natur, Wissenschaft und Handwerk
3.4 Was ist schöne Kunst? Schöne Kunst in Abgrenzung zu mechanischer und zu angenehmer Kunst
3.5 Was ist Genie? Das Genie als Talent, das der Kunst die Regel gibt
4 Was ist KI unter philosophischem Aspekt?
4.1 Die Entwicklung der KI unter philosophiehistorischem Aspekt
4.2 Die philosophische Abgrenzung der Konzepte von Strong AI und Weak AI
5 Kann KI schöne Kunst als Werk des Genies im Sinne Kants hervorbringen?
5.1 Bestandsaufnahme: Von KI geschaffene „Kunst“
5.2 Kann KI Kunst allgemein schaffen? Freiheit als notwendige Bedingung des Kunstschaffens allgemein
5.3 Kann KI schöne Kunst schaffen? Das Genie als hinreichende Bedingung des schöne Kunst Schaffens
6 Eine zeitgenössische Ausweitung des kantischen Kunstbegriffs im Zeitalter der KI: Das Prinzip der Autorschaft als Prämisse für Kunst
6.1 Beuys: Das Prinzip der Autorschaft im erweiterten Kunstbegriff und inwiefern KI diesem gerecht werden kann
6.2 Deutsches Urheberrecht: Das Prinzip der Autorschaft als implizite Prämisse im juristischen Kunstbegriff und inwiefern KI diesem gerecht werden kann
Conclusio
Literaturverzeichnis
Einleitung
Spätestens seit Künstliche1 Intelligenz2 (folgend: KI) im Zuge der digitalen Transformation3 in der globalen Gesellschaft in Politik und Wirtschaft und damit mittelbar oder unmittelbar im Alltag jedes Einzelnen Einzug gehalten hat, hat sich die Beschäftigung mit ihr gewandelt: Was noch vor kurzem Forschungsgegenstand einiger weniger „weltfremder Nerds“ in mathematikbasierten wissenschaftlichen Disziplinen, etwa der Informatik, war, hat sich binnen weniger Jahre zu einem gesamtgesellschaftlichen Phänomen ausgedehnt.
Durch diese gesamtgesellschaftliche Bedeutungszunahme hat sich auch der wissenschaftliche Fokus auf KI insofern verändert, als er sich vom Forschungsfeld primär mathematisch orientierter Wissenschaftsdisziplinen zur Problemstellung von Geistes- und Sozialwissenschaften ausgeweitet hat: Fragen, die vor wenigen Jahren ausschließlich unter Informatikern4 diskutiert wurden, beschäftigen heute Soziologen, Politologen - und Philosophen. So ist es beispielsweise unter anderem diesem neuen Problembewusstsein zuzuschreiben, dass der Freistaat Bayern 50 Professuren einrichten will, die sich mit den im Zusammenhang der zunehmenden Verbreitung von KI in unserer Gesellschaft aufkommenden Fragen unter unterschiedlichen wissenschaftlichen Aspekten auseinandersetzen sollen.5
Diese Auseinandersetzung ist nicht zuletzt deshalb dringend angezeigt, weil KI innerhalb der letzten Jahre in ihren Möglichkeiten exponentiell zugenommen hat - ein Erfolg, der sich immer komplexeren Strukturen verdankt, auf denen KI basiert. In dem Maße, in dem KI an Komplexität hinzugewonnen hat, sind nicht nur ihre Vorteile, sondern auch ihre möglichen Gefahren in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Was als Frage technischer Machbarkeit primär Informatiker faszinierte, rief alsbald die philosophische Ethik auf den Plan und die Frage: Dürfen wir, was wir können, bloß weil wir es können?
Die Philosophie kann allerdings über die ethischen Fragestellungen hinaus auch in anderen Bereichen der KI-Forschung wertvolle Impulse geben - etwa auf dem Feld der Epistemologie oder dem der Ästhetik. Hinsichtlich der Fragestellung dieser Untersuchung reicht es jedoch aus, sich auf den Bereich der Ästhetik zu beschränken - und hier auf deren theoretische Grundlegung des Kunstbegriffs - alles andere würde allzu weit von der Forschungsfragestellung wegführen. Selbstverständlich kann aus den gleichen Gründen auch der Forschungsstand in anderen wissenschaftlichen Disziplinen außerhalb der Philosophie hier nur insofern Berücksichtigung finden, als einzelne Forschungsergebnisse relevante Hinweise zur Fragestellung dieser Untersuchung beizutragen vermögen.
In diesem Sinne widmet sich die vorliegende Arbeit, grob gesagt, der Fragestellung, warum KI keine Kunst zu schaffen vermag. Da das Gesamtaufgabenfeld der Fragestellungen des Ästhetischen bezüglich der KI und ihrer Möglichkeiten in der philosophischen Forschung bislang eher weniger Beachtung gefunden hat, liegen deshalb kaum wissenschaftliche Forschungsarbeiten dazu vor.6 Es wäre vermessen, im Rahmen dieser Untersuchung über die Forschungsfrage hinaus auch jene Bereiche dieser wissenschaftlichen terra incognita7 abhandeln zu wollen. Deshalb beschränkt sich die Forschungsfrage dieser Untersuchung explizit darauf, zu prüfen, warum KI keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorzubringen vermag.
Diese Bezugnahme auf Immanuel Kant scheint angesichts der breiten philosophietheoretischen Grundlegung des Ästhetischen, die Kant in seinen Kritiken vornimmt und den fundamentalen Erkenntnissen, die Kants Forschungen zu wissenschaftlichen Fragestellungen zur Ästhetik beigetragen haben, methodisch gerechtfertigt. Darüber hinaus sind der breitgefächerten Sekundärliteratur, die zwischenzeitlich zu Kants ästhetischen Konzepten entstanden ist, weitere hilfreiche wissenschaftliche Handreichungen zur Fragestellung dieser Arbeit zu entnehmen. Den Impulsen, die diese Untersuchung Kants Werk und der damit verbundenen Sekundärliteratur verdankt, scheint eine Ausweitung der Fragestellung zur Problematik zwischen KI und Kunst über Kant hinaus, die im letzten Teil dieser Untersuchung vorgenommen wird, angemessen, zumal sie durch die technische Entwicklung in diesem Bereich und den daraus resultierenden aktuellen Fragen nach einer wissenschaftlichen Einschätzung stetig an gesellschaftlicher Relevanz gewinnt.
Aus dieser gesamtgesellschaftlichen Relevanz und dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand leitet sich die Begründetheit der Fragestellung dieser Untersuchung ab. Es ist sicherlich erstrebenswert, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Kunst und KI unter wissenschaftlichem, genauer: philosophieästhetischem, Aspekt auszuleuchten.
Daraus ergibt sich für diese Untersuchung nachfolgender Aufbau:
Ausgehend von einer Verortung der Forschungsfrage unter philosophiehistorischem Aspekt hinsichtlich ihrer Position im zeitgenössischen Forschungsstand, beginnt diese Untersuchung mit einem kurzen Abriss der Frage nach dem, was Kunst ausmacht, der vom ré/v^-Begriff der griechisch-römischen Antike zur schönen Kunst Kants führt. Diese historische Zusammenstellung ist notwendig, um Kants ästhetisches Konzept in seinen Bezügen zur abendländischen Philosophie des Schönen aufzuzeigen. Nur in diesem philosophiehistorischen Zusammenhang lässt sich Kants Ästhetik, wie er sie in seiner Kritik der Urteilskraft8 entwickelt, erklären und in ihrer erweiterten - auch erkenntnistheoretischen und ethischen - philosophischen Einbettung begreifen.
Auf eine Einordnung von Kants Kritik der Urteilskraft in dessen kritisches Gesamtwerk folgt in dieser Untersuchung eine Ausarbeitung von Kants Begriff der „schönen Kunst“. Dabei erweist sich das Schöne als Produkt des ästhetischen Geschmacksurteils. In einem darauffolgenden Schritt wird Kants Abgrenzung der Kunst gegenüber Natur, Wissenschaft und Handwerk dargestellt. In einer weiteren Differenzierung teilt Kant die Kunst allgemein in mechanische und ästhetische Kunst auf, wobei er letztere nochmals in angenehme und schöne unterteilt.
Nachdem so eine werkimmanente Einordnung dessen erreicht wird, was Kant unter „schöner Kunst“ versteht, wird das Genie und seine Rolle beim Zustandekommen schöner Kunst näher untersucht. Das Genie nimmt für Kant insofern eine herausgenommene Stellung im künstlerischen9 Schöpfungsprozess ein, als Genialität für Kant eine hinreichende Bedingung für das Zustandekommen schöner Kunst darstellt. Darüber hinaus hebt Kant auf das Momentum der Freiheit ab - er spricht synonym in diesem Zusammenhang auch von „Willkür“ - das ihm, trotz der Gebundenheit des Genies an die natürlichen Regeln, als notwendige Bedingung der Hervorbringung dessen wird, was er als „schöne Kunst“ anzusehen bereit ist.
Nachdem der kantische Begriff der schönen Kunst derart in die Untersuchung eingebracht worden ist, wird nunmehr der Frage nachgegangen, was diesbezüglich unter „KI“ zu verstehen sei. Dabei wird zunächst die Entwicklung der KI unter philosophiehistorischem Aspekt untersucht, um anschließend zu einer Definition dessen zu gelangen, was unter „KI“ - und hier speziell unter den philosophischen Konzepten von „Strong AI“ und „ Weak AI“ - im Rahmen dieser Untersuchung verstanden werden soll. Diese begriffliche Klarstellung ist insofern erforderlich, als einerseits recht unterschiedliche und sich teilweise widersprechende KI-Definitionen im wissenschaftlichen Gebrauch sind und es andererseits für die Fragestellung dieser Untersuchung wichtig scheint, auf eine untersuchungsimmanente einheitliche und zur Beantwortung der Fragestellung operable KI-Definition zu rekurrieren. Angesichts der Tatsache, dass es Strong AI bislang noch nicht gibt - vermutlich nicht nur deshalb, weil, wie im weiteren Untersuchungsverlauf kurz dargestellt, dem prinzipielle logische Argumente entgegenstehen - wird in der Untersuchung „KI“ stets im Sinne des Konzeptes einer Weak AI verstanden.
Auf diese KI-Definition folgt nunmehr durch das Zusammenführen der Konzeption Kants schöner Kunst mit der prinzipiellen Möglichkeit des Kunstschaffens durch KI im Sinne der schönen Kunst Kants die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Untersuchung: „Warum kann KI keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorbringen?“
Auf eine Bestandsaufnahme von KI geschaffener Kunst folgt anschließend eine Ausweitung der Fragestellung dahingehend, dass untersucht werden soll, ob KI, über die schöne Kunst hinaus, Kunst allgemein im kantischen Sinne zu schaffen vermag. Im weiteren Verlauf dieser Untersuchung wird herausgearbeitet, dass KI dies nicht kann, weil KI prinzipiell nicht zur Freiheit respektive Willkür im kantischen Sinne fähig ist. Dadurch entfällt die notwendige Bedingung von dem, was Kant als Kunst allgemein versteht.
Demgegenüber erlangt das Genie den Status einer hinreichenden Bedingung schöner Kunst im kantischen Sinne: Jedes Schaffen schöner Kunst verdankt sich Genialität. Aus dieser hinreichenden Bedingung lässt sich als Zwischenergebnis ableiten, dass KI auch keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorzubringen vermag, da es ihr an Freiheit und an Genialität mangelt.
Obwohl die Forschungsfrage damit im Grunde beantwortet ist, bleibt es sowohl unter philosophischem als auch gesamtgesellschaftlichem Aspekt eine wichtige Frage, ob die bezüglich Kants Kunstbegriff gewonnenen Einsichten über den engen kantischen Kunstbegriff der schönen Kunst hinaus zum allgemeinen Verhältnis zwischen KI und Kunst in Anschlag gebracht werden können. Diese Ausweitung scheint insofern unter philosophiewissenschaftlichem Aspekt gerechtfertigt, als sie einen möglichen Lösungsansatz dieser in der zeitgenössischen philosophischen Diskussion aufgeworfenen Frage beizusteuern vermag. Voraussetzung dafür ist es, das enge kantische Prinzip der Genialität auszuweiten - was unter Berücksichtigung des Aspekts der Freiheit zum erweiterten Begriff der „Autorschaft“ führt. Erst das Prinzip der Autorschaft ermöglicht es, eine Auslotung des Verhältnisses zwischen KI und Kunst über Kant hinaus vorzunehmen, weil sie die von Kant eingeführten Prämissen den gewandelten gesellschaftlichen Anforderungen und dem technischen Fortschritt anzugleichen vermag: Da sich Technik und Gesellschaft seit Kant signifikant weiterentwickelt haben, muss eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Kunst und KI diesen Entwicklungen Rechnung tragen, um sowohl fachwissenschaftliche als auch gesellschaftliche Relevanz zu erreichen.
Wie oben bereits ausgeführt, gibt der Rahmen dieser Untersuchung quantitative Einschränkungen vor, aufgrund derer bei der im Abschnitt 6 erfolgenden Behandlung des Verhältnisses von Kunst und KI lediglich auf die Kunstdefinitionen von einem der „wichtigsten Aktionskünstler“10 11 des 20. Jahrhunderts, Joseph Beuys, und des deutschen Urheberrechts zurückgegriffen wird. Diese Begrenzung der Auswahl rechtfertigt sich dadurch, dass Beuys mit seinem sogenannten „erweiterten Kunstbegriff‘u eine zentrale Rolle in der zeitgenössischen Kunsttheorie einnimmt, während die juristische Definition von „Kunstwerk“ die gesellschaftlich relevante Dimension des Kunstbegriffs widerspiegelt. Obwohl diese beiden Kunstdefinitionen auf den ersten Blick recht weit auseinander zu liegen scheinen, erweisen sie sich bezüglich der KI-Problematik als überraschend übereinstimmend: Als Ergebnis der Untersuchung stellt sich heraus, dass in beiden Fällen letztlich die Autorschaft dasjenige Kriterium ist, an dem die Möglichkeit kunstschaffender KI scheitert. Somit schließt sich der Bogen der Untersuchung und das Momentum der Freiheit - bei Kant in der Implikation des Genies, in der zeitgenössischen Kunst in der Implikation der Autorschaft - erweist sich als jenes unüberwindliches, d. i. abstrakttheoretisches, Hindernis für KI, Kunst zu erschaffen: Wo es keine Freiheit gibt, kann keine Kunst entstehen, und da KI zur Freiheit nicht befähigt, kann sie prinzipiell auch keine Kunst erschaffen.
Bevor tiefer in die Untersuchung eingestiegen werden kann, scheint es angebracht zu sein, einige Vorbemerkungen zum methodischen Vorgehen in dieser Untersuchung anzubringen, da sich der innere Aufbau der Untersuchung an dieser methodischen Struktur orientiert. Daher wird diese methodische Struktur nachfolgend kurz aufgerissen.
1 Methodische Vorbemerkungen
Der Forschungsfrage angemessen ist vermutlich jenes methodische Vorgehen, bei dem in analytischer Weise in einem ersten Schritt die zentralen Begriffe und Konzepte der Problemstellung - im Falle dieser Untersuchung die Frage nach der „schönen Kunst“ bei Kant und dem, was unter „KI“ zu verstehen sei - dargestellt und in einem zweiten Schritt auf die Forschungsfrage bezogen werden. Daraus ergeben sich in einem dritten Schritt Ergebnisse, die als Lösungsschritte der Forschungsfrage angesehen werden können.
Wie bereits erwähnt, muss dieses Vorgehen Beschränkungen unterworfen werden, soll die Untersuchung nicht über Gebühr ausgedehnt und sich ihr zentraler Argumentationsstrang nicht unnötig in Verästelungen verlieren. Daher erfolgt bei Kant eine konsequente Begrenzung der Fragestellung auf den Bereich des Ästhetischen, wie er von Kant in seiner Kritik der Urteilskraft abgehandelt wird. Dabei werden auch in Kants Konzept der Ästhetik selbst Fragen der Moral und der Freiheit unter transzendentalem12 Aspekt, da wenig zielführend hinsichtlich der Fragestellung dieser Untersuchung, nicht berücksichtigt. In gleicher Weise erfolgt auch eine eingeschränkte Berücksichtigung der doch recht umfangreichen Sekundärliteratur zu Kants Ästhetik: Auch hier werden nur jene Aspekte berücksichtigt, die in einem unmittelbaren Zusammenhang zur Forschungsfrage stehen.
Über diese allgemeinen methodischen Hinweise hinaus, sei darauf hingewiesen, dass, wenn im weiteren Verlauf dieser Untersuchung davon gesprochen wird, dass KI Kunst schaffe, stets das schöpferische Wirken und eine diesem zugrundeliegende künstlerische Vorstellung gemeint ist. Die rein technische Herstellung unter Zuhilfenahme oder Einbeziehung von KI soll darin nicht eingeschlossen werden - KI als verwendetes Mittel zur Kunstherstellung eines Künstlers soll demnach nicht von der dieser Untersuchung zugrundeliegenden KI- Definition eingeschlossen werden.
Diese Vorgehensweise ist deshalb zur Beantwortung der Forschungsfrage angezeigt, weil diese Beantwortung die Fokussierung auf den Aspekt des Schöpfers respektive des Schaffens und nicht den des Geschaffenen erfordert. Diese einseitige Perspektive auf das sich im Sinne der Pythagoreer13 in einem relativen Gegensatz gegenüberstehende Schaffende und Geschaffene auf den schaffenden Schöpfer ist deshalb erforderlich, weil das zur Beantwortung der Forschungsfrage erforderliche Momentum der Freiheit nach Kant nur auf dieser Seite dieses Gegensatzpaares anzutreffen ist.14
Des Weiteren ist der Schöpfer des Kunstwerks von dessen Betrachter abzugrenzen, weil die dem Schaffensprozess zugrundeliegende Freiheit auch hier nach Kant nur auf Seiten des Schöpfers vorliegen kann.15 Da der Betrachter keinen unmittelbaren Anteil am Zustandekommen eines Kunstwerks haben kann, weil er vom Schöpfungsprozess ausgeschlossen bleibt, kann er auch keine freiheitlichen Impulse in diesem Schöpfungsprozess einbringen. Die Frage, ob der Betrachter betrachtend diese Freiheit einzubringen in der Lage sein kann - es gibt Künstler, die ihre Kunstwerke auf diese freiheitliche Einbringung des Betrachters hin anlegen - bleibt hier insofern ohne Relevanz, als diese Freiheit als sekundäres Momentum quasi eine nachgeordnete, weil vom ursprünglichen Schöpfungsprozess zwar intendierte, jedoch nicht unmittelbar realisierte, Freiheit darstellt.
Auch wenn in Beantwortung der Forschungsfrage von der verwendeten abweichende methodische Vorgehensweisen vorstellbar sind, so scheint diese gewählte Vorgehensweise dieser Untersuchung dennoch angemessen, da sie durch ihre klaren strukturellen Vorgaben die vorgebrachten Gedankengänge dem Leser leicht nachvollziehbar vor Augen stellt und somit diesem ihre Evaluation hinsichtlich ihrer logischen Stringenz und sachlichen Angemessenheit erleichtert. Des Weiteren sei darauf verwiesen, dass die der Forschungsfrage dieser Untersuchung zugrundeliegende Problemstellung sowohl wissenschaftlich, genauer: philosophisch, als auch gesamtgesellschaftlich bislang eher weniger Beachtung gefunden hat und daher ein breites Arsenal möglicher methodischer Ansätze - speziell zu dieser Fragestellung - noch nicht vorliegt, auf das zurückgegriffen werden könnte.
2 Verortung der Forschungsfrage
2.1 Die philosophiehistorische Einordnung der Forschungsfrage in der Traditionslinie des Kunstbegriffs: Von der rè/yn zur schönen Kunst Kants
Im Vorwort seiner Logik verweist Kant darauf, dass die Logik als wissenschaftliche Disziplin seit Aristoteles keine Fortschritte habe machen können.16 Würde Kant diese Aussage in gleicher Weise für die Kunst bzw. Ästhetik gelten lassen? Schließlich stehen nicht nur Kants Logik, sondern auch seine Überlegungen zur Frage der schönen Kunst in einem philosophiehistorischen Zusammenhang: Was zwei Jahrtausende vor Kant als „réxvq“
Einzug ins philosophische Denken gefunden hat, gipfelt für Kant im Begriff der „schönen Kunst“.
Um den kantischen Kunstbegriff systematisch zu analysieren, ist es erforderlich, dessen historische Voraussetzungen zu beleuchten. Dabei darf nicht aus dem Blick geraten, dass die kantische Konzeption der sogenannten „schönen Kunst“ den seit dem 19. Jahrhundert im europäischen Denken üblichen Gebrauch des Begriffs „Kunst“ nicht kennt und im Gegensatz zu dem späteren Kunstbegriff zwischen „Kunst im Allgemeinen“ und „schöner Kunst im Besonderen“ unterscheidet. Diese Unterscheidung ist deshalb bedeutsam, weil sie die Einbettung des kantischen Begriffs der „schönen Kunst“, dessen Prämissen, seinen vorausgesetzten Sprachgebrauch und dessen philosophische, schulmäßige Tradition darzulegen vermag.17
Im Sinne dieser philosophiehistorischen Einbettung soll im Folgenden die Traditionslinie des kantischen Kunstbegriffs von der griechischen und römischen Antike, über Scholastik und Renaissance bis hin zur Ästhetik der Aufklärung des 18. Jahrhunderts in einem kurzen Aufriss dargestellt werden.
Der europäischen Tradition des Kunstbegriffs - und damit auch dem kantischen - liegt das griechische „rëyyn“ zugrunde, dessen ursprüngliche konzeptionelle Auffassung auf Homers Ilias beruht und unter rsyyn „handwerkliches Können“ meint.18 Kennzeichnend für die Antike ist dabei, Kunst nicht als spezifische Art der Schönheit wahrzunehmen, sondern unter rsyyn unterschiedliche menschliche Tätigkeiten wie Wissenschaft, Handwerk, Kunstfertigkeit und eben auch Kunst zu subsumieren.19 Damit kennzeichnet der altgriechische re/vn-Begriff eine fundamentale Unterscheidung zwischen menschlich Geschaffenem und natürlich Entstandenem, wobei der Mensch im Sinne der natura artis magistra sich stets seiner Naturbezogenheit bewusst bleibt.20
Eine Ausweitung des reyvn-Begriffs erfolgt durch Platon in seinen Werken Politeia und Symposion, in denen er seine Schönheitstheorie in seine Ideenlehre einbettet und somit Kunstwerke in zwiefacher Hinsicht als Abbilder ursprünglicher Ideen auffasst: Das Kunstwerk wird zur Manifestation des Schönen, Guten und Wahren, das der Künstler in seiner ursprünglichen Idee zu schauen und in der konkreten Sinnenwelt auszuformen 21 vermag.
Im Gegensatz zu den ontologischen Fragestellungen Platons, begründet Aristoteles das handlungstheoretische Paradigma in der Kunstphilosophie. In seiner Poietike rückt Aristoteles die jj.ip.noiq in den Mittelpunkt der Betrachtung seines Kunstbegriffs und spricht den Künsten durch ihren nachahmenden Charakter nicht nur Erkenntniswert zu, sondern auch die Fähigkeit, durch durchlebte Leidenschaften zu läutern (K&Oapoiq): Das Schöne ist bei Aristoteles das Angemessene und Wohlgestaltete.21 22
Damit grenzen sich Platon und Aristoteles in ihren Kunstdefinitionen insofern von vorausgegangenen Kunstbegriffen ab, als sie die ursprünglich kaum getrennten Begriffe èmornpn und Tsyyn - die bislang unter dem Begriff rs/yn subsumiert worden waren - gegeneinander abzugrenzen beginnen: Das Schöne beginnt sich philosophiehistorisch vom Wahren abzuheben. èmornpn wird bei Aristoteles zum Erkennen der Welt des Wahren, wohingegen die Tsyyn die davon getrennte Welt des Machbaren bezeichnet - Denken und Gestalten werden unterschiedlichen Bereichen des Menschseins zugeordnet.23
Im Hellenismus und der römischen Antike bleibt die Idee der Nachahmung, der pipnoiq, und damit die praktische Seite der Kunst relevant. In diesem Sinne werden Kunstwerke in dieser Zeit primär in ihrer Gegenständlichkeit und in ihrer expressiven Wirkmächtigkeit betrachtet. So kann Cicero Kunst nicht mehr als Nachahmung der Natur, sondern Nachahmung der Tradition auffassen und Dionysius von Halikarnassos die Nachahmung über die stumpfe Kopie hinaus als Angleichen an ein Vorbild begreifen, das nicht lediglich unkritisch imitiert wird. Der Künstler tritt nunmehr verstärkt als Schöpfer hervor, der ein inneres Vorstellungsbild in sich trägt, seine Phantasie ersetzt die Nachahmung der Wirklichkeit als oberstes Gestaltungsprinzip.24
Daneben rückt im ré/v^-Begriff der Sophisten, Sokrates und der Rhetoren neben dem Wissen das Können in den Mittelpunkt der Betrachtung. Hier entwickelt sich die Auffassung, dass das Aufstellen und Erlernen von Regeln für Kunst unabdingbar seien, wobei dieses Kunstverständnis auf einem Zusammenspiel dreier Faktoren basiert: der natürlichen Veranlagung (pvaig, Ingenium), der Übung (exercitatio) und den Regeln, auf denen jede réxyn oder ars gründet. In der Definition Lukians mündet Téxyn in diesem Denkzusammenhang schließlich in ein systematisches Ganzes (avar^pa) von Regeln oder Vorschriften (praecepta).25
Es ist demzufolge nur ein konsequenter Schritt, den die römische Tradition vollzieht, wenn sie die artes liberales, darunter unter anderem Musik, Arithmetik und Dialektik, von den artes mechanicae, dem „niederen Handwerk“ scheidet: In der antiken Kunst hat sich damit die Trennung zwischen Welt des Denkens und Welt des Gestaltens auch begrifflich vollzogen.26
Diese Unterscheidung prägt auch den mittelalterlichen Kunstbegriff, der allerdings um ein wesentliches Merkmal erweitert wird: Gott. War der antike Kunstschaffende ein Individuum, das denkend und erschaffend die gesetzlichen Schönheiten der Natur auszuformen vermochte, wird der mittelalterliche Künstler zum Werkzeug Gottes. Indem er die Schönheit und Vollkommenheit göttlichen Wirkens zu erkennen und wiederzugeben vermag, tritt er als Schöpfer hinter den göttlichen Schöpfer zurück - das Kunstwerk wird zum überpersonalen Lob Gottes.
Mit der Renaissance als Rückbesinnung auf die Antike und die Individualität des Menschen erhält der Künstler einen neuen Stellenwert - seine personale Genialität rückt ins Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Wesen der Kunst: Die gottgegebene Schönheit des mittelalterlichen Kunstwerkes tritt hinter das schöpferische Vermögen genialer Individualität zurück. Spätestens mit Leonardo da Vinci feiern individuelle Genialität und kraftvolles Schöpfungsvermögen des Künstlers ihren Siegeszug in der europäischen Kunstgeschichte.
Unter dem Eindruck eines aufgeklärten Wissenschaftsideals sowie dem Bedürfnis nach einer rationalen Grundlegung der Kunsttheorie, entwickelt sich im 18. Jahrhundert eine Theorie25 26 der Ästhetik, die insbesondere durch Alexander G. Baumgartens Konzeption der Ästhetik im Sinne seiner Theoria liberalium artium oder Gnoseologia inferior die Ästhetik erstmals als genuin philosophische Disziplin auffasst.27
In dieser Auffassung schließt Baumgarten an den antiken Kunstbegriff an und entwickelt ihn insofern weiter, als er Kunst in ein allgemeines philosophisches System einzubetten sucht. Damit wird Baumgarten zu einem wesentlichen Vordenker des neuzeitlichen Kunstbegriffs und zugleich Kants ästhetischer Kritik.28 Kant übernimmt Baumgartens Ansicht, dass das ästhetische Erleben des Schönen auf einer nicht nur sinnlichen sondern auch intellektuellen Leistung beruht und damit zum menschlichen Weltverständnis beiträgt. Allerdings widerspricht Kant aufgrund seiner gegen die rationalistische Erkenntnistheorie gerichteten, prinzipiellen Unterscheidung zwischen Sinnlichkeit und Verstand Baumgartens Postulat einer sinnlichen Erkenntnis.29
In den Vordergrund seiner Kunsttheorie rückt Kant die Frage einer vernünftigen Grundlegung des Ästhetischen und versucht dabei, eine Begründung dafür zu finden, dass das ästhetische Erleben nicht auf die Empfindung des Angenehmen oder empirische Erkenntnis reduzierbar bleibt, weil die schöne Beschaffenheit der Natur sich dem Menschen im ästhetischen Wohlgefallen offenbare. Vielmehr entstammt für Kant das Schöne im Kunstwerk menschlicher Genialität. Da Kunstwerke qua Artefakte, das heißt von Menschen hergestellte Gegenstände, in ihrer Entstehung kausal erklärbar und nach Regeln reproduzierbar sind, kann ihnen das Attribut „schön“ zugesprochen werden, weil der Künstler im Gestaltungsakt die widerstreitenden Prinzipien „Natur“ und „Vernunft“ in einem dialektischen Akt zu überwinden vermag. Deswegen steht Kant vor der Notwendigkeit, in sein kunsttheoretisches Konzept den Begriff des Genies einzuführen - auf seine Genietheorie soll im späteren Verlauf dieser Untersuchung näher eingegangen werden (Abschnitt 3.5).30
Kants Sonderstellung in den Ästhetikanalysen macht sich besonders in der Grundlegung selbiger offenkundig: Seine Analyse des reinen ästhetischen Geschmacksurteils und die darauf basierende Bestimmung des Schönen und der schönen Kunst haben ihren prägnanten Ursprung in seiner Transzendentalphilosophie und nicht in der kunstphilosophischen Debatte seiner Zeit. Da die schönen Künste allgemein aber auch ihre jeweilige Einteilung und Zuordnung im Besonderen durchaus prominent im Kulturbewusstsein des 18. Jahrhunderts gegeben sind, ist diese transzendentalphilosophische Grundlegung weniger dem Umstand geschuldet, dass Kant seine konzipierten Bestimmungen von Geschmack und Schönheit am Stand des kunstphilosophischen Diskurses seiner Zeit vorbeispekulieren will. Vielmehr bemüht sich Kant, die Leistungsfähigkeit seiner Transzendentalphilosophie auch auf diesem Kulturgebiet unter Beweis stellen möchte.31
Aber bereits an dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass Kant in der Definition dessen, was unter „Genie“ zu verstehen sei, von der seinerzeitigen Begriffsverwendung abweicht: Die Sturm und Drang-Epoche begreift „Genie“ als natürliches Talent, das unter Beachtung der tradierten Regeln einer Kunstgattung das Kunstwerk in einem originär-individuellen Akt zu erschaffen vermag, das eben nicht bloß neuartig sondern zugleich exemplarisch ist und dadurch den Raum des Möglichen in einer Kunstgattung verändert.32
Demgegenüber scheint Kants „Genie“-Definition insofern von der Alexander Gérards in dem Werk Essay on Genius aus dem Jahr 1774 beeinflusst zu sein, als sie sich systematisch der Frage nach dem Schönen zuwendet und dabei einer kritischen Vorgehensweise verpflichtet bleibt: Die individuelle schöpferische Genialität, der Kants Zeitgenossen größtenteils huldigten, wird von dem Königsberger Denker systematisch um eine rationale Dimension erweitert: Erst durch diese vernünftige Grundlegung kann natürliche Schönheit zur schönen Kunst aufsteigen.33
Für den philosophischen Sprachgebrauch Kants bleibt die Unterscheidung der Begriffe „Kunst“, „Kunstwerk“ und „Künstler“ sowie deren Rückbezug auf die antike Trennung von Téyyn und von entscheidender Bedeutung.34 Dass der prägnante Gebrauch der
Begriffe „Kunst“, „Kunstwerk“ und „Künstler“ zeitgenössisch weite Verbreitung findet, ist vor allem der romantischen Denkart bei Friedrich Schiller, Johann W. von Goethe und Georg W. F. Hegel zuzuschreiben. In dem Zuge gerät die Verwendung des Kunstbegriffs im allgemeinen Sinne in Vergessenheit. Doch wenn in der folgenden Untersuchung mit Kant von „Kunst“, „Künstler“ und „Kunstwerk“ gesprochen wird, dann ist nicht an diese romantische Deutung zu denken, obwohl diese zu Zeiten Kant stets und wohl auch noch bei Hegel, das Epitheton „schön“ bzw. „ästhetisch“ erfordert.35
Aus dem bislang Dargelegten lässt sich nunmehr festhalten, dass Kant in seinem kritischen Denken der Ästhetik einerseits in eine kulturhistorische Linie einzuordnen ist, die ihre Anfänge in der griechisch-römischen Antike hat, gleichzeitig jedoch den seit der beginnenden Neuzeit zunehmend wichtiger werdenden Aspekt des Genialen in der Kunst dadurch systematisch zu integrieren vermag, dass er rs/yn und smor^^n in seinen Überlegungen zur Ästhetik zu vereinen versteht: In Kants „schöner Kunst“ wird die Genialität des schöpferischen Individuums dialektisch in ihrer rationalen Denkweltbezogenheit gedacht. Im Fortgang der Untersuchung soll diese schöne Kunst im kantischen Sinne Gegenstand der nachfolgenden Überlegungen hinsichtlich ihrer Bezüglichkeit zur KI schwerpunktmäßig erörtert werden.
Weil das kantische Prinzip der schönen Kunst nicht ohne dessen zugrundeliegende epistemologischen Gedankengänge verständlich ist, ist es erforderlich, Kants Denken der schönen Kunst in seinem kritischen Gesamtwerk zu verorten.
2.2 Die Stellung der Kritik der Urteilskraft im kritischen Gesamtwerk Kants
Seine Theorie der schönen Kunst handelt Kant im Wesentlichen in seiner Kritik der Urteilskraft ab. Deswegen soll in diesem Abschnitt die Stellung der Kritik der Urteilskraft im kritischen Gesamtwerk Kants, sowie eine kurze philosophiehistorische Einordnung des kritischen Gesamtwerk Kants, vorgenommen werden.
Das am Zweck (rékog) orientierte, teleologische Denken des Abendlandes, das die Philosophie seit Aristoteles beherrscht, wird in der Neuzeit von der kausalen (mechanischen) Betrachtungsweise verdrängt. Dieses Denken in Ursache-Wirkungszusammenhängen hat zu Kants Zeiten bereits wichtige „Siege“ errungen, etwa in der Hobbeschen Philosophie, der französischen Aufklärung oder der Physik Galileo Galileis und Isaac Newtons. Es erlebt seinen Zenit in Julien Offray de La Mettries L ’homme machine. Kant stellt seine Philosophie nicht in die antiaristotelische Tradition der Neuzeit, räumt er der Teleologie doch einen wichtigen Platz ein und verbannt keineswegs alles zweckorientierte Denken.36 Kant reiht sein kritisches Denken in den - wie er selbst es sieht - „veritablen Grundlagenstreit“37 der europäischen Aufklärung ein, der zwischen den beiden philosophischen Richtungen seiner Zeit, dem Rationalismus von René Descartes, Benedictus de Spinoza und Gottfried W. Leibniz und dem Empirismus von John Locke und David Hume entbrannt war. Kant schließt sich keiner dieser beiden Richtungen an, sondern versucht, über diesen Diskurs hinausgehend, die Frage zu beantworten, ob reines erfahrungsfreies Denken möglich sei und was selbiges gegebenenfalls zu leisten vermöge.38
Diese Prüfung von Grenzen und Möglichkeiten des Erkennens soll nach Kant Legitimation und Limitation menschlichen Denkvermögens aufzeigen, weshalb Kant von „transzendentaler Kritik“39 spricht, weil er die Bedingungen der Denkmöglichkeit aus streng apriorischen Prinzipien abzuleiten versucht.40
Das aristotelisch basierte Denken in Zweckbegriffen bildet dabei einen integralen Teil der kantischen transzendentalen Vernunftkritik. So stellt Kant einerseits den bloß subjektiven Charakter teleologischer Urteile vor, andererseits finden sich diese Urteile in all seinen Hauptschriften.41 Bei der theoretischen Vernunft geht es ihm dabei um objektive menschliche Erkenntnis, bei der praktischen Vernunft um das Begehrungsvermögen des Menschen.42 Die erste Kritik, die Kritik der reinen Vernunft (1781), weist in diesem Sinne die Voraussetzungen der nachfolgenden kritischen Grundlegungen einer Philosophie der Praxis, des Rechtes und der Tugend aus, ihr folgen die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) und die Kritik der praktischen Vernunft (1788) nach.43
In der Kritik der reinen Vernunft verpflichtet sich die Lehre von den regulativen Ideen dem Vernunftzweck einer schlechthin vollständigen Erkenntnis.44
Nach Otfried Höffe übersieht die dominante vornehmlich erkenntnistheoretische Interpretation - besonders der Kritik der reinen Vernunft -, dass es bereits der ersten Kritik letztlich auf Moral ankommt: Um die Hindernisse der Moral zu überwinden, richtet sich die erste Kritik vornehmlich auf die theoretische, auch „spekulativ“45 genannte, Vernunft und prüft die Möglichkeit einer rein objektiven Erkenntnis.46
Auch die zweite Kritik, die Kritik der praktischen Vernunft, befasst sich mit der Frage, ob es eine Objektivität im Handeln, die „Moral“ genannt wird, gibt.47 Die Kritik der praktischen Vernunft basiert mit ihrer Postulatenlehre auf der teleologischen Idee der Einheit von Glückswürdigkeit und Glückseligkeit.
Die kantische Geschichts- und Rechtsphilosophie sieht den Endzweck („Sinn“) der Geschichte im ewigen Frieden. Doch den Höhepunkt teleologischen Denkens erreicht Kant in der Kritik der Urteilskraft:48 Zwei Jahre nach der zweiten Kritik stellt Kant seine Kritik des dritten Grundvermögens vor: Die Kritik der Urteilskraft soll sein ganzes kritisches Geschäft abschließen.49 Die Urteilskraft spielt zwar schon in den ersten beiden Kritiken eine erhebliche Rolle, in der dritten erörtert Kant jedoch vor allem die reflektierende Urteilskraft, die das Besondere aus dem Allgemeinen abzuleiten sucht und der er den Gedanken der Zweckmäßigkeit zugrunde legt. Die Zweckmäßigkeit wird dann in den beiden Bereichen des Ästhetischen - dem Schönen und dem Erhabenen - zum Gegenstand kritischer Untersuchung. Die reflektierende Urteilskraft subsumiert also das Besondere unter ein Gesetz, das noch näher zu bestimmen bleibt. Interessant dabei, dass Kant der Zweckmäßigkeit die Eigenschaft eines transzendentalen Prinzips zuspricht, wodurch er das Vermögen der Urteilskraft entscheidend aufwertet. Dieser Gedanke muss bei der Analyse und Interpretation des Ästhetischen und auch bei der Frage nach dem Schönen und somit im Fortgang der vorliegenden Untersuchung stets im Hinterkopf behalten werden.50 Doch bereits vor der Kritik der Urteilskraft beschäftigt Kant in seinen 1764 publizierten Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen diese Fragestellung.51 Auch wenn der Kritik der Urteilskraft - sowohl im Universalkanon der klassischen Philosophie als auch innerhalb Kants Gesamtwerks - oft weniger philosophische Relevanz als den beiden anderen Kritiken Kants zugesprochen wird, bleibt das darin entwickelte45 46 47 48 49 50 51
Konzept der Zweckmäßigkeit, der Ästhetik und die in ihr enthaltene Theorie der schönen Kunst sowohl philosophiehistorisch als auch werksystematisch essenziell.52 Dass die Kritik der Urteilskraft in der modernen Kantdiskussion weniger Beachtung findet, als seine anderen Werke, liegt unter anderem darin begründet, dass ihre Sachthemen an Bedeutung verloren haben: Das Beforschen der Ästhetik ist in der Philosophie seltener und weniger en vogue geworden, das teleologische Denkkonzept in den Naturwissenschaften fast vollkommen verschwunden.53
Zur weiteren Eingrenzung der Forschungsfrage soll daher im folgenden Abschnitt die Stellung der schönen Kunst im Aufbau der Kritik der Urteilskraft in den Fokus gerückt werden.
3 Was ist schöne Kunst im kantischen Sinne?
3.1 Die Stellung der schönen Kunst in der Kritik der Urteilskraft
In seiner Kritik der Urteilskraft untersucht Kant unter anderem das Schöne im Allgemeinen und die schöne Kunst als Werk des Genies im Besonderen. Die methodische Pointe Kants Gesamtuntersuchung liegt darin, dass er den Aspekt des Ästhetischen im Sinne der sogenannten „kopernikanischen Wende“54 angeht, was die kantische Ästhetik von den ihr vorangegangen ästhetischen Konzeptionen methodisch grundlegend unterscheidet.55 Bei dem elementarästhetischen Wertbegriff des Schönen fragt Kant nach den Bedingungen der Möglichkeit seiner Erfahrung im erlebenden Subjekt. Mit den begrifflichen Mitteln der Vernunftkritik verifiziert Kant seine These, dass das Schöne kein objektimmanentes Prädikat darstellt, sondern sich im ästhetischen Urteil bezüglich der Schönheit eines Objektes, dem sogenannten „Reflexionsurteil“56, dem Gefühl der Lust über das wahrgenommene Objekt, manifestiert. Das Urteil über das Schöne und damit einhergehend der Begriff des Schönen, beziehen sich für Kant stets auf ein „Lebensgefühl“57 des Subjektes.58 Dieses Lebensgefühl des Subjektes wird für Kant zum archimedischen Punkt seiner Theorie der schönen Kunst, die er im zweiten Teil der sogenannten Deduktion der reinen ästhetischen Urteile vorstellt. Ausgehend von seiner Analyse des Geschmacksurteils entwickelt Kant diese Theorie weiter, indem er den Begriff des „Interesses“ in die Theoriebildung einführt. Der Begriff des „Interesses“ ermöglicht Kant den methodische Konnex zwischen Geschmacksurteil und dem Schönen: Durch das Interesse wird das Geschmacksurteil, das auf einem „interesselosen Wohlgefallen“59 gründet, als Lust an der Existenz zur Lust an der Existenz des schönen Gegenstandes und insofern zur Lust am Schönen. Dadurch schafft Kant im Begriff des Interesses die Voraussetzung einer Charakteristik der Kunst, bzw. deren Bedeutsamkeit, sowie deren argumentationslogische Schlüssigkeit innerhalb der Systematik der Kritik der Urteilskraft. Diese Differenzierung steht im Gesamtzusammenhang des kantischen Anspruchs, eine strukturelle Verbindung der Disposition des Menschen zum Ästhetischen mit der zum Moralischen aufzuzeigen. Dafür will Kant das Schöne als Bindeglied zwischen empirischem und moralischem Erkenntnisvermögen theoretisch etablieren.60
Diese Einordnung von Kants theoretischen Überlegungen zum Schönen in dessen Gesamtwerk sei hiermit abgeschlossen, gilt doch der Fokus der vorliegenden Untersuchung dem Schönen in Bezug auf das Kunstwerk und dessen Schöpfer und weniger den epistemologischen Implikationen eines theoretischen Konzepts, das in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kants Werk ohnehin bereits vielfach erörtert worden ist.61
Nachdem nun in einem ersten Schritt das Konzept der schönen Kunst Kants in den philosophiehistorischen Zusammenhang gesetzt, in einem zweiten die Stellung der schönen Kunst im kritischen Gedankengebäudes Kant herausgestellt und in einem dritten die Stellung der schönen Kunst in der Kritik der Urteilskraft analysiert wurde, kann nun in den Abschnitten 3.2-3.5 erörtert werden, wie das Genie schöne Kunst nach Kant erschafft.
3.2 Was ist schön? Das Schöne als Produkt des ästhetischen Geschmacksurteils
Das Wertprädikat „schön“ entwickelt Kant systematisch in seiner Analytik des Schönen im Kontext der Analytik der ästhetischen Urteilskraft in der Kritik der Urteilskraft in den sogenannten vier „Momenten“62 des Geschmacksurteils.63
Der Geschmack ist für Kant das Vermögen zur Beurteilung des Schönen.64 Das Schöne grenzt Kant vom Logischen, sowie von anderen Wertprädikaten, etwa vom Angenehmen, vom Nützlichen, vom Guten und vom Erhabenen ab und bestimmt es als Modus eines „rein ästhetischen Wohlgefallens“65. Dieses rein ästhetische Wohlgefallen vermag die ästhetische Qualität eines Objekts zu erfassen und bei dem das Objekt wahrnehmenden Menschen durch bloße Betrachtung Gefälligkeit zu evozieren.66
In diesem Sinne erhebt das Urteil über das Schöne im Gegensatz zum Urteil über das Angenehme eine normativ notwendige Forderung nach allgemeiner Zustimmung: Beispielsweise ist das Urteil über das Wohlschmecken eines Apfels der Forderung nach allgemeiner Zustimmung enthoben, das Urteil über dessen Schönheit hingegen bleibt an diese Forderung gebunden.
Die im Zuge der Betrachtung der ästhetischen Urteile von Kant entwickelten vier Momente der Analytik lauten:
(1) Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.67
(2) Schön ist, was ohne Begriff allgemein gefällt.68
(3) Schönheit ist die Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie, ohne Vorstellung eines Zwecks, an ihm wahrgenommen wird.69
(4) Schön ist das, was ohne Begriff als Gegenstand eines notwendigen Wohlgefallens, erkannt wird.70
Daraus folgt: Die Schönheit eines Gegenstandes besteht für Kant in der positiven ästhetischen Anmutung eines Gegenstandes, durch welche jener in der bloßen Betrachtung gefällt.71
Bei Kant findet sich also eine Analyse des Urteils über das Schöne, die ein solches Urteil durch eine sehr spezielle Erkenntnisbeziehung auszeichnet. Doch, wie eben bereits ausgeführt, findet dabei keine Erkenntnis statt, weshalb auch nicht von einer „Wissenschaft des Schönen“ gesprochen werden kann, denn in ihr würde „wissenschaftlich, d. i. durch Beweisgründe ausgemacht werden sollen, ob etwas für schön zu halten sei oder nicht; das Urteil über Schönheit würde also, wenn es zur Wissenschaft gehörte, kein Geschmacksurteil sein“72.73 Apriorisch ist diese „Stimmung“ von Anschauung und Verstand, die eben als Grundlage des Urteils über das Schöne angesehen werden kann, nicht auszumachen. Wenn auch das Urteil dann, wenn es gefällt, den Anspruch auf Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit erhebt, den es gleichzeitig jedoch nie einzulösen in der Lage ist.74
Geschmacksurteile an sich sind für die weitere Untersuchung nicht weiter von Bedeutung, geht es doch bei der Forschungsfrage, wie bereits einführend erläutert, nicht um die Rezipienten- sondern die Produktionsperspektive.
Dass diese beiden Perspektiven im Moment der Urteilsbildung des Geschmacksurteils über die schöne Kunst zusammenfallen, liegt an ihrem sich im Produkt des genialen Schöpfungsaktes als Kunstwerk manifestierenden gegensätzlichen Aufeinanderbezogensein:75 Im relativen Gegensatz entsteht Eines aus dem Anderen und kann nicht ohne das Andere gedacht werden. Deshalb lassen sich die beiden Seiten trotz ihres inneren Bezugs trennscharf voneinander abgrenzen, denn zur Beurteilung schöner Gegenstände, als solcher, wird Geschmack benötigt, zur Hervorbringung schöner Gegenstände, und damit auch der schönen Kunst, wird Genie erfordert. Durch Kants urteilsorientierte und subjektbezogene Analyse des reinen ästhetischen Geschmacksurteils70 71 72 73 74 75 lässt sich allerdings sein Prinzip zur Systematisierung schöner Künste nur auf Seiten der Produktion finden, obwohl die Rezipientenseite immanent stets mitgedacht wird.76
3.3 Was ist Kunst? Kunst in Abgrenzung zu Natur, Wissenschaft und Handwerk
Kant scheidet Kunst allgemein zunächst einmal im Stile einer Arbor porphyriana in Abgrenzung zur Natur als Kunstprodukt zum Naturprodukt, in Abgrenzung zur Wissenschaft als praktisches zum theoretischen Vermögen und in Abgrenzung zum Handwerk als freies Spiel zur Lohnkunst.
In Kants Philosophie der Kunst findet dasjenige Anwendung, was in der Analyse der Struktur des ästhetischen Urteils gefunden wurde. Durch und mit jenem Urteil wird Natur nicht mehr nur als Mechanismus aufgefasst, sprich einem Zusammenhang von Ursache und Wirkung, dessen Notwendigkeit den Erscheinungen selbst und nicht dem Beurteilungsvermögen zugesprochen wird. Vielmehr wird Natur und ihre Erscheinung als Kunst angesehen. Wobei Kunst in diesem Zusammenhang als stimmiges Verhältnis der Fähigkeit zu Anschauungen (Anschauungsvermögen) zur Fähigkeit zur Begriffsbildung (Verstand) meint, ohne dass dieses Verhältnis in einer begrifflichen Bestimmung der Welt terminiert würde. Gemäß dieser Bestimmung der Struktur des ästhetischen Urteils unterscheidet Kant Kunst von Natur wie folgt:77 „Kunst wird von der Natur, wie Tun (facere) vom Handeln oder Wirken überhaupt (agere), und das Produkt, oder die Folge der erstern als Werk (opus) von der letzern als Wirkung (effectus) unterschieden.“78 Mit dieser Aussage will Kant auf die Auswirkungen von Kunst und Natur auf der Handlungsebene und auf der Ebene des Ergebnisses von Handlungen verweisen: Während Kunst durch Tun Werke erschafft, bringt die Natur durch Wirken Wirkung hervor.79
Diese Unterscheidung resultiert aus dem, was für Kant fundamentale Voraussetzung von Kunst ist: Die schaffende Freiheit des menschlichen Künstlers. Nur durch eine Hervorbringung durch Freiheit, also durch Willkür, die der Handlung Vernunft zum Grunde legt, kann ein Kunstwerk geschaffen werden. Natürlich Geschaffenes ist nicht Produkt einer Vernunftüberlegung und kann damit keinem Schöpfer zugeschrieben werden, sondern bleibt Produkt eines natürlichen Instinktes.80
Damit offenbart sich in Kants Kunsttheorie der Begriff der Freiheit als von zentraler Bedeutung, der auch in seiner Ästhetik bereits eine herausgestellte Position eingenommen hat. Den Begriff der Freiheit hat Kant in seiner Moralphilosophie als eine Maximenbestimmung durch Verallgemeinerungsprüfung eingeführt, wobei dabei allerdings auf die Freiheit des Willens abgezielt wird.81
Doch geht es in der Kunst und dem sie Schaffenden nicht um Freiheit des Tuns und nicht um eine Freiheit des Willens? Diese Frage lässt sich nicht so ohne Weiteres beantworten. Auf den Aspekt der Freiheit im Kunstschaffen bei Kant und über ihn hinaus soll im weiteren Verlauf dieser Untersuchung nochmals ausführlich eingegangen werden. An dieser Stelle lässt sich jedoch schon einmal darauf hinweisen, dass Kant, wenn er von Freiheit des Kunstschaffens bzw. der Willkür des Künstlers spricht, analog zu seiner Moralphilosophie, auf die Differenz zu den Ursache-Wirkung-Zusammenhängen der Natur abzielt. Diesem Reich von Ursache und Wirkung, d. i. das Reich der Natur(-kausalität), stellt Kant das Reich der Freiheit entgegen, dem die Kunst zuzuschreiben ist und das „aufgrund seiner an der universellen Kausalität der naturwissenschaftlichen Weltauffassung orientierten Erkenntnisbestimmung als jenseits des Reiches von Ursache und Wirkung bestehend angesehen muss.“82 Daraus folgt: Kunst entsteht auf Grundlage von Zwecken. Der Künstler - oder wie Kant ihn nennt: „die hervorbringende Ursache derselben“83 - „hat sich einen Zweck gedacht, dem dieses seine Form zu danken hat“84.85
Das Denken, das dem Kunstwerk vorsteht, lässt sich nach Kant nicht innerhalb eines natürlichen Kausalzusammenhangs beschreiben. Dieses Denken lässt sich wiederum als Analogie zu dem „Wirken überhaupt“ der Natur ansehen, durch das eine Wirkung (effectus) entsteht, die wiederum selbst nicht kausal zu beschreiben und zu verstehen ist, da sie selbst einem Denken entspringt, welches nicht zu jener begrifflichen Erkenntnis führt, in der der reine Verstandesbegriff der Kausalität Anwendung finden müsste.86
Als Beispiel führt Kant die anmutigen regelmäßigen Bienenwaben an, deren Bezeichnung als „Kunstwerk“ nur als Analogie treffend wäre, produzieren die Bienen die Waben doch nicht anhand getroffener Vernunftüberlegungen, also aus Hervorbringung durch Freiheit, sondern werden durch Naturinstinkt zu dieser Hervorbringung affiziert.87 Das Beispiel kann zugleich der Unterscheidung von eigentlicher und uneigentlicher Form der Rede dienen: Nur einer äußeren Ähnlichkeit willen wird irrtümlich auch dasjenige als „Kunstwerk“ bezeichnet, das keine Willkür, also bewusstes Gestalten, zur Ursache hat, sondern lediglich die Anmutung eines Kunstwerkes herzustellen vermag. Ein Naturschönes als Kunstschönes zu bezeichnen ist also nicht rechtmäßig.88 In diesem Sinne wäre Kant sicherlich nicht bereit, der gefälligen Waldblume den Status „Kunstwerk“ zuzusprechen.
Auf diese allgemeine Unterscheidung zwischen Kunstwerk und Naturhervorbringung lässt Kant eine weitere Unterscheidung folgen, nämlich die zwischen Kunstwerk und Wissenschaft, die er beide als Ausfluss der Geschicklichkeit des Menschen betrachtet. Er unterscheidet demnach die Kunst von der Wissenschaft als praktisches von theoretischem Vermögen, als Technik von Theorie, als Können von Wissen.89 An dieser Stelle ist es hilfreich, auf die bereits oben in der philosophiehistorischen Einordnung der Forschungsfrage eingeführte Unterscheidung zwischen réxyn und èmor^pn zu erinnern, wobei Kant im aristotelischen Sinne réxvq als praktisches und ènwrqpq als theoretisches Vermögen auffasst. Auf die Unterscheidung zwischen Können und Wissen übertragen, bleibt für Kant nur das Kunst, was auf „das Vollständigste“90 erkannt wird und dessen Entstehen nicht lediglich auf „Geschicklichkeit“91 zurückzuführen bleibt.92 Was Kant damit meint, lässt sich mit einem prominenten Vorfall der jüngsten Kunstgeschichte illustrieren. Einigen Kunstkritikern wurden die „Werke“ von Schimpansen vorgelegt, die jene in ihrer Kunsthaftigkeit würdigen sollten.93 Entgegen dem Befund des einen oder anderen Kunstkritikers wäre Kants Urteil eindeutig: Weil lediglich mit „Geschicklichkeit“ und bar jedes Erkennens zustande gekommen, wären die Schimpansenwerke selbstverständlich nicht als „Kunst“ anzusehen.
Und doch muss ein gewisses praktisches Vermögen beim Kunstschaffenden vorhanden sein. Dabei ist für Kant das Kunstschaffen vom Handwerkskunstschaffen darin zu unterscheiden, dass die Kunst „frei“94 und das Handwerk „Lohnkunst“ sei. Kunst ist demnach „Spiel“95 und als Beschäftigung für sich selbst angenehm, wobei sie durchaus auch zweckmäßig ausfallen („gelingen“96 ) kann. Handwerk hingegen ist „Arbeit“ und als Beschäftigung für sich selbst unangenehm sowie durch seine Wirkung, meistens den Lohn, „anlockend“, mithin zwangmäßig auferlegt.97
Denn die Freiheit des Kunstschaffens schließt das Können nicht aus, durch das den Regeln des Kunstschaffens Folge geleistet wird und sowohl das Kunstschaffen als auch das Kunstprodukt in einen hypothetischen Zusammenhang gesetzt wird.98 Beispielhaft lässt sich das an dem Werk „Ansicht von Delft“ von Jan Vermeer verdeutlichen, das um 1660 entstanden sein muss. Wie der Name bereits vermuten lässt, zeigt das Gemälde eine Abbildung der Stadt Delft, in der zwischen dramatisch aufgetürmten Wolkenformen der hintere Teil der Stadt von herabstoßendem Sonnenlicht beschienen wird, während der vordere Teil im Schatten liegt. Besonders hell angestrahlt ist dabei der Turm der Nieuwe Kerk, in dem Wilhelm von Oranien, bekanntermaßen das Symbol des Widerstandes gegen die spanische Herrschaft, begraben liegt. Diese Beeinflussung der Blickführung des Betrachters ist nicht zufällig geschehen. Vielmehr handelt es sich dabei um ein politisches Statement des niederländischen Malers, der oftmals durch seine Kunst Stellung zu vielfältigen gesellschaftlichen Themen Stellung bezieht.99 Das Beispiel zeigt: In Vermeers „Ansicht von Delft“ trifft die politische Gesinnung Vermeers, seine Intention und sein handwerkliches Können, dies in verständlicher Weise auf die Leinwand zu übertragen, auf den verständigen Betrachter, bei dem die intendierte Stimmung ausgelöst wird.
Kant spricht in diesem Zusammenhang vom „Körper“ des freien Geistes der Kunst. Dieser Körper umfasst den Zwang, der auch in der Kunst enthalten sein muss, also einem Mechanismus.100 Oder um es mit Kants Worten zu sagen:
Dass aber in allen freien Künsten dennoch etwas Zwangmäßiges oder, wie man es nennt, ein Mechanismus erforderlich sei, ohne welchen der Geist, der in der Kunst frei sein muss und allein das Werk belebt, gar keinen Körper haben und gänzlich verdunsten würde, ist nicht unratsam zu erinnern (z. B. in der Dichtkunst die Sprachrichtigkeit und der Sprachreichtum, imgleichen die Prosodie und das Silbenmaß).101
Um den bislang entwickelten Gedankengang zusammenzufassen, lässt sich Kants Kunstbegriff allgemein gegenüber Natur, Wissenschaft und Handwerk wie folgt abgrenzen:
(1) Kunst ist stets Hervorbringung durch Freiheit und Produkt einer Vernunftüberlegung, wohingegen natürliche Hervorbringungen stets Produkte eines natürlichen Instinktes bleiben.102
(2) Kunst basiert auf praktischem Vermögen, Technik und Können, wohingegen Wissenschaft auf theoretischem Vermögen, Theorie und Wissen gründet.103
(3) Kunst ist immer für sich selbst angenehmes Spiel, selbst wenn es Zweckmäßiges hervorbringt, Handwerk dagegen zwangmäßig auferlegte Arbeit, die als Tätigkeit für sich unangenehm ist und lediglich des Lohnes wegen erfolgt.104
3.4 Was ist schöne Kunst? Schöne Kunst in Abgrenzung zu mechanischer und zu angenehmer Kunst
Über diese Abgrenzung gegenüber Natur, Wissenschaft und Handwerk entwickelt Kant seinen Kunstbegriff weiter, indem er Kunst allgemein feiner unterteilt: Er scheidet Kunst in ästhetische und mechanische, wobei die ästhetische weiter in angenehme und schöne Kunst unterteilt wird.
Im Folgenden soll diese Unterteilung näher ausgeleuchtet werden. Den Anfang macht dabei die mechanische Kunst. Für Kant verdanken Werke der mechanischen Kunst ihr Entstehen primär der Beherrschung von Regeln, Kenntnissen, Wissen sowie der Anwendung erlernter Fertigkeiten.105
Dieser mechanischen Kunst stellt Kant in einem nächsten Unterscheidungsschritt die ästhetische Kunst gegenüber, die im Gegensatz zu mechanischer Kunst das Gefühl der Lust zur unmittelbaren Absicht hat. Nach dieser Unterscheidung teilt er die ästhetische Kunst weiter in angenehme und schöne Kunst auf. Angenehme Kunst hat als Zweck, „daß die Lust die Vorstellung als bloße Empfindungen [...] begleite.“106 Schöne Kunst hingegen hat als Zweck, „daß sie dieselben als Erkenntnisarten begleite.“107 Der Unterschied zwischen schöner und angenehmer Kunst besteht somit darin, dass angenehme Kunst den reinen Genuss zum Zweck hat, wohingegen schöne Kunst eine Vorstellungsart ist, die für sich selbst zweckmäßig und, wie bereits bei der Erläuterung des Schönen erwähnt, ohne Zweck bleibt und dennoch gleichzeitig „die Kultur der Gemütskräfte zur geselligen Mitteilung befördert“108. Ästhetische Kunst muss als schöne Kunst demnach nach Kant die allgemeine Mitteilbarkeit einer Lust in ihrem Begriff mit sich führen, die eine Lust der Reflexion sein muss und nicht eine Lust aus „bloßer Empfindung“109 bzw. eine „Lust des Genusses“110. Schöne Kunst als ästhetische Kunst ist folglich diejenige Kunst, welche die reflektierende Urteilskraft zum Richtmaß hat, in Polarität zu angenehmer Kunst als ästhetische Kunst, die die Sinnenempfindung zum Richtmaß hat.111
Im weiteren Fortgang seiner Unterscheidung behauptet Kant, dass „[a]n einem Produkte der schönen Kunst man sich stets bewußt werden [muß], daß es Kunst sei und nicht Natur; aber doch muß die Zweckmäßigkeit in der Form desselben von allem Zwange willkürlicher Regeln so frei scheinen, als ob es ein Produkt der bloßen Natur sei.“112 Nach Kant muss sich im Kunstschönen also der Rezipient stets der Tatsache bewusst bleiben, dass es sich um ein künstlerisches Werk- und eben nicht um ein natürliches Produkt handelt. Schöne Kunst steht demnach in einem ambivalenten Verhältnis zum Naturschönen. An einem Kunstwerk muss man sich stets bewusstwerden, dass es Kunst ist - und nicht Natur.
Diese Analogie zwischen Kunst und Natur ist dabei keine uneigentliche Form der Rede, bezeichnet sie doch eine für die Kunst konstitutive Form ihrer Wahrnehmung. Dennoch muss das Kunstschöne für Kant so scheinen, als sei es Wirkung der bloßen Natur. Diese Als-ob- Struktur produziert ergo keine uneigentliche Redeweise, vielmehr wird sie zu einer konstitutiven Voraussetzung des Kunstschönen schlechthin.113
Daraus folgt: Versteht man Kunst nur als Mechanismus, ist sie nichts als Technik. Im Gegensatz dazu würde eine rein ästhetische Kunst - hier im Sinne einer sinnlichen - jedoch auch noch nicht jenes Analogon zum Naturschönen vorstellen, das Kant in seiner Kunstästhetik vorsieht.114 Der auszeichnende Zweck der schönen Kunst verwirklicht sich für Kant somit nur „wenn der Zweck derselben ist, dass die Lust die Vorstellungen [...] als Erkenntnisarten begleite“115. Das Richtmaß ist die Urteilskraft in ihrer reflektierenden Form, in der das Allgemeine zum Besonderen findet.116 An dieser Stelle lässt sich somit an das Grundanliegen der Kritik der Urteilskraft anknüpfen: „Die ,schöne Kunst‘ geschieht dort, wo wir die Urteilskraft so in ihrem universellen Anspruch legitimieren können, dass die Erkennbarkeit der empirischen Welt universell gesichert ist.“117
Die von Kant vorgenommene Aufteilung der Kunst in mechanische und ästhetische, sowie die weitere Unterscheidung der ästhetischen Kunst in angenehme und schöne Kunst, läuft demnach letztlich auf einen entscheidenden Faktor hinaus: den Menschen. Dieser künstlerische Mensch schafft es demnach, dass der Betrachter sich stets bewusst bleibt, dass bei aller Naturähnlichkeit ein menschengeschaffenes Werk vorliegt. Weil schöne Kunst als freies Spiel beim Betrachter die Lust der Reflexion zu evozieren vermag, stellt sich die Frage, was im Künstler die Hervorbringung dieser schönen Kunst ermöglicht. Der Beantwortung dieser Frage soll im folgenden Abschnitt nachgegangen werden.
3.5 Was ist Genie? Das Genie als Talent, das der Kunst die Regel gibt
Schöne Kunst ist nach dem bislang Ausgeführten für Kant stets Werk des Menschen, genauer: des Genies. Doch was versteht Kant unter „Genie“?
Nach Kant kann kein Prinzip der Schönheit existieren, welches in Form eines objektiven Begriffs, etwa als Regel der Beurteilung und Herstellung schöner Gegenstände, angegeben werden kann. Dem Erleben und Beurteilen des Schönen liegt dabei ein spezifisches uninteressiertes Gefühl der Lust zugrunde - und kein Begriff von der Verfassung eines schönen Gegenstandes. Das Erleben des Schönen ist deswegen kein Erkennen und das Geschmacksurteil kein Erkenntnisurteil. Denn „schön ist das, was in der bloßen Beurteilung (nicht in der Sinnenempfindung, noch durch einen Begriff) gefällt“118. Kunst kann nach Kant nur dann als „schön“ gelten, wenn sich der Betrachter beim Betrachten des Kunstwerks in einem Geschmacksurteil stets bewusst bleibt, dass es sich um Kunst handelt - und dieses Kunstwerk dennoch zugleich natürlich wirkt.119
Kunst, die wie Natur aussieht, ist keine Natur. Doch ihre Beurteilung - das meint Kant, wenn er von „aussehen“ spricht - gleicht der im ästhetischen Urteil über das Naturschöne. Damit das Kunstwerk „als Natur aussieht“, muss es einer Zweckmäßigkeit ohne Zweck entspringen. Doch daraus würde folgen, dass, sobald ein Künstler in seinem Werk einen bestimmten Zweck verfolgt, dieses Werk kein Werk der Kunst mehr ist, weil damit ein bestimmter Zweck unterstellt wäre.120
Aber wie kann Kunst diesem Schönheitsanspruch des Geschmacksurteils gerecht werden? Liegt Kunst nicht per definitionem jederzeit eine bestimmte Absicht inne, die sich im Kunstwerk selbst offenbart? Diese Fragestellung lässt sich aus zwei Aspekten heraus beleuchten: Einerseits, wenn die Absicht reine Empfindung wäre, also bloß subjektiv, würde das Kunstwerk in der Beurteilung vermöge des Sinnengefühls gefallen. Andererseits, wenn die Absicht auf die Hervorbringung eines gewissen Objektes gerichtet wäre und deshalb gefallen würde, gefiele das Kunstwerk durch Begriffe. In beiden Fällen gefällt das Kunstwerk nicht in der bloßen Beurteilung und ist deswegen keine schöne, sondern angenehme Kunst. Die Zweckmäßigkeit im Produkt der Kunst, die absichtlich ist, muss also, um schöne Kunst zu sein, nicht absichtlich scheinen, oder um es mit Kants Worten zu sagen: „[S]chöne Kunst muß als Natur anzusehen sein, ob man sich ihrer zwar als Kunst bewußt ist.“121 Aus dieser Charakterisierung ergibt sich zunächst die Schwierigkeit, die Entstehung schöner Kunstwerke zu erklären, da Kunstwerke prinzipiell nach Regeln hergestellt werden. Diesen scheinbaren Widerspruch hebt Kant methodisch durch die Einführung dessen auf, was er als „Genie“ postuliert: „Genie ist das Talent (Naturgabe), welches der Kunst die Regel gibt. Da das Talent, als angebornes produktives Vermögen des Künstlers, selbst zur Natur gehört, so könnte man sich auch so ausdrücken: Genie ist die angeborne Gemütslage (ingenium), durch welche die Natur der Kunst die Regel gibt.“122
Durch diesen Schluss löst Kant das Spannungsverhältnis, das durch den Anspruch des Kunstwerks entsteht, in der bloßen Beurteilung zu gefallen, regelhaft zu bleiben und zugleich die Absichten des Künstlers auszudrücken, die im Erscheinen des Kunstwerks jedoch aufgegangen sein müssen.123
Wie obig dargelegt, erfordert schöne Kunst als Produkt der Freiheit die Hervorbringung durch Willkür nach der Regel. Diese Regel, ohne die es keine schöne Kunst gibt, muss der Schöpfungskraft des Genies entspringen, wobei sich diese Schöpfungskraft nicht außerhalb des von der Natur gesteckten Rahmens zu entfalten vermag. In dieser Bestimmung offenbart sich die für Kants Begriff der schönen Kunst essenzielle Dialektik von Freiheit und Ordnung. Die Freiheit der schönen Kunst als Akt der Willkür ist nur in ihrer Naturgebundenheit realisierbar:
Erst die Ambivalenz zwischen genialer Freiheit und natürlicher Regelhaftigkeit lässt das Genie zu jener „hybriden Konstruktion einer Naturgabe“124 aufsteigen, das die Freiheit der Kunst in seiner genialen Individualität genuin zu manifestieren vermag.125 Diese dialektische Grundposition des Genies bei Kant findet ihren Ausfluss in einer im Kunstwerk vom Betrachter im Geschmacksurteil erkennbaren Übereinkunft des Kunstwerks mit seiner strukturellen Regelgebundenheit, für die Kant den Begriff der „Pünktlichkeit“ verwendet und die er in ihrer negativen Ausformung als „Peinlichkeit“ formuliert, wobei diese „Peinlichkeit“ für Kant auf das Durchscheinen der Schulform hinausläuft.126 So wussten beispielsweise viele Zeitgenossen Leonardo da Vincis, wie Mona Lisas Lächeln maltechnisch „funktioniert“, - nur Leonardo war jedoch in der Lage, dieses Wissen in Überwinden der Peinlichkeit und unter Berücksichtigung der Forderungen der Pünktlichkeit auf die Leinwand zu bannen.
Doch wie kann diese Pünktlichkeit ohne Peinlichkeit erzeugt werden, die dem Kunstschönen in seiner Regelhaftigkeit die Anmutung des Natürlichen zukommen lässt? Die Beantwortung dieser Frage erfordert ein Verständnis dessen, was Kant unter „Regelgeben“ versteht. Jede Kunst setzt für Kant Regeln voraus, deren Vorhandensein einem Geschaffenen die Möglichkeit eröffnet, als Künstliches wahrgenommen zu werden, wobei die dieser Wahrnehmung zugrundeliegende Erkenntnis auf einem ästhetischen Urteil gründen muss.127
Die Naturgabe muss also der Kunst die Regel geben. Doch welcher Art ist diese Regel? Die Regel, die der Kunst durch die Natur gegeben wird, kann in keiner Formel abgefasst zur Vorschrift dienen, denn sonst wäre das Schönheitsurteil durch Begriffe bestimmbar und das kann es nicht sein, wie in Abschnitt 3.2 über die Geschmacksurteile bereits dargelegt wurde.128 Vielmehr muss die Regel von dem Produkt abstrahiert werden. An diesem Produkt können dann andere (Genies) ihr Talent prüfen. Dabei unterscheidet Kant zwischen Nachmachung und Nachahmung. Die schöne Kunst als Werk des Genies ruft bei anderen, so sie denn ebenfalls durch die Naturgabe versehen auch das Genie in sich tragen, ebenfalls geniale Ideen hervor. Daraus folgt, dass die Muster der schönen Kunst die einzigen Leitungsmittel sind, die das Genie der Nachkommenschaft liefert.129
Diese Regelbezogenheit bleibt für Kant zwar unverzichtbar, darf jedoch nicht ihrem ureigensten Prinzip, der Subsumption unter einen Begriff, folgen. Diese logische Ambiguität weiß Kant durch die Übertragung des Verfahrens vom Subjekt auf die in dem Subjekt wirkende Natur aufzulösen. Diese Auflösung erfolgt allerdings um den Preis von Einsicht und Verständnis in das eigene (geniale) Denken, das sich dadurch weder nachvollziehen noch beeinflussen lässt. Die Möglichkeit des Schaffens schöner Kunst und das freie Spiel des Erkenntnisvermögens mündet für Kant in einen Zustand der „Entmächtigung“130, in dem sich die Genialität des Künstlers ihrer begrifflichen Fixierung entzieht und das schöne Kunstwerk zu einem Produkt von Selbstundurchsichtigkeit der Vernunft mutiert: Das schöne Kunstwerk wird zur Aufgabe einer Naturgabe und bedarf somit „einer Zutat aus dem Reich der Notwendigkeit“131, also der Sphäre des Natürlichen.132 Dieses Schaffen von schöner Kunst als Kunst, die zugleich Natur zu sein scheint, kann nach Kant aus diesem Grunde nur das Genie erschaffen.133
In der Praxis des Kunstschaffens wird in diesem Sinne immer wieder von einem „Schaffensrausch“ gesprochen, in den beispielsweise ein Maler wie Vincent van Gogh verfallen konnte, der große Kunstwerke in einem Zustand „geistiger Entrückung“ schuf - ein Prozess, indem sich Natur und Genie fern jeder begrifflichen Verstehbarkeit in einzigartiger Weise in Einklang bringen.
Es ist demnach nur folgerichtig, dass Kant dem Genie als solchem vier Charakteristika zuordnet, denen zur Veranschaulichung und leichteren Handhabung im weiteren Verlauf dieser Untersuchung Bezeichnungen vorangestellt werden, die den Inhalt von Kants Definitionen jeweils unter einem Begriff subsumieren:134
(1) Originalität: Genialität umfasst Originalität, d. i. das Talent, über die vorgegebenen Regeln der Kunstschulen und -richtungen hinaus, aber unter Berücksichtigung der Regeln des Natürlichen, eigene Regeln in den Prozess der Erschaffung schöner Kunst einfließen zu lassen.135
(2) Exemplarität: Originalität allein ist noch keine hinreichende Bedingung für Genialität. Genialität umfasst zudem das Talent, als Richtmaß und Regel der Beurteilung schöner Kunst zugleich exemplarisch zu sein, was das Vermögen bezeichnet, anderen als Muster zu dienen, ohne selbst Nachahmung zu entspringen.136
(3) Unerklärbarkeit: Das schöne Kunst schaffende Genie kann sich selbst weder beschreiben noch wissenschaftlich nachvollziehen und darüber hinaus auch das von ihm Geschaffene nicht begrifflich erklären, sofern diese Erklärbarkeit über die Grenzen des ästhetischen Geschmacksurteils hinausreichen soll.137 Diese Unbeschreibbarkeit bzw. Unerklärbarkeit gilt auch für die Perspektive der dritten Person. Deswegen ist die Natur im Künstler nicht dasjenige, was durch begriffliche Bestimmung, etwa neurowissenschaftlich, angezeigt werden kann.138
(4) Naturbezug: Das schöne Kunst schaffende Genie bleibt trotz seiner individuellen Regelhaftigkeit in einem dialektischen Prozess den Regeln der Natur verpflichtet: Der schöpferische Impuls zur Erschaffung schöner Kunst verortet sich im Genie und bleibt in den Bedingungen seiner Möglichkeit dennoch natürlichen Ursprungs.139 Das Genie gibt es nur in der schönen Kunst, nicht in der Wissenschaft oder dem Handwerk und in der Kunst eben nur dann, „insofern [...] [sie]auch schöne Kunst sein soll“140.141
Anhand dieser vier definitorischen Festlegungen dessen, was Kant der Sphäre des Genialen zuspricht, lässt sich nunmehr in einem nächsten Schritt jenes von der Schöpfungskraft des Genies abheben, das er als „Nachahmungsgeist“142 bezeichnet. Diese Unterscheidung ist deshalb nicht unerheblich, weil auch die Entwicklung des Genies eine Phase des Nachahmens beinhaltet, die Zeit, in der es lernt. „Lernen“ meint in diesem Zusammenhang das sich Aneignen jener Fertigkeiten und Regelkenntnisse, die für die Schaffung von Werken schöner Kunst unabdingbar vorausgesetzt werden müssen. Das Genie ist allerdings nicht bloß gelehrig, seine Genialität offenbart sich darin, dass es die erworbenen Fertigkeiten und Regelkenntnisse in Akten originärer Freiheit durch eigene Regelsetzung zu transzendieren 143 vermag.143
Allerdings ist nicht gleich jeder, der denkt, erfindet und außerhalb der Regelkonformität erschafft, gleich ein Genie, weil das Erschaffen von Kunst, genauer: mechanischer und ästhetischer als angenehmer Kunst, erlernbar und durch Fleiß vermittels Nachdenkens möglich ist. Zur Veranschaulichung dieses Gedankengans verweist Kant auf das Beispiel Isaac Newtons, der fraglos ein „großer Kopf“144 gewesen sei. Allerdings bleiben Newtons Erkenntnisse erlernbar, ihre Herleitung und ihr Nachvollzug jedermann durch schlichtes Rechnen offen. Diese Berechenbarkeit resultiert aus der Newtons Erkenntnissen zu Grunde liegenden objektiven Regelhaftigkeit und Allgemeingültigkeit - Regeln, die Wissenschaftlichkeit zur Folge haben. Schöne Kunst hingegen bleibt stets das Werk subjektiver Regelhaftigkeit und Allgemeingültigkeit und steht somit jeder Wissenschaftlichkeit gegensätzlich gegenüber. Deshalb ist Homer für Kant im Gegensatz zu Newton ein wahres Genie, weil er nicht durch objektiven Regelbezug anzuzeigen vermag, wie seine Ilias entstanden ist.145
Diese Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Regelhaftigkeit mündet für Kant in die Unterscheidung zwischen quantitativ und qualitativ: Während sich in der Wissenschaft größte Erfinder und Denker nur quantitativ, des Grades nach, vom „mühseligsten“146 Lehrling bzw. Nachahmenden, unterscheiden, unterscheidet sich das Genie qualitativ von den reinen „Pinseln“147 bzw. Nachahmenden. Das Genie schafft also durch Naturgabe und in freier Regelhaftigkeit sui generis in Beispiel setzender Weise schöne Kunst.148
In diesem Zusammenhang sei nochmals auf den den gesamten Begriff der schönen Kunst bei Kant durchziehenden Aspekt der Einzigartigkeit des je einzelnen Genialen verwiesen. Diese Prämisse der Einzigartigkeit des Genialen ist insofern bedeutsam, als sie auf eine je subjektive und damit einzigartige Weise Auslebung einer Freiheit ist, die Kant zumeist in ihrer überpersonalen abstrakten Allgemeinheit als transzendentale Freiheit anspricht. Diese transzendentale Freiheit, die, im Gegensatz zur praktischen Freiheit, kausaler Notwendigkeit enthoben bleibt, muss Ursprung genialer Schöpfung sein und erst diese Freiheit hebt Kunst im Allgemeinen, wie als schöne Kunst, empor.
Die Unterscheidung zwischen schöner Kunst und Nachahmung ist für Kant darüber hinaus unter einem anderen Aspekt bedeutsam: Dem des „Mechanischen“. Jeder Kunst und somit auch der schönen Kunst, liegt ein mechanisches Momentum zugrunde, weil nach Regeln verfahren wird und ein gewisses „Schulgerechtes“149, das wesentlich eine Prämisse von Kunst ausmacht, enthalten sein muss: Jedes schöne Kunstwerk bleibt durch seine Stofflichkeit in Verarbeitung und Formgebung an ein „durch die Schule gebildetes Talent“150 gebunden, das in seinem regelhaften Gehalt erst das Erkennen des Schönen im ästhetischen Geschmacksurteil möglich macht.151 Allerdings schafft auch vollständiges Erkennen keine Kunst, sofern ihm Geschicklichkeit abgeht: Auch das vollständigste erkennende Durchdringen eines Kunstwerkes bleibt an das Vermögen gebunden, das Erkannte zu materialisieren. In dieser Schulgebundenheit des Schöpfungsaktes gleicht schöne Kunst der Nachahmung - ihre Abgrenzung davon resultiert wie oben ausgeführt lediglich aus dem dieses mechanische Element übersteigende Talent zur freien beispielhaften Regelsetzung.152
Im schönen Kunstwerk vereinigt nach Kant der Künstler die Trias Freiheit, Regelkonformität und Natur: Der Künstler folgt keiner Regel, er gibt die Regel durch die von ihm geschaffenen Werke. Die „Naturgabe“ gibt „der Kunst (als schönen Kunst) die Regel“153. Wenn ein Kunstbetrachter, Kritiker oder Adept eines Künstlers eine Regel sucht, muss diese von dem Kunstwerk, Kant spricht an der Stelle von Produkt bzw. Tat,154 abstrahiert werden, was wiederum von dem Kunstbetrachter, dem Kritiker oder dem Adepten geschehen muss. Die schöne Kunst ist folglich Muster zur Nachahmung, nicht zur Nachmachung.155 Diese begriffliche Unterscheidung soll auf den Sachverhalt verweisen, dass der Adept nicht kategorisch den Regeln des Meisters Folge leisten darf, da er sonst zum Epigonen zurückfällt. Die Nachkommenschaft des kunstschaffenden und regelgebenden Genies müssen, so sie sich denn schöne Kunst zu schaffen anstreben, auf die „Muster der schönen Kunst“ rekurrieren und sich selbst über das reine Regellernen emporheben.156
Zusammenfassend lässt sich Kants Theorie der schönen Kunst wie folgt darstellen: Alle Kunst teilt sich nach Kant in mechanische und ästhetische, wobei er die ästhetische wiederum in angenehme und schöne unterteilt.
Hinreichendes Merkmal zum Zustandekommen schöner Kunst ist das Genie. In einer dialektischen Einbettung in die Regelhaftigkeit des Natürlichen, vermag nur das Genie vermittels seiner aus sich selbst entstehenden freiheitlichen beispielsetzenden Regelhaftigkeit schöne Kunst zu erschaffen. Dem Genie wesenhaft sind die vier Charakteristika Originalität, Exemplarität, Unerklärbarkeit und Naturbezug.
4 Was ist KI unter philosophischem Aspekt?
Die Beantwortung der Forschungsfrage, warum KI keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorbringen kann, erfordert zunächst eine Definition dessen, was im Folgenden unter dem Begriff „KI“ zu verstehen sei. Diese Definition scheint insofern dringend angezeigt, als über das wissenschaftliche Umfeld hinaus der Begriff der KI in zum Teil recht widersprüchlicher und den Sachverhalt bestenfalls peripher tangierender Weise Verwendung findet. Diese Begriffsunschärfe resultiert nicht zuletzt aus der historischen Entwicklung, der wir das Phänomen „KI“ zu verdanken haben. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Einerseits fehlt eine allseits anerkannte Definition von KI, was auf die interdisziplinäre Beforschung und die fehlende klare Zugehörigkeit dieses Problemfeldes zu einer wissenschaftlichen Disziplin zurückzuführen ist, andererseits existieren mehrere konkurrierende KI-Definitionen, die sich jeweils einem spezifischen Aspekt, etwa dem psychologischen, neurologischen oder computertechnischen widmen und sich daher teilweise widersprechen.
Darüber hinaus rekurriert die Definition dessen, was unter „KI“ verstanden werden soll, auf die Frage, was Intelligenz ist.157 Zur Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden Untersuchung ist die Frage nach Intelligenz allgemein jedoch nicht weiter von Relevanz, auch wenn es sich dabei um eine durchaus interessante wissenschaftliche Frage handelt, die auch in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen umfassend Beleuchtung findet. In der vorliegenden Untersuchung geht es jedoch um die Konzepte von KI und nicht darum, inwieweit künstliche Intelligenz intelligent ist oder was Intelligenz allgemein ist. Deswegen wird in den folgenden Abschnitten 4.1 und 4.2 herausgearbeitet, wie die Entwicklung der KI unter philosophiehistorischem Gesichtspunkt und in Hinblick auf das (mögliche) Kunstschaffen von KI anzusehen ist und mit welcher Definition von „KI“ im Fortgang dieser Untersuchung verfahren werden soll, wozu die Abgrenzung zwischen Weak AI und Strong AI getroffen werden muss.
4.1 Die Entwicklung der KI unter philosophiehistorischem Aspekt
Die Idee der denkenden Maschine ist recht jung, die Grundlagen dafür wurden jedoch bereits in den vergangenen 2500 Jahren unter anderem in den Wissenschaftsfeldern Mathematik, Statistik, Logik, Psychologie, Sprachwissenschaft und Philosophie geschaffen. Während die Prinzipien des menschlichen Denkens zum Teil bereits im antiken Griechenland beforscht wurden, kam es erst in jüngster Vergangenheit zu signifikanten Fortschritten in der Entwicklung von KI.158
Historisch betrachtet, geht der Wunsch des Menschen, ein zu eigenständigem Denken befähigtes Objekt erschaffen zu können, auf die kulturellen Anfänge der Menschheit zurück: Was mythologisch überhöht mit Galatea beginnt, setzt sich theologisch verklärt im Golem der jüdischen Mystik, dem Homunkulus der Alchemisten im Mittelalter sowie Frankensteins Monster fort und mündet in die transhumanistischen Vorstellungen unserer Zeit.159 Allerdings haben sich im Verlauf der kulturhistorischen Entwicklung die Erklärungsmuster gewandelt, auch in diesem Bereich hat sich in langen Jahrhunderten der Übergang vom Mythos zum Logos vollzogen: Spätestens mit dem auf Kausalität basierenden mechanistischen Weltbild der frühen Neuzeit wird die Schaffung von KI eng an mathematische Voraussetzungen geknüpft. Erst Jahrhunderte später schaffen die Erkenntnisse neuronaler Zusammenhänge im menschlichen Gehirn die Möglichkeit, künstliche Intelligenz über reine mathematische Funktionalität hinaus als Netzwerk interagierender Einzelkomponenten zu begreifen.160
Als „KI“ wird heute in einem engeren Sinne das Produkt jener technischen Entwicklung und wissenschaftlichen Forschung begriffen, die im 17. Jahrhundert mit Blaise Pascals161 Pascaline und den damit verbundenen Erkenntnissen zur Kombinatorik Einzug in das wissenschaftliche Denken hält. Im gleichen Jahrhundert entwickelt Thomas Bayes162 den Satz von Bayes, der die Fähigkeit von KI trotz oft unvollständigen Informationen zu „lernen“ und „Entscheidungen zu treffen“ maßgeblich ermöglicht. Die Bayes'sche Inferenz ist auch heute noch einer der wichtigsten Ansätze des Maschinellen Lernens, also der Fähigkeit von KI, aufgrund der gegebenen Prämissen und Algorithmen zu „eigenständigen“ Schlüssen zu gelangen.163
Fortgesetzt wird diese Entwicklung durch die bahnbrechenden Erkenntnisse großer Mathematiker und Philosophen wie Gottlob Frege, Gottfried W. Leibniz oder Leonhard Euler.164 Schließlich mündet der Siegeszug, den die formale Logik dank der Forschungen von Bertrand Russels165 und Alfred Tarski166 antritt, in die technische Grundlagenforschung zur KI, in die neuen Wissenschaftsfelder Informatik und Kognitionswissenschaft und deren praktische Umsetzung in der Mitte des 20. Jahrhunderts und in die Vorläufer der aktuellen Computertechnik.
Ein besonders wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der KI stellen die Sätze des Mathematikers Kurt Gödel dar. Der Gödelsche Vollständigkeitssatz besagt, dass in der Prädikatenlogik erster Stufe alle wahren Aussagen herleitbar sind, die Prädikatenlogik erster Stufe ist vollständig. Das bedeutet, dass jede in der Prädikatenlogik formalisierbare wahre Aussage beweisbar mit Hilfe der Schlussregeln eines formalen Kalküls ist. Auf diesem Fundament können dann die automatischen Theorembeweise als Implementierung formaler Kalküle gebaut werden. Mit dem Gödelschen Unvollständigkeitssatz lässt sich somit beweisen, dass es in Logiken höherer Stufe wahre Aussagen gibt, die nicht beweisbar sind.167 Durch den Gödelschen Unvollständigkeitssatz wird so aufgezeigt, dass die Welt der mathematischen und logischen Strukturen insgesamt nicht algorithmisch strukturiert ist. Das bedeutet, dass menschliche Fähigkeiten wie Überzeugungen haben, Entscheidungen zu treffen und emotive Einstellungen zu begründen, sprich die menschliche Vernunft, sich nicht im Modell eines digitalen Computers erfassen lassen. Denn Computer (und KI) basieren auf Algorithmen, Menschen nicht.168
Die Mathematikerin Ada Lovelace entwickelt zusammen mit Charles Babbage 1842 den ersten Algorithmus, der von dem ersten Allzweckcomputer ausgeführt wird. Darüber hinaus sieht Lovelace Potential im Computer jenseits des reinen Berechnens, was damals revolutionär ist. Sie prägt den Begriff der „Poetical Science“169:
[The Analytical Engine] might act upon other things besides number, were objects found whose mutual fundamental relations could be expressed by those of the abstract science of operations... Supposing, for instance, that the fundamental relations of pitched sounds in the science of harmony and of musical composition were susceptible of such expression and adaptations, the engine might compose elaborate and scientific pieces of music of any degree of complexity or extent.170
Darunter versteht Lovelace die ihrer Ansicht nach in Rechenmaschinen angelegte prinzipielle Fähigkeit, auch mit Objekten zu operieren, die keine Zahlen sind, etwa musikalische Kompositionen. Diese Annahme erweist sich im weiteren Verlauf der KI-Forschung als anregend und fruchtbar, deutet sie doch Möglichkeiten weit über das Mathematische hinaus an. Allerdings werden heute diese Möglichkeiten weniger optimistisch bewertet, da auch moderne KI an die Vorgaben ihrer binären Prämissen gebunden bleibt.171 Als Geburtsstunde der KI wird gemeinhin im Jahre 1956 die Dartmouth Conference angesehen. Das Forschungsprojekt, dessen vollständiger Titel Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence lautet, wird von dem zu dieser Zeit als Assistenzprofessor für Mathematik am Dartmouth College angestellten John McCarthy gemeinsam mit drei wissenschaftlichen Kollegen durchgeführt. Ziel ihres Forschungsprojekt ist es, herauszufinden, „wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen und Begriffe zu bilden, Probleme zu lösen, die zu lösen bislang dem Menschen vorbehalten sind, und sich selbst zu verbessern“172.
Auch wenn sich der Begriff „KI“ im Nachgang zur der Dartmouth Conference in der wissenschaftlichen Terminologie etabliert, werden die damit einhergehenden Paradigmenwechsel, nämlich Denken nicht länger als menschliches Privileg aufzufassen, bereits früher ins Auge gefasst. So etwa in dem populären Mind Artikel aus dem Jahre 1950, in dem der Mathematiker Alan Turing nicht bloß eine operative Definition für menschliche Intelligenz liefert, sondern gleichzeitig auch die Frage aufwirft „Can a machine think?“173, die er im Verlauf des Artikels durch die Frage „Can a machine be linguistically indistinguishable from a human?“174 ersetzt.175
Besonders interessant dabei ist das von Turing in diesem Artikel entworfene Testdesign. Beim sogenannten „Turingtest“ führt ein menschlicher Fragesteller über ein Computerterminal ohne Sicht- und Hörkontakt eine Unterhaltung mit zwei ihm fremden Gesprächspartnern. Einer der Gesprächspartner ist ein Mensch, der andere ein Computer. Beide Gesprächspartner versuchen den Fragesteller in ihren Antworten davon zu „überzeugen“, (denkende) Menschen zu sein. Wenn der Fragesteller nach intensiver Befragung nicht erkennen kann, welcher der Antwortenden der Computer ist, hat der Computer den Turingtest bestanden: Dieses Bestehen attestiert dem Computer nach Turings Dafürhalten ein dem menschlichen ebenbürtiges Denkvermögen.176
Kritik an dem Testdesign, dessen impliziten und expliziten Prämissen sowie Turings Schluss, dass durch diesen Test das Denkvermögen eines Computers zu bewiesen sei, kommt aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen. Unter anderem stellt sich der Philosoph John Searle in seinem 1980 veröffentlichten Artikel Minds, Brains and Programs und dem darin vorgestellten und populären sogenannten „Chinesische Zimmer“-Gedankenexperiment gegen den Turingtest.177 Searle behauptet, dass das Bestehen des Turingtests das Vorhandensein von künstlicher Intelligenz nicht belegt, weil es sich vielmehr um eine Simulation von Intelligenz handelt. Auch der Philosoph Julian Nida-Rümelin weist mit Searle auf das Offenkundige hin, was dem Computer - in dem Fall dem System „Chinesisches Zimmer“ - fehlt: Das Verständnis der chinesischen Sprache. Denn selbst wenn der Computer funktional äquivalent mit jemandem ist, der Chinesisch versteht, heißt das nicht, dass der Computer Chinesisch auch versteht. Denn die Fähigkeit, Chinesisch zu sprechen und zu verstehen, setzt gewisse andere Fähigkeiten und Kenntnisse voraus. Eine Person, die Chinesisch spricht, bezieht sich durch gewisse Ausdrücke auf entsprechende Gegenstände. Die Person verfolgt Absichten mit den gewissen Ausdrücken und bildet Erwartungen. Über alle diese Fähigkeiten und Absichten verfügt das System „Chinesisches Zimmer“ bzw. der Computer nicht.178 Denn „das [C]hinesische Zimmer simuliert Verständnis des Chinesischen, ohne selbst der chinesischen Sprache mächtig zu sein.“179 Und Searle geht nach Nida-Rümelin in einem später entwickelten zweiten Argument noch weiter, wenn er seinen philosophischen Realismus, sprich die These, es gebe eine Welt, die unabhängig davon existiere, ob sie beobachtet werde oder nicht, mit einer intentionalistischen Zeichentheorie zusammenbringt. Nach dieser intentionalistischen Zeichentheorie haben Zeichen immer nur Bedeutung für uns Menschen, die wir die Zeichen verwenden und interpretieren. Der Mensch einigt sich also innerhalb eines konventionellen Rahmens mit anderen Menschen auf die Verwendung und Bedeutung gewisser Zeichen. Ohne diese Bedeutung wäre die Verwendung von Zeichen sinnlos. Doch ein Computer „einigt“180 sich nicht mit anderen Computern oder Menschen auf die Bedeutung, er folgt nur vorgegebenen Regeln. Ein Computer besteht vielmehr aus verschiedenen physikalisch beschreibbaren Elementen, die jedoch keine Syntax haben und keine logischen oder grammatikalischen Regeln kennen. Die syntaktische Interpretation ist demzufolge „beobachterrelativ“181.182 Der Computer ist nach Searle also keine semantische Maschine.183
Nach Nida-Rümelin ist dieses Argument Searles dabei „radikal, einfach und zutreffend“184, beruht es auf „einer realistischen Philosophie und einer mechanistischen Interpretation der Computer“185. Computer sind also nach Searle weder semantische noch syntaktische Maschinen, sondern Objekte, die durch Naturgesetze und mit Mitteln der Physik vollständig beschreibbar und erklärbar sind. Physik jedoch beschreibt keine Zeichen, keine logischen Schlüsse, keine Algorithmen und keine grammatikalischen Schlüsse.186 Begleitet wird die historische Entwicklung der KI von zwei gegensätzlichen Erwartungshaltungen der Allgemeinheit: Während die einen die KI als neuen Heilsbringer der Menschheit feiern, wird sie bei anderen zur Ursache der Apokalypse.
Wissenschaftler wie der Physiker Stephen Hawkings oder der Philosoph Nick Bostrom, der in seiner Dystopie Superintelligenz: Szenarien einer kommenden Revolution aus dem Jahr 2016 eine bevorstehende Machtübernahme von Maschinen über den Menschen beschreibt, warnen davor, dass „Roboter“ eines Tages die menschliche Spezies an Denk- und Handlungskompetenz übertreffen und diese Fähigkeiten gegen die Menschheit wenden.187 Demgegenüber steht das, was Nida-Rümelin pointiert als „Silicon-Valley-Ideologie“188 bezeichnet, nämlich die Hoffnung, dass KI globale menschliche Probleme, wie Hunger oder Krankheiten, meistern wird. Nach Nida-Rümelin wird durch diese Haltung die Arbeit an KI und die Erfolge des Silicon Valleys metaphysisch aufgeladen: Transparenz, Berechenbarkeit, ökonomischer Erfolg und mäzenatisches Engagement mutieren zu zentralen Werten dieses Glaubens.189
Auch wenn die Problemstellungen in der wissenschaftlichen Disziplin der KI bereits seit über 50 Jahren beforscht werden, können erst in den vergangenen Jahren die anfänglich vermeintlich kühnen Ideen der Dartmouth Conference in die Tat umgesetzt werden - etwa durch Deep Learning, autonome Fahrzeuge, Bilderkennung, Smartphones und Sprachsteuerungen.190 Während in bestimmten eng fokussierten Bereichen künstliche menschliche Intelligenz überragt - IBMs Deep Blue etwa gelang es, den Schachweltmeister Gary Kasparov zu schlagen -191, bleibt die menschliche der künstlichen Intelligenz in der Breite an Fähigkeiten und Wissen weiterhin überlegen und nur menschlicher Intelligenz bleibt es vorbehalten, ihre Expertise in jeder Sphäre auszubilden.192
„KI“ betitelt heute ein weites interdisziplinäres Gebiet, in dem Forschende zu je unterschiedlichen Fragestellungen miteinander arbeiten. Praktisch erfolgreiche Teilgebiete der KI stellen unter anderem die Sprachsteuerung sowie die Darstellung von Wissen in Datenverarbeitungssystemen, automatisiertes Wahrnehmen, Schlussfolgern, Bildanalyse, Robotik und maschinelles Lernen dar.193
Bereits dieser kurze historische Abriss macht deutlich, dass die Definition dessen, was unter „KI“ letztlich zu verstehen sei, sich insofern komplex gestaltet, als an dieser Definition nicht nur unterschiedliche philosophische Ausrichtungen, sondern darüber hinaus verschiedenste wissenschaftliche Bereiche, etwa Logik, Operations Research, Linguistik Statistik und Regelungstechnik beteiligt sind. KI bietet also kein Universalrezept, jedoch eine Werkstatt mit einer überschaubaren Anzahl an Werkzeugen für die unterschiedlichsten Aufgaben.194 Daher scheint es geboten, in einer synoptischen Gesamtschau aus diesen divergierenden Ansätzen das herauszuarbeiten, was im Nachfolgenden als Definition von KI dieser Untersuchung zu Grunde gelegt werden kann, weil diese Definition ein nicht unwesentliches Element der Fragestellung des vorliegenden Forschungsvorhabens darstellt.
4.2 Die philosophische Abgrenzung der Konzepte von Strong AI und Weak AI
In der aktuellen KI-Debatte lassen sich viele der gängigen KI-Definitionen auf einen Nenner bringen: Sie beschreiben beobachtbares Verhalten, auf Grund dessen Vorliegen sie auf zugrundeliegende Intelligenz schließen. Anders ausgedrückt: Die beobachtete Wirkung wird als Beweis der zugrundeliegenden Ursache angesehen. Als Beispiels dafür sei hier die Definition von McCarthy angeführt, der den Begriff „KI“ in dem obig genannten Proposal folgendermaßen definiert: „Ziel der KI ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als verfügen sie über Intelligenz.“195. Zurecht weist Nida-Rümelin auf die fundamentalen Schwächen Definitionen wie dieser hin, indem er den behavioristischen Hintergrund dieser Definition aufzeigt: In diesen Definitionen wird das Gegebene, das Positive, zum Ausgangspunkt genommen und das betreffende Verhalten mit der zugrunde gelegten Eigenschaft identifiziert.196
Nachfolgende Versuche, diese methodischen Schwächen zu überwinden, wie etwa die KI- Definition der Encyclopedia Britannica: „Artificial intelligence (AI), the ability of a digital computer or computer-controlled robot to perform tasks commonly associated with intelligent beings.“197 können diese prinzipiellen Mängel nicht überwinden, da diese Definition etwa einem Computer Intelligenz zuspricht, der einen langen Text speichern und jederzeit abrufen kann. Wenn man das Auswendiglernen von Texten als höhere intellektuelle Verarbeitungsfähigkeit des Menschen auffasst, bleibt dieses „Auswendiglernen“ beim Computer lediglich verständnislose Reproduktion, da der Computer den verständigen Gehalt dieses Auswendiggelernten nicht zu begreifen vermag. Dieses Problem versucht die Informatikerin Elaine Rich durch ihre Definition von KI zu lösen: „Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.”198 zu lösen. Richs Definition scheint funktional für Informatik oder Robotik zu genügen, beschreibt sie doch prägnant, was Wissenschaftler bereits seit 50 Jahren tun und was auch noch in 50 Jahren aktuell sein wird. Als Schwachstelle all dieser funktional geprägten Definitionen erkennt Nida-Rümelin das, was er als eben diese „Silicon-Valley-Ideologie“199 ausmacht, nämlich, durch KI Akteure zu schaffen, die in diesen Definitionen am Ende mit mentalen Eigenschaften, etwa Erkenntnisfähigkeit, Einsichtsfähigkeit und Bewertungsfähigkeit ausgestattet werden und wodurch kognitiven Systemen Emotionalität zugesprochen wird.200
In der philosophischen Debatte um die KI-Forschung wird zwischen zwei verschiedenen theoretischen Konzepten unterschieden: Der sogenannten „Strong AI“ und der sogenannten „WeakAI“.201 Unter dieser „StrongAI“ versteht man in der philosophischen KI-Forschung die Realisierung kognitiver Leistungen bzw. kognitiver Fähigkeiten, also all jene Ansätze, die versuchen, den Menschen bzw. die Vorgänge im menschlichen Gehirn nachzubilden. Häufig werden auch Eigenschaften wie Empathie oder Bewusstsein als konstituierende Merkmale von Strong AI benannt.202
Demgegenüber steht die Weak AI. Bei ihr geht es nur um die Simulation kognitiver Leistungen und Fähigkeiten. Sie wird gezielt dazu entwickelt, um bestimmte klar abgegrenzte Problemstellungen zu lösen.203
Zu beachten bleibt dabei, dass beide Ansätze Konzepte darstellen. Alle derzeit möglichen KI-Anwendungen sind der Weak AI zuzuordnen, sie alle erfüllen einen bestimmten Zweck in einem spezifischen Anwendungsgebiet und werden von Menschen hierfür eingesetzt und simulieren bloß intelligentes Verhalten.
Eine Strong AI existiert bislang nicht, sie ist jedoch Gegenstand zahlreicher zeitgenössischer Forschungsvorhaben. Nichtsdestoweniger haben bereits viele Wissenschaftler sowohl prinzipielle als auch ethische Bedenken gegen die Schaffung einer Strong AI vorgetragen. Der philosophische Diskurs diesbezüglich läuft auf Hochtouren.204 So hat etwa Nida- Rümelin in seinem Digitalen Humanismus das Konzept Strong AI weitestgehend als Fehlinterpretation bezeichnet, weil zwischen Mensch und Computer keine kategoriale200 201 202 203 204
Differenz getroffen werde und es falsch sei, Softwaresystemen, die menschliches Verhalten, Urteilen und Entscheiden nachahmen, menschliche Eigenschaften zuzusprechen.205 Die Strong AI lässt sich in zwei Lesarten verstehen. Nach der materialistischen Lesart sind menschliche Gehirne lediglich komplexe Computer, „also algorithmisch agierende, von eindeutig Input-Output-Relationen gesteuerte Entitäten“206, weshalb die Sprache mentaler Eigenschaften grundsätzlich überflüssig ist und mit dem Fortschritt der Naturwissenschaft mentaleeze, d. i. die Sprache der mentalen Eigenschaften, aussterben werde. Nimmt man den digitalen Mechanismus dieser Weltanschauung ernst, so bedeutet dies das Ende der menschlichen Lebensform als Ganzes.207
Die zweite Lesart kann nach Nida-Rümelin als moderne Form des Animismus verstanden werden, d. i. die Beseelung von Nicht-Beseeltem, wobei Softwaresysteme als beseelte Wesen betrachtet werden, die mit den gleichen mentalen Eigenschaften ausgestattet sind wie Menschen.208
Beide Lesarten der Auffassung dessen, was unter Strong AI zu verstehen sei, soll im weiteren Fortgang dieser Untersuchung keine Rolle spielen, weil in der aktuellen philosophischen Forschungsdebatte bezüglich Strong AI grundsätzlich konträre Positionen vertreten werden. Auf der einen Seite stehen dabei die Apologeten der prinzipiellen Möglichkeit der Strong AI, ihnen entgegen stehen diejenigen, die die prinzipielle Möglichkeit von Strong AI kategorisch ausschließen. In der vorliegenden Untersuchung soll hinsichtlich der Frage nach der Möglichkeit von Strong AI insofern eine agnostische Position eingenommen werden, als über die Möglichkeiten künftiger Strong AI - soweit sie überhaupt machbar sein sollte - heute noch keine sinnvollen Aussagen hinsichtlich ihrer Fähigkeit, schöne Kunst zu schaffen, möglich sind.
Zusammenfassend kann anhand dieser Unterscheidung festgehalten werden, dass in dieser Untersuchung unter KI - sofern nicht explizit anderes bezeichnet werden soll - stets KI im Sinne des Konzepts der Weak AI gemeint ist.
5 Kann KI schöne Kunst als Werk des Genies im Sinne Kants hervorbringen?
5.1 Bestandsaufnahme: Von KI geschaffene „Kunst“
Die bildende Kunst als Ausdruck menschlicher Kreativität gilt als eine der letzten Bastionen des exklusiv Menschlichen und für KI unerreichbar, da ihr Kreativität gemeinhin abgesprochen wird. Doch auch in der Kunst hat KI inzwischen Einzug gehalten. Als von KI geschaffene Kunst bezeichnet man deswegen entweder „autonom“209 von KI geschaffene Kunstwerke oder in „Zusammenarbeit“ zwischen KI und menschlichen Künstler geschaffene Kunstwerke.
Auch wenn von KI geschaffene Kunst erst in den letzten Jahren, besonders durch die 2018 entwickelten Generative Adversarial Networks (GAN), einer Gruppe von Algorithmen zu unüberwachtem Lernen,210 die es ermöglichen, dass Maschinelles Lernen dazu verwendet werden kann, Bilder zu generieren, sich maßgeblich weiterentwickelt hat, ist die Idee und der Versuch ihrer Umsetzung bereits seit Anbeginn an die Beforschung der KI verknüpft.
Um im nächsten Abschnitt untersuchen zu können, ob KI schöne Kunst im kantischen Sinne schaffen kann, muss zunächst - unter Bezugnahme auf relevante Station der Historie von durch KI geschaffener Kunst - geklärt werden, wie KI in der Vergangenheit und heute Kunst schaffen kann bzw. was als von KI geschaffener Kunst bezeichnet wird.
Bereits seit 1973 arbeitet Harald Cohen, Maler und Professor an der Universität von Kalifornien, San Diego, mit einer KI namens „AARON‘ zusammen. AARON erschafft seit Jahrzehnten „autonom“ Bilder, wobei er sich sich an den von Cohen in den 1960-er Jahren geschaffenen Werken bedient, die allesamt dem Genre der Farbfeldabstraktion entsprechen, dessen Vertreter Cohen ist. Wohlwollend könnte man AARON somit als Cohens Schüler bezeichnen, ähnlich dem Lehrer-Schüler Verhältnis in der Rembrandtschule oder Wessobrunner Schule.211
Doch auch hinsichtlich des Kunstschaffens hat sich in den letzten Jahren der KI-Forschung Einiges getan. So wurde der Forschungszweig Computerkreativität ins Leben gerufen, dessen Vertreter davon überzeugt sind, dass einem Computer erst dann das Attribut „intelligent“ zugesprochen werden kann, wenn er kreativ ist. So schlägt etwa Simon Colton, Professor für Computerkreativität am Goldsmiths College in London, vor, dass ein künstlich intelligenter Künstler, anstatt einfach in der Lage zu sein, sich überzeugend menschlich zu unterhalten, wie Turing es vorschlägt, sich „geschickt“, „anerkennend“ und „einfallsreich“ verhalten müsse.212
Kreativität lässt sich mit formalen Modellen und Simulationsstudien zumindest auf ein Mindestmaß konkreter fassen. Doch wie funktioniert dies? Wie soll KI kreativ sein?
In einem ersten Schritt zerlegen die Forschenden die „Kreativität“ in Bestandteile.213 Die einfachste Variante dieser Kreativität besteht darin, existierende bekannte Elemente neu zusammenzusetzen. Dies geschieht durch die Analyse großer einschlägiger Datenzusammenstellungen, etwa Theaterstücken, Bildern, Gedichten und Liedern. Die KI erschafft so neue Werke, die den Strukturen der bestehenden Kunstwerke entsprechen.214 2013 stellt Colton in einer Ausstellung Werke seiner KI The Painting Fool vor, die in einem ersten Schritt aus einem The Guardian-Artikel über den Afghanistankrieg Schlüsselwörter, etwa „Nato“, „Truppen“ und „Briten“, extrahiert und in einem zweiten Schritt Bilder dazu findet, die mit den Schlüsselwörtern in Verbindung stehen. Diese Bilder setzt sie zu einem Bild zusammen, das „Inhalt und Stimmung“ des Zeitungsartikel widerspiegeln soll.215 Im Jahr 2017 produzierte Taryn Southern, eine Popkünstlerin, die mit unterschiedlichen KI zusammenarbeitet, ihr Debutalbum I AM AI.216
Ein weiterer Meilenstein in der von KI geschaffenen Kunst stellt das 2018 von einer KI geschaffene Porträt Edmond Belamy dar, das für über 400.000 Dollar bei einer Christie’s Auktion versteigert wird. Die KI wird mit 15.000 Bildern von Porträts aus verschiedenen Epochen gefüttert und generiert, darauf basierend, ein „originär“ produziertes Porträt.217 Der Blick in die Geschichte der Entwicklung von KI geschaffener Kunst zeigt auch hier, dass einheitliche Normen oder Definitionen dessen, was als von KI geschaffener Kunst bezeichnet werden kann, fehlen. Diese fehlenden Definitionen stellen für den Fortgang dieser Untersuchung allerdings insofern kein größeres Hindernis dar, als sich diese Untersuchung das Zustandekommen von KI bzw. vom Menschen geschaffener Kunst zur Problemstellung gesetzt hat und sich somit quasi der Ursache und weniger der Wirkung im künstlerischen Schaffensprozess zuwendet: Die von KI geschaffenen Kunstwerke qua Kunstwerke und als handelbare Kunstobjekte sind als solche in dieser Untersuchung nur insofern relevant, als es die Frage ihres Zustandekommens durch einen künstlerischen Schaffensprozess ist. Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass Kunstwerke in dieser Untersuchung insofern nicht thematisiert werden, als sich die Forschungsfrage auf den Schöpfungsprozess des Kunstwerks fokussiert und nicht das fertige Kunstwerk als wirtschaftliche Ware im globalen Kunstmarkt Beachtung findet. Welchen Preis ein von KI geschaffenes Kunstwerk, etwa das Porträt Edmond Belamy, erzielt, bleibt demnach für die Fragestellung dieser Untersuchung ohne Belang. Allein unter diesem Aspekt des künstlerischen Schaffungsprozesses soll daher im folgenden Abschnitt die Anwendung der kantischen Kunstkonzeption auf von KI geschaffene Werke erfolgen.
5.2 Kann KI Kunst allgemein schaffen? Freiheit als notwendige Bedingung des Kunstschaffens allgemein
Wie in den Abschnitten 3.1-3.5 aufgezeigt, geht Kant davon aus, dass es Kunst allgemein entweder als mechanische oder ästhetische gibt, die er weiter in angenehme und schöne unterteilt, wobei Kunst allgemein Kant als Oberbegriff dient, den er zur Abgrenzung der Kunst von Natur, Wissenschaft und Handwerk gebraucht. Daraus ergibt sich für den Fortgang dieser Untersuchung die Fragestellung nach dem Verhältnis von KI zur mechanischen und ästhetischen Kunst, eine weiterführende Abgrenzung der Kunst von Natur, Wissenschaft und Handwerk unter dem Aspekt von KI würde den thematischen Rahmen dieser Untersuchung sprengen.
Dass in dieser Untersuchung über die schöne Kunst hinaus, auch die Kunst allgemein bezüglich des Vermögens von KI zur Schaffung schöner Kunst näher erörtert werden muss, hängt mit der mit dem Schöpfungsprozess unabdingbar verbundenen Freiheit zusammen. Freiheit ist nämlich für Kant nicht nur auf der Ebene der schönen Kunst sondern auch auf der höher angesiedelten Ebene der Kunst allgemein eine conditio sine qua non für das Zustandekommen von Kunst. Allerdings ist die Freiheit kein hinreichendes Argument für das Zustandekommen von schöner Kunst im Sinne Kants - dafür bedarf es der Genialität. Deswegen wird die Untersuchung nunmehr mit der Frage nach der Möglichkeit der Freiheit von KI als notwendiger Voraussetzung von Kunst - allgemeiner und somit auch schöner - fortgeführt. Daran anschließend, wird in Abschnitt 5.3 das Augenmerk auf die Genialität und die Frage nach der Möglichkeit genialer KI als hinreichender Bedingung für schöne Kunst gerichtet.
Für den Fortgang dieser Untersuchung ist es nicht unerheblich, Kants Freiheitskonzept kurz zu erläutern, da nur so ersichtlich wird, von welcher Freiheit jeweils die Rede sein soll. Grundsätzlich wird „Freiheit“ im für diese Untersuchung relevanten Teil von Kants kritischen Gesamtwerk als „Freiheit des Willens“ aufgefasst.
Als höchste Form, d. i. auf höchster Abstraktionsebene, sieht Kant die transzendentale Freiheit als letztlich bedingungslose und grundlose Freiheit an: „eine Unabhängigkeit dieser Vernunft selbst (in Ansehung ihrer Kausalität, eine Reihe von Erscheinungen anzufangen) von allen bestimmenden Ursachen der Sinnenwelt“218. Damit zeichnen sich Entscheidungen transzendentaler Freiheit für Kant dadurch aus, dass - sofern ihnen Überlegungen zugrunde liegen - diese selbst bedingungslos, d. i. frei, sein müssen.219 Da die Freiheit im künstlerischen Schöpfungsakt diese Bedingungslosigkeit nicht aufweist, bleibt die transzendentale Freiheit für den Fortgang dieser Untersuchung ohne Belang.220
Dies gilt in gleicher Weise für das, was Kant als sittliche Freiheit des Willens auffasst. Sittliche Freiheit sieht Kant dort gegeben, wo die Bestimmtheit des Wollens „rein durch die praktische Vernunft, das Bewußtsein des Sittengesetzes, die sittliche Idee“221 definiert wird, also dessen Unabhängigkeit von affizierender Triebhaftigkeit gegeben ist. Auch die sittliche Freiheit bleibt daher für den Fortgang dieser Untersuchung ohne Belang.
Für diese Untersuchung relevant, ist jene Freiheit, die Kant als „praktische Freiheit“ bezeichnet, eine Bezeichnung, für die er teilweise in der Kritik der Urteilskraft synonym den Begriff der „Willkür“ verwendet. Nach Kant tritt diese praktische Freiheit immer dort auf, wo der Mensch nicht durch die Sinne affiziert, sondern aus Vernunftgründen entscheidet:
Denn, nicht bloß das, was reizt, d.i. die Sinne unmittelbar affiziert, bestimmt die menschliche Willkür, sondern wir haben ein Vermögen, durch Vorstellungen von dem, was selbst auf entferntere Art nützlich oder schädlich ist, die Eindrücke auf unser sinnliches Begehrungsvermögen zu überwinden; diese Überlegungen aber von dem, was in Ansehung unseres ganzen Zustandes begehrungswert, d. i. gut und nützlich ist, beruhen auf der Vernunft.222
Praktische Freiheit ist demnach nicht bloß empirisch nachweisbar, sondern in ihrem Vernunftbezug auch mit kausaler Determiniertheit vereinbar.223 Diese auf Vernunftgründen basierte Entscheidung kann sich über den Augenblick hinaus auf längerfristige Zielsetzungen beziehen, weil sie den sinnlichen Reizen der augenblicklichen Situation enthebt. Erst diese Möglichkeit, die Bedingtheit des Augenblicks zu überwinden, eröffnet dem Kunstschaffenden die Möglichkeit schöpferischer Planung: Dadurch wird der Künstler in die Lage versetzt, auch längerfristig an einem Kunstwerk zu arbeiten.
Die praktische Freiheit im Kunstschaffen bleibt folglich stets an einen autonomen Menschen gebunden, der diese Autonomie in der Abgrenzung gegenüber der Subjektivität anderer Menschen gewinnt, was Kant wie folgt ausdrückt:
daß sie [hier: Freiheit im Kunstschaffenden, Hinzufügung der Autorin] durch keine Triebfeder zu einer Handlung bestimmt werden kann, als nur sofern der Mensch sie in seine Maxime aufgenommen hat (es sich zur allgemeinen Regel gemacht hat, nach der er sich verhalten will); so allein kann eine Triebfeder, welche sie auch sei, mit der absoluten Spontaneität der Willkür (der Freiheit) zusammen bestehen.224
In den Bereich des Kunstschaffens transferiert, folgt daraus, dass ein Kunstwerk dann freiheitlichen Ursprungs ist, wenn sein Schöpfer spontan, d. i. ohne Notwendigkeit und aus sich selbst heraus, Zwecke und Maximen des künstlerisches Aktes für sich und sein Kunstwerk festzulegen vermag.225 In diesem Zusammenhang kann dem Kunstschaffenden mit Kant praktische Freiheit zugesprochen werden, weil er zum Vermögen zur Selbstbestimmung und zum Handeln durch vernünftige Gründe befähigt ist.226 Auf die Begründung dieses Aspektes der Freiheit sei an dieser Stelle hinsichtlich der zu behandelnden Fragestellung und des begrenzten Umfangs dieser Untersuchung nicht weiter eingegangen,227 umfasst doch die Freiheitsproblematik in der Philosophie und hier speziell in der Beforschung der kantischen Kunsttheorie einen Umfang wissenschaftlicher Fragestellungen, den komplex zu nennen, reichlich untertrieben scheint und der mittlerweile in zahlreiche andere wissenschaftliche Disziplinen wie etwa Kognitionswissenschaft, Kunsttheorie und soziologische Kunstkonzepte ausstrahlt.
Zusammengefasst bleibt die Freiheit des Kunstschaffenden, trotz ihrer Unterwerfung unter Einschränkungen durch Vernunftgründe und sachliche Notwendigkeit, Kant spricht in diesem Zusammenhang von den „Regeln der Natur“228, was beispielsweise die Stofflichkeit eines Gemäldes meint, in ihrer Verortung in der praktischen Freiheit respektive der Willkürfähigkeit des entscheidenden Kunstschaffenden begründet: Vermöge dieser Freiheit erschafft der Kunstschaffende willkürlich kraft Vernunft und nach selbstbestimmten Zwecken und Maximen das Kunstwerk.
Beispielsweise entspringt die Idee der Arie des Sarastro In diesen heil’gen Hallen von Wolfgang A. Mozart der künstlerischen Freiheit des Komponisten, den Grundgedanken des freimaurerischen Weltbildes im beispielhaften Verhalten Sarastros darzustellen: Nur weil Mozart in seinem künstlerischen Komponieren frei ist, kann er seine freimaurerischen Wertmaßstäbe dem Hörenden musikalisch vermitteln.
Im Zusammenhang mit Kants „Willkür“-Begriff sei der in der modernen KI-Forschung in vielen theoretischen Konzeptionen zentrale Aspekt der Intentionalität kurz erörtert, der einerseits in einem engen inhaltlichen Bezug zum kantischen Konzept der Freiheit, d. i. Willkür, zu stehen scheint und andererseits in der zeitgenössischen philosophischen Debatte um Weak AI und Strong AI eine maßgebliche Rolle spielt und damit in den Bereich der thematischen Fragestellung dieser Arbeit auszustrahlen scheint. Doch was bedeutet
Intentionalität im Zusammenhang mit freiheitlicher Hervorbringung im Kunstschaffensprozess?
Spätestens seit Franz von Brentano wird Intentionalität als absichtliches Handeln aufgefasst, wobei Brentano die Intentionalität als mentale oder psychische Zustände ansieht, die er als „Merkmale des Geistigen“229 definiert.230 Auf diese Definition beziehen sich viele zeitgenössische Wissenschaftler, wenn sie heute unter „Intentionalität“ jene menschliche Fähigkeit ansehen, die es dem Menschen geistig ermöglicht, sich auf reale oder imaginierte Gegenstände, Eigenschaften oder Sachverhalte zu beziehen.231 Anders ausgedrückt: In seinem Denken vermag der Mensch einen intentionalen Bezug zu außerhalb seines Selbst liegenden Objekten seines Denkens herzustellen, indem er diese mit seinem Willen und Wollen verbindet. Auf diese Verbindung weist auch Nida-Rümelin hin, wenn er Freiheit, Intentionalität und Kontrolle in einer Wechselbeziehung zueinander sieht, bei der die Bestimmung des einen Begriffs die des anderen voraussetzt. Dadurch gelangt Nida-Rümelin zu der gewichtigen Unterscheidung zwischen Verhalten und Handeln: Verhalten ist für „den Organismus“ nicht autonom kontrollierbar, Handlung hingegen schon.232
Eine in Bezug zur Fragestellung der vorliegenden Arbeit fruchtbare Erweiterung dieser Definition entwickelt Nida-Rümelin in seiner Theorie Humanistischer Semantik, in der er das Momentum der Kausalität dem Begriff der Intentionalität zugesellt: Für Nida-Rümelin meint Intentionalität als Idee menschlicher Autorschaft „die besondere Fähigkeit von entwickelten Individuen der menschlichen Spezies, aus Gründen zu handeln.“233 Dieser Ansatz ist insofern relevant, als er der „grundlosen“ Intentionalität eine Intentionalität entgegenstellt, die als dem Menschen eigene Befähigung im schöpferischen Wirken - Nida- Rümelin spricht hier von „Autorschaft“ - über das reine Erstreben dessen reflexive Gebundenheit an menschliches Denken postuliert. Es liegt auf der Hand, dass hier Parallelen zum ästhetischen Geschmacksurteil Kants vorliegen, der eine „geistlose“, d. i. unreflektierte, Schöpfungskraft in seiner Kunsttheorie negiert.234
Zurecht verweist Nida-Rümelin daher auf eine untrennbare Wechselbeziehung zwischen intentionalem Handeln und im handelnden Urteilen verhafteter Autorschaft. Diese Festlegung umfasst prohairetische und epistemische Einstellungen, die unlösbar miteinander verwoben sind, weshalb die menschliche Autorschaft - zumindest im Idealfall - eine kohärente individuelle „Lebensform“ sowie eine Einheit propositionaler Einstellungen und alltäglicher Lebenspraxis bildet.235
Nida-Rümelin zeigt Intentionalität als Grundlage für die Fähigkeit der Kommunikation auf, möchte er seine These begründen, dass ein sprachlicher Ausdruck Bedeutung besitzt, „weil (und insofern) die Person, die diesen Ausdruck verwendet, damit eine Intention zu realisieren sucht.“236 An dieser Stelle soll auch auf Searles Chinesisches Zimmer verwiesen werden, zielt das Gedankenexperiment, das die Implikationen des Turingtests kritisiert, genau auf diese Verbindung zwischen Intention und sprachlichem Ausdruck ab.237
Die Möglichkeit der Sprache und der Kommunikation soll hier nicht weiter ausgeführt werden, obwohl Wortkunst Teil der Kunst ist, da dieser in Folge der engen Verzahnung von Sprache und Denken eine Sonderrolle zuzuschreiben wäre. Diese Zuschreibung hat Kant allerdings nicht näher untersucht, da er sie in seinem Konzept des ästhetischen Geschmacksurteils als dialektisch aufgehoben erachtet hat. Auf diese Sonderrolle der Wortkunst ist auch im Rahmen von Nida-Rümelins Theorie von Autorschaft nicht näher einzugehen, weil er als Charakteristika von Autorschaft die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten, sowie die intentionale Kontrolle und die Akteurskausalität ansieht.238
Nida-Rümelins Konzept der Autorschaft sieht praktische Vernunft, Freiheit und Verantwortung - alles Aspekte, die bezüglich der Debatte um Weak AI und Strong AI immer wieder zur Frage stehen - als unterschiedliche Aspekte von Autorschaft an, wobei Autorschaft wiederum auf der Affektion durch Gründe beruht.239
Diese Affektion durch Gründe lässt sich anhand dreier Ausdrücke akzentuieren: prohairesis krisi estin, synkatathesis und hormai logikai 240 Bei prohairesis krisi estin wird die vernünftige Praxis dem theoretischen Urteil angeglichen bzw. angenommen, dass sie auf ihm beruht. Dabei ist die handlungsleitende Entscheidung kein Ergebnis eines kausalen Prozesses gegebener Wünsche zu einem diese realisierenden Verhalten. synkatathesis betont den Entscheidungscharakter von Einstellungen. Einstellungen unterliegen unserem Willen und beinhalten einen Akt der Zustimmung. hormai logikai führt Autorschaft auf dasjenige zurück, was vernünftige von unvernünftigen Neigungen unterscheidet. Dabei werden Neigungen, Begehren oder desires gleich anderen Vorgängen in der empirischen Welt zur Kenntnis genommen, egal ob sie nun innere oder äußere sind. Konstituierend für Autorschaft ist dann das wertende Urteil, der Akt der Zustimmung (synkatathesis) oder die Fähigkeit, vernünftige von unvernünftigen hormai zu unterscheiden. Als Autor seines Lebens ist man stets an dieses Urteils- und Unterscheidungsvermögen gebunden, das praktische Vernunft ausmacht.240 241
Nida-Rümelin trifft in seiner Theorie von Autorschaft darüber hinaus eine wichtige Unterscheidung, nämlich die, zwischen Intentionalität, genauer: intentionalem Handeln, und Verhalten.242 Für ihn steht fest: „Bloßes Verhalten, auch solches, das eine spezifische Regelhaftigkeit aufweist, ist kein Handeln.“243 Das bedeutet: „bloßes Verhalten“ bedingt noch lange kein genuines Handeln. Die Unterscheidung dafür liegt in der intentionalen Kontrolle, d. i. die Verbindung von Intentionalität - als Komplex mentaler Prozesse - mit Verhalten - das äußerlich manifestiert ist - und sodurch die Autorschaft konstituiert.
Eine Handlung ist also ein Verhalten einer Person, für das sie Gründe anführen kann. Diese Gründe sind dabei auf einen praktischen oder theoretischen Hintergrund des Fraglosen und Selbstverständlichen bezogen, für das keine Gründe angeführt werden können, ohne aus der geteilten Lebensform herauszufallen.244
Diese Autorschaft bettet Nida-Rümelin in ein konzeptuelles Gefüge ein, indem „das Geben und Nehmen von Gründen für Überzeugungen und Handlungen sowie für Emotionen oder emotionale Einstellungen“245 von zentraler Bedeutung sind. Aufgrund dieses Bedeutungszusammenhangs ergibt sich die Möglichkeit zur Intentionalität, die Autorschaft ausmacht und den Autor als Akteur in die Lage versetzt, Gründe für seine Handlungen anzugeben, die normativ, objektiv und nicht-algorithmisch sein müssen. Dadurch wird ein Akteur durch Intentionalität definiert und von der KI prinzipiell geschieden.246 Deshalb kann KI nicht als Akteur gelten und somit ihr auch nicht all die Statuszuschreibungen zugesprochen werden, die daraus resultieren, wie etwa Verantwortung.247
Auf die Fragestellung dieser Untersuchung übertragen, lässt sich somit festhalten, dass Intentionalität im künstlerischen Schaffensprozess nur dann Relevanz zuzusprechen ist, wenn diese Intentionalität - in Abgrenzung zu bloßem Verhalten - die Qualität von „Autorschaft“, d. i. intentionales Handeln mit reflexiver Begründung, zu erlangen vermag. KI wäre demnach zu künstlerischem Schaffen in der Lage, wenn KI zu Autorschaft in der Lage wäre. Da KI jedoch lediglich innerhalb ihrer Programmierung zu agieren vermag - ob dieses Agieren bereits als „Verhalten“ anzusehen wäre, sei dahingestellt - ist sie weder in der Lage, selbstständig, d. i. aus eigener Intentionalität heraus, noch begründet zu handeln. Damit ist KI per se jede Form von Autorschaft und damit zur Möglichkeit künstlerischen Schaffens unter intentionalem Aspekt abzusprechen.
Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen zu Kants Konzeption von Freiheit und deren Ausfluss in zeitgenössische philosophische Freiheitskonzepte, die letztlich in die Konzepte von Intentionalität und Autorschaft münden, soll nunmehr die Ausgangsfrage wieder in den Blickpunkt rücken, wie sich Kants Konzept von Freiheit auf seine Konzeption von Kunst auswirkt.
Daher soll nun zunächst überprüft werden, ob und wie KI über die Fähigkeit verfügt, mechanische Kunst im Sinne Kants zu schaffen. Wie obig ausgeführt, fällt für Kant jenes Kunstschaffen unter die mechanische Kunst, das lediglich „die erforderlichen Handlungen nach Anleitung ausführt, um ein Produkt zu schaffen“248. Anders ausgedrückt: Mechanische Kunst bleibt in ihrem Wesen regelgebunden. Unter „Regelgebundenheit“ versteht Kant, wie bereits oben ausgeführt, einerseits die Verpflichtung des Kunstwerks der Natur gegenüber und andererseits ihre notwendige Bindung an ein in stofflicher Verarbeitung und Formgebung „durch die Schule gebildetes Talent“249.
Angesichts der bislang erzielten technischen Fortschritte ist davon auszugehen, dass KI bereits heute in der Lage ist, dieser Forderung nach Regelgebundenheit mechanischer Kunst insofern zu genügen, als KI nicht nur in Musik und Malerei über das technische Rüstzeug verfügt, die Ausgestaltung mannigfaltiger Kunstwerke zu meistern. Wird beispielsweise eine KI mit sämtlichen Nuancen der Farbgebung und der Pinselführung eines Rembrandts „gefüttert“, kann sie diese technischen Befähigungen vermutlich so auf ein anderes Sujet übertragen, dass diese KI Leonardos Abendmahl „wie von Rembrandts eigener Hand geschaffen“ erzeugen könnte.
Durch die Koppelung des Kunstschaffens an Freiheit wäre KI allerdings nur dann befähigt, im Sinne Kants mechanische Kunst zu schaffen, wenn sie in diesem Schaffen frei wäre. Jedoch wäre es denkbar, dass KI - obwohl prinzipiell mangels der Fähigkeit zur Willkür zu praktischen Freiheit nicht fähig -250 in seinem künstlerischen Schaffen die Anmutung von Freiheit erzeugen könnte: Je präziser die schöpferischen Rahmenbedingungen definiert, je engmaschiger das Netz künstlerischer Vorgaben, desto eher wäre KI zu dieser Anscheinsbildung in der Lage. Gelingen kann diese Anscheinsbildung prinzipiell jedoch nur dadurch, dass ihr ein Mensch ein freiheitliches Momentum eingibt: KI kann - unabhängig von der maltechnischen Umsetzung - nicht aus sich selbst entscheiden, ob sie einen Baum oder einen Fisch malen will. Damit steht fest, dass KI trotz allem möglichen vorhandenen technischen Vermögen und trotz des Befolgens der erforderlichen Regeln keine mechanische Kunst im Sinne Kants zu schaffen vermag, weil ihr das dazu notwendige Momentum der praktischen Freiheit abgeht.
Anders als bei der mechanischen Kunst sieht Kant in der ästhetischen Kunst „das Gefühl der Lust zur unmittelbaren Absicht“251 gegeben, durch die das Kunstwerk beim Betrachtenden die Lust als Erkenntnis begleitet, wodurch die Lust zum Selbstzweck des Kunstwerks wird.
Auf die Problemstellung dieser Untersuchung bezogen, stellt sich damit die Frage, ob KI in der Lage ist, Kunstwerke zu schaffen, die diese Lust zu evozieren vermögen, anders formuliert: Kann KI ästhetische als angenehme Kunst im kantischen Sinne schaffen?
Wie in 3.4 erläutert, zielt angenehme Kunst für Kant auf jenen sinnlichen Effekt, den die angenehme Kunst in ihrem Rezipienten in der Form zu entfalten vermag, dass selbiger einen Genuss empfindet.252 In diesem Zusammenhang führt Kant das Tafelvernügen in einer lebhaften Gesellschaft an.253 Alle angenehme Kunst ist als solche in der Lage, diesen Genuss hervorzurufen, weil sich dieser Genuss aus dem Kunstobjekt selbst ergibt: Das Angenehme im Kunstobjekt ist stets an den Genuss seiner Wahrnehmung gekoppelt.
Wenn KI angenehme Kunst im kantischen Sinne herzustellen vermag, müsste sie demnach Kunstobjekte zu schaffen in der Lage sein, die beim Betrachtenden Genuss hervorzurufen vermögen, das ist, als angenehm empfunden zu werden. Wie die technischen Erfolge, die KI auf künstlerischer Ebene in jüngster Vergangenheit erzielte, nachdrücklich belegen, kann davon ausgegangen werden, dass KI diesen Anforderungen zu entsprechen vermag. So sind beispielsweise durch KI erzeugte Musikstücke oder Gemälde durchaus in der Lage, beim menschlichen Rezipienten als „Kunst“ wahrgenommen zu werden, weil sie den von Kant als Anspruch eingeforderten „Genuss“ hervorzubringen verstehen.
Daraus folgt, dass KI bereits heute technisch dazu in der Lage ist, nicht nur mechanische, sondern auch ästhetische und hier angenehme Kunst hervorzubringen - wobei diese Hervorbringung letztlich- wie die durch KI geschaffene mechanische Kunst - ebenfalls lediglich Simulationscharakter zu erlangen vermag: Auch dieser Hervorbringung angenehmer Kunst durch KI mangelt es an jenem notwendigen Momentum, das für Kant prinzipiell aller Kunst beigefügt sein muss - der praktischen Freiheit.
Der Einwand, der im Sinne Kants der Schaffung mechanischer und angenehmer Kunst durch KI entgegensteht - das Fehlen der praktischen Freiheit, d. i. Willkür - gilt selbstverständlich auch bezüglich der schönen Kunst: Da alle Kunst als conditio sine qua non der praktischen Freiheit bedarf, bedarf ihrer auch die schöne Kunst. Damit wäre im Grunde die Ausgangsfrage dieser Untersuchung, nämlich die Frage, warum KI keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorbringen kann, beantwortet: Da KI keine praktische Freiheit kann, kann sie auch keine Kunst allgemein und damit auch keine schöne Kunst, schaffen.
Dieser Sachverhalt lässt sich in nachfolgenden beiden Syllogismen verdeutlichen:
(P1) Die Hervorbringung von Kunst allgemein erfordert Freiheit.
(P2) KI ist prinzipiell zur Freiheit nicht fähig.
(K) KI kann keine Kunst allgemein hervorbringen.
(P1) KI kann keine Kunst allgemein hervorbringen.
(P2) Schöne Kunst ist eine Art der Gattung Kunst allgemein.
(K) KI kann keine schöne Kunst hervorbringen.
Allerdings gibt diese Antwort auf die Forschungsfrage nur an, warum KI aufgrund des Fehlens einer notwendigen Bedingung schöne Kunst im Sinne Kants nicht zu schaffen vermag. Ebenfalls lässt sich festhalten, dass KI mangels Freiheit auch die Intentionalität im schöpferischen Prozess abzusprechen bleibt. Die Frage, was KI vom menschlichen Künstler darüber hinaus von KI unterscheidet, soll dadurch beantwortet werden, dass aufgezeigt wird, was den Künstler hinreichend zu definieren vermag.
Wird der kantische Kunstbegriff logisch näher untersucht, kann er hinsichtlich seiner Prämissen wie folgt aufgeteilt werden: Das von Kant als „Willkür“ bezeichnete Moment der Freiheit, deren Wirkung die freiheitliche Hervorbringung ist, lässt sich als notwendige Prämisse des kantischen Kunstbegriffs definieren. Demgegenüber wäre Genialität als eine seiner hinreichenden Prämissen anzusehen. Doch wieso ist diese Unterscheidung gerechtfertigt?
Genialität ist insofern als hinreichende Bedingung für das Zustandekommen schöner Kunst anzusehen, als Genialität prinzipiell stets praktische Freiheit innewohnt: Ohne diese praktische Freiheit kann es keine Genialität geben. Hinreichend als Bedingung schöner Kunst wird Genialität dadurch, dass sie das Momentum der praktischen Freiheit im künstlerischen Schöpfungsakt in seiner natürlichen Regelgebundenheit in beispielsetzender Weise im Kunstwerk zu manifestieren vermag. In einem nächsten Arbeitsschritt soll nunmehr untersucht werden, inwieweit KI zu dieser Genialität und damit zu schöner Kunst im Sinne Kants befähigt ist.
5.3 Kann KI schöne Kunst schaffen? Das Genie als hinreichende Bedingung des schöne Kunst Schaffens
Da der Genialität in Kants Konzept der schönen Kunst eine zentrale Funktion zukommt, ist es angebracht, das Verhältnis von Genialität und KI näher auszuleuchten, da die Abklärung dieses Verhältnisses entscheidend zur Beantwortung der Fragestellung dieser Untersuchung beizutragen vermag, weil sie die hinreichende Seite dieser Fragestellung klärt. Diese Abklärung orientiert sich an den oben bereits ausführlich dargelegten vier kantischen Charakteristika von Genialität.
Das erste charakteristische Merkmal, das Kant Genialität zuspricht, lässt sich unter dem Begriff „Originalität“ subsumieren. Damit ist jenes Talent des Genialen gemeint, über die vorgegebenen Regeln der Kunstschulen und -richtungen hinaus, aber unter Berücksichtigung der Regeln des Natürlichen, eigene Regeln in den Prozess der Erschaffung schöner Kunst einfließen zu lassen.254 Erst dadurch wird ein Kunstschaffender qua seiner Genialität in die Lage versetzt, die Erschaffung schöner Kunst nach eigenen Regeln umzusetzen. Was bedeutet dieses Charakteristikum im konkreten künstlerischen Schaffensprozess?
Nimmt man beispielsweise einen Maler, der schöne Kunst in einem Gemälde zu realisieren trachtet. Da wären zunächst die Materialien wie Leinwand und Farbe, die seinen schöpferischen Prozess als Regeln des Natürlichen begrenzen: Die Leinwand weist ein bestimmtes Format auf, hat eine unveränderliche stoffliche Struktur und reagiert in je eigener Weise auf die aufgetragenen Farben. Die Farben selbst sind in ihrer chemischen Struktur, in ihrer Farblichkeit und in ihrem Verarbeitungsverhalten ebenfalls jeweils spezifisch. Leinwand und Farben geben demnach dem Maler natürliche Bedingungen vor, die sich seinem verändernden Zutun entziehen.
Zu diesen natürlichen Regeln gesellen sich jene Regeln, die dem Maler bestimmte Kunstschulen und -richtungen vorgeben. Im Gegensatz zu den natürlichen Regeln, denen der Maler im Malprozess unterworfen bleibt, hat er bei diesen Regelungen die Möglichkeit, sie ganz oder teilweise zu hinterfragen, respektive durch eigene - Kant würde von willkürlicher vernunftgegebener Regelsetzung sprechen - zu ersetzen. In der Praxis dürfte sich die Regelbindung bei einem Maler in diesem Bereich primär auf maltechnische Vorgaben begrenzen. Auch wer völlig Neues zu schaffen gewillt ist, wird nicht umhinkönnen, beispielsweise auf erlernte Pinselführung, erlernten Farbauftrag und bestimmte Maltechniken zurückzugreifen: Die Auffassung der genialen Impressionisten, bildliche Darstellungen in einzelne Farbpunkte aufzulösen, war seinerzeit nach geradezu revolutionär, die Pinselhandhabung hingegen durchaus konventionell. In dem aufgezeigten Beispiel erweist sich die Originalität des Malers darin, dass er trotz der Eingebundenheit in die vorgegebenen natürlichen Regeln unter Überwindung jener Regeln, die ihm Kunstschulen und -richtungen vorgeben, nach freier respektive willkürlicher Regelsetzung aus sich selbst heraus im künstlerischen Prozess das zu schaffen vermag, was Kant als „schöne Kunst“ bezeichnet.
Wird dieser Begriff der Originalität auf KI übertragen, bleibt festzuhalten, dass KI - wie ihr geniales menschliches Pendant auch - sehr wohl an die natürlichen Regeln sowie Kunstschulen und -richtungen gebunden bleibt, nichtsdestoweniger jedoch nicht über die Gabe verfügt, im künstlerischen Schaffensprozess über diese Regelvorgaben hinaus, eigene Regeln aus sich heraus zu postulieren und im schönen Kunstwerk zu realisieren. Die Voraussetzung dafür, im künstlerischen Schaffensprozess eo ipse eigene Regeln aufzustellen, stellt für Kant das Vermögen zur Willkür dar.
Da KI nicht willkürlich, d. i. aus eigener (praktischer) Freiheit, zu „entscheiden“ vermag, kann KI keine Originalität im Sinne kantischer Genialität zugesprochen werden. Dieser Mangel an Willkür resultiert aus dem Faktum, dass KI prinzipiell an ihren „Input“, also jene Informationen gebunden bleibt, die, Prämissen gleich, den Rahmen determinieren, innerhalb dessen jede mögliche Entscheidung der KI begrenzt bleibt: Der Programmierer programmiert Regeln und Informationsbausteine in die KI ein und begrenzt dadurch prinzipiell die Menge der durch die KI möglichen Ergebnisse.
Wenn zuweilen im Zusammenhang mit dem Konzept der Strong AI die Behauptung aufgestellt wird, dass die Entscheidungsfindung aufgrund der Komplexität ihres Zustandekommens innerhalb der KI quasi als sogenannte „Black-Box“-Entscheidung dem menschlichen Verstehen enthoben bleibe, so ist diese Behauptung nur bedingt richtig. Auch wenn eine große Anzahl von Rechenschritten dem Entscheidungsergebnis vorangehen mögen, bleiben diese prinzipiell dem denkenden Menschen nachvollziehbar. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: An den Stränden dieser Welt mag die Anzahl der Sandkörner eine große sein, sie ist dennoch eine endliche, da die Erde als Ganze eine endliche Anzahl von Teilchen umfasst. Die Tatsache, dass es der Mensch nicht vermag, eine größere Anzahl an Sandkörnern oder Teilchen abzuzählen, spricht prinzipiell gegen das
Zählvermögen des Menschen, beweist jedoch keinesfalls die Unendlichkeit des zu Zählenden. Analog verhält es sich mit den der Entscheidungen von KI zugrundeliegenden Rechenschritten.
Als Ausfluss dieses Ergebnisses ist die Frage anzusehen, inwieweit KI Fälschungen hervorbringen kann. Fälschungen im Bereich der Kunst lassen sich grundsätzlich in zwei Arten unterscheiden. Die erste Art meint Kunstwerke, die bestehende Kunstwerke wiedergeben und den Betrachtenden über die Urheberschaft des Werkes zu täuschen trachten. Insbesondere in der bildenden Kunst sind immer wieder gefälschte Werke hervorgebracht worden, die vorgeben, ein bestimmtes Kunstwerk zu sein, das sie nicht sind. Vergleichbar der Fälschung von Banknoten, intendieren diese Nachahmungen eine Zusprechung, die dem Fälscher in der Regel pekuniäre Vorteile ermöglichen sollen. Daraus folgt, dass es zur Fälschung nicht ausreicht, etwas herzustellen, das einem bestimmten Kunstwerk zum Verwechseln ähnlich sieht, sondern von diesem Nachahmungswerk in betrügerischer Absicht Gebrauch gemacht werden muss. Bloßes Kopieren ist noch kein Fälschen, sofern die Kopie nicht den Status des Originals beansprucht.255
Die zweite Art der Fälschung, die in der heutigen Zeit dadurch an Umfang zugenommen hat, dass die berühmten - und damit teuren - Kunstwerke samt ihrer Provenienz bestens dokumentiert und öffentlich bekannt sind, besteht darin, stilistisch nachzuahmen. Hier wäre beispielsweise ein Wolfgang Beltracchi anzuführen, der über stilistische Merkmale, wie Farbgebung und Pinselführung hinaus, selbst bei der Wahl geeigneter Leinwände mit krimineller Energie Werke schuf, die selbst von Experten etwa einem Heinrich Campendonk, einem Max Ernst oder einem Max Pechstein als bislang „verschollene“ Werke zugesprochen wurden.256 Im Gegensatz zur Gruppe der ersten Fälschungen umfassen die Fälschungen der zweiten Gruppe „neue“ Werke bekannter Künstler und sind keine Kopien existierender Werke. In dieser Gruppe wird für das „Wie“ und nicht für das „Was“ des gefälschten Kunstwerks in täuschender Absicht die Zuschreibung zu dem Oeuvre eines bekannten - und demzufolge teuer gehandelten - Künstlers erstrebt.
Unter kunsttheoretischem bzw. philosophieästhetischem Aspekt stellt sich hier die Frage, was an der Unterscheidung zwischen Fälschung und Original liegt? Wenn Fälschungen nicht - oder nur sehr schwer - von Originalen zu unterscheiden sind: Darf dann die Fälschung nicht in gleicher Weise den Anspruch erheben, Kunstwerk zu sein, zumal sie dem ästhetischen Geschmacksurteil ein solches zu sein scheint?
Um das dieser Fragestellung zugrundeliegende Problem zu veranschaulichen, sei hier an Nelson Goodmans‘ Gedankenexperiment erinnert, das er in seinem Werk Languages of Art wie folgt beschreibt: Man stelle sich zwei Bilder an einer Wand vor. Links ein „originales“ Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, rechts eine ausgezeichnete Kopie davon aus dem 19. Jahrhundert, die dem Original derart gleicht, dass mit dem bloßen Auge keine Unterschiede festzustellen seien. Wenn nun in der Abwesenheit des Betrachtenden die Bilder getauscht werden und der Betrachtende somit nicht mehr mit Sicherheit feststellen kann, welches nun das Original und welches die Fälschung sei, stellt sich die Frage, ob irgendeine ästhetische Differenz zwischen den beiden Werken besteht. Denn alle Unterschiede, etwa Autorschaft, Alter und chemische und physikalische Beschaffenheit, sind ästhetisch irrelevant. Goodman stellt die These auf, dass es ästhetisch dennoch relevant sei, dass es sich einerseits um ein Original und andererseits um eine Fälschung handele. Doch wieso sollte dem so sein?257
Gesetzt den Fall, die beiden Werke ähneln sich, dann ergibt sich aus dem Ausmaß der Ähnlichkeit folgende Lösungsmöglichkeit für das von Goodman aufgeworfene Problem: Ist die Ähnlichkeit so groß, dass es dem ästhetischen Geschmacksurteil anhand von differenzierbaren Merkmalen möglich ist, unterschiedliche Genialität zuzusprechen, kann aufgrund dieser Unterschiedlichkeit das geniale Original von der weniger genialen Fälschung geschieden werden, da die Fälschung lediglich die Anmutung von genialer Originalität vorzubringen vermag, weil sie dem Betrachter angenehm scheint.
Ist die Ähnlichkeit so groß, dass es dem ästhetischen Geschmacksurteil anhand von differenzierbaren Merkmalen nicht möglich ist, unterschiedliche Genialität zuzusprechen, dann wäre beiden Kunstwerken der gleiche Grad an Originalität zuzusprechen - was zur Folge hätte, dass je nach dem Grad dieser Originalität beide Kunstwerke Originale oder Fälschungen sein könnten. In der Praxis dürfte es sich mit den Voraussetzungen dieses Experiments allerdings ähnlich wie mit jenen des philosophischen Gleichnisses von Buridans Esel258 verhalten: Bereits die räumliche Unterscheidung - keines der Bilder und keiner der Heuhaufen kann zusammen mit dem jeweils anderen zur gleichen Zeit die gleiche Raumlage einnehmen - weist die tatsächliche Unmöglichkeit beider Gedankenspiele auf.259
Für die Frage nach Original und Fälschung eines Kunstwerks bleibt daher festzuhalten, dass sich auch bei gegebener Ähnlichkeit die größere Originalität als Element des Genialen, das dem Kunstwerk die Anmutung schöner Kunst zu verleihen vermag, als für das ästhetische Geschmacksurteil letztlich Unterscheidende aufzeigen lassen muss.
Unter dem Aspekt des Begriffs der schönen Kunst nach Kant bleibt Goodmans Gedankenexperiment insgesamt insofern ohne Relevanz, als es zum Kunstwerk hin die Betrachtungsperspektive einnimmt - Kant hingegen mit seinem Konzept der Genialität auf die Schöpfungsperspektive abhebt: Selbst wenn das ästhetische Geschmacksurteil des Betrachtenden dem Kunstwerk Originalität als Ausweis von Genialität zusprechen sollte, wäre diese Zusprechung unerheblich, da sie sich auf die Wirkung des Kunstwerks auf den Betrachtenden bezieht. Relevant bleibt die Zusprechung des Attributs „schön“ des Kunstwerks nur dann, wenn sie sich auf die Perspektive des Schaffens bezieht und sich die Genialität des Künstlers als Schönheit des Kunstwerks zu manifestieren vermag. Denn wie in Abschnitt 3.2 dargelegt, kann das ästhetische Geschmacksurteil, da es in einer „als-ob- Struktur“260 zum logischen Erkenntnisurteil steht, einem Irrtum obliegen, sofern es sich nur auf die Wirkung des Kunstwerks auf den Betrachtenden bezieht.
Das zweite Charakteristikum von Genialität ist die Exemplarität. Darunter versteht man wie oben ausgeführt, mit Kant, das Vermögen des Kunstschaffenden, über die Originalität hinaus, in seinem schönen Kunstwerk in Richtmaß und Regel der Beurteilung des schönen Kunstwerkes Musterstatus zu erlangen:261 Die Exemplarität verleiht dem Kunstwerk den Status, anderen Kunstschaffenden als Objekt der Nachahmung dienen zu können.
Als Beispiel genialischer Exemplarität mag hier der Vitruvianische Mensch da Vincis angeführt werden, indem da Vinci in idealisierter Form die menschlichen Proportionen an einem Mann mit ausgestreckten Extremitäten in Relation zu Kreis und Quadrat zu Papier gebracht hat. Diese Skizze entspricht insofern in exemplarischer Weise dem, was Kant unter genialischer Exemplarität postuliert, als sie bis in die Neuzeit hinein zum Studienobjekt unzähliger Maler geworden ist.
Wird die Möglichkeit von KI hinsichtlich möglicher exemplarischer Vermögen in ihrem Bezug auf die schöne Kunst Kants geprüft, stellt sich alsbald die Erkenntnis ein, dass KI dazu nicht in der Lage ist. Dieses Unvermögen resultiert aus dem Sachverhalt, dass die Möglichkeit genialischer Exemplarität an die Möglichkeit der Originalität gekoppelt bleibt. Weil KI bei der Schaffung von Kunst stets an den sie bedingenden Input, etwa die Vorgaben der Kunstschulen und -richtungen sowie die natürlichen Regeln gebunden bleibt und mangels der Befähigung zur Willkür nichts diese Gebundenheit Überschreitendes zu schaffen vermag, bleibt von KI Geschaffenes permanent innerhalb vorgegebener Grenzen. Diese Bedingtheit verhindert, dass KI „grenzensprengendes“ originell Neues und dadurch zugleich Exemplarisches schaffen kann. Als Beispiel dieser Bedingtheit mag das oben erwähnte von KI geschaffene Porträt Edmond de Belamy dienen, das aufgrund seiner Programmierung innerhalb der verwendeten kunsthistorischen Stilmittel der eingegebenen Malepoche verharrt, diese Stilmittel jedoch nicht willkürlich in genialischer Weise zu eigener Exemplarität fortzuführen vermag.
Als drittes Charakteristikum von Genialität führt Kant die „Unerklärbarkeit“ an.262 Wie bereits erläutert, versteht Kant darunter, die Tatsache, dass das Genie als Schöpfer schöner Kunst sich weder selbst beschreiben noch wissenschaftlich nachvollziehen kann. Über die Grenzen des ästhetischen Geschmacksurteils hinaus, ist das Genie zudem nicht in der Lage, das von ihm Geschaffene begrifflich zu erklären.263
Diese Unerklärbarkeit im genialen Kunstschaffen kann KI nicht zugesprochen werden, da KI in ihrer logischen Strukturierung nachgerade zu den Gegenpol zu jenem ästhetischen Geschmacksurteil darstellt und das die Voraussetzung einer genialen Schöpfung bildet. Fehlt das Momentum der Willkür, bleibt der schöpferische Prozess unoriginell und nicht exemplarisch, zum schönen Kunstwerk fehlt zudem die genialische Unerklärbarkeit. Vereinfachend lässt sich festhalten: Was die Grenzen der Logik und ihrer Begrifflichkeit nicht im ästhetischen Geschmacksurteil aufzuheben vermag, vermag auch nicht die Genialität bedingende Willkür genialischer Unerklärbarkeit zu erreichen.
Über Originalität, Exemplarität und Unerklärbarkeit hinaus, rechnet Kant den Naturbezug zu jenen Charakteristika, die Genialität als Voraussetzung für schöne Kunst bilden.264 Entsprechend der oben ausgeführten Definition sieht Kant das Genie in einem dialektischen Prozess den Regeln der Natur unterworfen. Zwar entstammt der schöpferische Impuls zur Erschaffung schöner Kunst der Genialität des Kunstschaffenden, doch der schöpferische Prozess als solcher bleibt natürlichen Ursprungs.265 Erst durch diese dialektische Verwobenheit von Genie und Natur kann nach Kant das Entstehen dessen gelingen, was mit der Auszeichnung als „schöne Kunst“ vor dem ästhetischen Geschmacksurteil - bezogen auf den Prozess des Kunstschaffens und erst davon abgeleitet auch des Kunstwerkes - des Betrachtenden zu bestehen vermag.
Um diesen Sachverhalt beispielhaft zu verdeutlichen, soll hier auf jenen Bereich der bildenden Kunst verwiesen werden, der kunsthistorisch mit dem Attribut „naiv“ versehen wird.266 Ein Maler wie Henri J. F. Rousseau etwa versteht es in meisterhafter Weise, eigene Genialität dialektisch mit Elementen sogenannter „naiver“ Natürlichkeit zu verschränken, die ihn zur Hervorbringung von Werken in die Lage versetzt, die dem Anspruch Kants an schöne Kunst durchaus zu entsprechen vermögen. Zugleich manifestieren Rousseaus Werke eindrucksvoll das harmonisierende Miteinander aller vier genialischer Charakteristika.
Nunmehr bleibt noch zu überprüfen, wie KI im Verhältnis zu diesem genialen Charakteristikum einzustufen ist. Dass KI diesem Merkmal nicht zu genügen vermag, hat im Wesentlichen zwei Ursachen: Das ästhetische Geschmacksurteil und die natürliche Hervorbringung.
Aufgrund ihrer logischen Bedingtheit stehen die mathematischen Strukturen, auf denen KI beruht, im diametralen Gegensatz zum Ästhetischen. Während das Logische immer zugleich dem Postulat der Objektivität unterworfen bleibt, ist das Ästhetische Ausfluss absoluter Subjektivität. In dieser Subjektivität entfaltet sich menschliche Individualität in ihrer ästhetischen Dimension und in permanenter Abgrenzung zu Objektivität. In diesem Sinne begreift Kant das Natürliche in seiner Regelhaftigkeit und damit seiner Objektivität stets als dialektisch im Ästhetischen aufgehoben. Es bedarf des Genies, diese Aufhebung im schöpferischen Akt zu überwinden und Logik und Ästhetik im schönen Kunstwerk zu vereinen.
Es liegt auf der Hand, dass KI in ihrer logischen Determination vom dialektischen Überschreiten des Natürlichen ausgeschlossen bleibt. Die Folge, die sich aus dieser Gegensätzlichkeit für den schöpferischen Prozess ergibt, ist diejenige, dass KI, weil zur dialektischen Überwindung von objektiver Regelhaftigkeit durch geniale Subjektivität nicht geschaffen, ohne Genialität bleiben muss.
In Beantwortung der Ausgangsfrage dieses Abschnitts, ob KI Genialität zuzusprechen wäre, lässt sich damit zusammenfassend festhalten: Da KI keines der vier Charakteristika von Genialität aufweist, ist KI Genialität im Sinne Kants abzusprechen. Damit entfällt zugleich eine hinreichende Bedingung, schöne Kunst im Sinne Kants zu schaffen.
Im Rückgriff auf die oben getroffene Unterscheidung zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung für schöne Kunst, kann darüber hinaus konstatiert werden, dass durch das Fehlen von praktischer Freiheit die notwendige und durch das Fehlen von Genialität auch die hinreichende Voraussetzung zur Hervorbringung schöner Kunst im Sinne Kants durch KI fehlen.
Im zusammenfassenden Rückblick auf den bisherigen Verlauf der Untersuchung der Forschungsfrage kann als Ergebnis festgehalten werden, dass KI keine schöne Kunst im Sinne Kants hervorzubringen vermag. Damit stellt sich zugleich die über die Forschungsfrage dieser Untersuchung hinausweisende Frage, ob KI zur Kunst im zeitgenössischen Sinne befähigt ist, deren Beantwortung dem Abschnitt 6 dieser Untersuchung vorbehalten bleibt.
6 Eine zeitgenössische Ausweitung des kantischen Kunstbegriffs im Zeitalter der KI: Das Prinzip der Autorschaft als Prämisse für Kunst
Um diese erweiterte Untersuchung methodisch korrekt einordnen zu können, scheint es geraten, einen kurzen zusammenfassenden Rückblick auf den bislang beschrittenen Weg zu werfen. Auf eine kurze philosophiehistorische Retrospektive ist die Ausarbeitung des Kunstbegriffs bei Kant mit besonderer Berücksichtigung dessen erfolgt, was Kant „schöne Kunst“ nennt. Nachdem dieser Begriff mit seinen Prämissen - insbesondere der Genialität - herausgearbeitet worden ist, ist eine Gegenüberstellung des kantischen Kunstkonzepts und der KI in ihren künstlerischen Möglichkeiten erfolgt. Als Ergebnis dieser Gegenüberstellung hat sich erwiesen, dass KI schöne Kunst im Sinne Kants nicht zu schaffen vermag: Kant fordert als conditio sine qua non für das Entstehen von Kunst Genialität - dem technischen Vermögen seiner Zeit geschuldet - menschliche Genialität. Dadurch, dass bei der Untersuchung von Genialität auf die ihr zugrundeliegende Autorschaft als Abgrenzung zwischen Verhalten und Handeln abgehoben worden ist, hat sich herausgestellt, dass KI lediglich zu Verhalten und nicht zum Handeln in der Lage ist und daher eine zentrale Prämisse der Möglichkeit schöpferischen Kunstschaffens nicht zu erfüllen vermag, weil KI per se nicht über Freiheit verfügt. Allerdings hat sich damit zugleich die faszinierende Frage aufgetan, ob KI Kunst im nicht-kantischen Sinne, d. i. im die kantische Definition überschreitenden Sinne, Kunst zu schaffen vermag.
In Beantwortung dieser über die Ausgangsfrage hinausweisenden Fragestellung, sollen im Folgenden zunächst zwei Definitionen von Kunst vorgestellt werden, anhand derer am Kriterium der Autorschaft die Möglichkeit von KI im Sinne dieser beiden Definitionen Kunstwerke zu schaffen, untersucht wird: An beiden Definitionen soll dabei der jeweilige Akteur herausgearbeitet und in Relation zu KI gesetzt werden. Diese Einengung der Untersuchung auf den Akteur erscheint insofern gerechtfertigt, als der Akteur sich bei Kant als Prämisse von Genialität, die schöne Kunst schafft und Hervorbringung durch Freiheit, die Kunst im Allgemeinen schafft, erwiesen hat.
Diese fundamentale Bedeutung des Akteurs im Zusammenhang mit Kunst auf über Kant hinausgehende Kunstdefinitionen auszuweiten, wird dadurch methodisch rechtfertigt, dass der Begriffsumfang des jeweiligen Kunstbegriffs nicht der Kausalität von Schöpfer und Kunstwerk enthoben werden kann, ohne in eine den Kunstbegriff entwertende Konzeption allgemeiner Beliebigkeit zu verfallen: Wenn die Rolle des Akteurs im Zusammenhang zum Schöpfungswerk bei Kant eine kausale ist, dann deshalb, weil sie für jeden Kunstbegriff als kausale Determinante vorausgesetzt werden kann. Auf diesen Zusammenhang hat Nida- Rümelin abgehoben, wenn er Verhalten von Handeln gegeneinander abgrenzt.267
Bei der Auswahl der für diese erweiterte Untersuchung zu Grunde gelegten Kunstdefinitionen ist die Wahl auf die Definition von Joseph Beuys und die des deutschen Urheberrechts gefallen - und das aus gutem Grund. Ließen sich unter rein kunsttheoretischem Aspekt durchaus noch weitere Definitionen in Betracht ziehen, so sind diese beiden doch in ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz einzigartig: Keine Kunstdefinition der Gegenwart hat eine ähnliche die Kunsttheorie dominierende Position einzunehmen vermocht, wie Beuys‘ sogenannter „erweiterter Kunstbegriff‘. Zugleich gewinnt der Kunstbegriff des Urheberrechts insofern eine von seinen Schöpfern seinerzeit nicht implizierte Bedeutung, als die Möglichkeiten von KI im künstlerischen Bereich zur Zeit der Abfassung dieses Gesetzes noch weit außerhalb jeglicher Vorstellungskraft gelegen sind. Es wird vermutlich einer Neufassung des Urheberrechts vorbehalten bleiben, dieser Entwicklung explizit in den gesetzlichen Formulierungen Rechnung zu tragen. Die Übertragung der Frage nach den Möglichkeiten von KI, Kunst zu schaffen, gewinnt vor diesem Hintergrund nicht nur an gesamtgesellschaftlicher Relevanz, sie vermag zugleich wichtige Denkanstöße zu vermitteln, wie dieses Problem künftig über seine philosophischen Grenzen hinaus zu denken sein wird.
Es liegt auf der Hand, dass im Rahmen der vorliegenden Untersuchung, diese Fragestellung nur grob angerissen werden kann, doch sind die nachfolgend entwickelten Gedanken auch und vor allem in ihrer Bezugnahme auf Kants Kunstkonzeption relevant und stehen somit durchaus in einem engen Zusammenhang zur Ausgangsfrage dieser Untersuchung. Erst diese Erweiterung der Fragestellung hebt die vorliegende Untersuchung über die philosophiehistorische Dimension hinaus und verknüpft sie mit einem zeitgenössischen philosophieästhetischen Kunstproblem.
Nach dieser methodischen Einordnung wird nunmehr mit dem Problem von KI geschaffener „Kunst“ hinsichtlich der Beuys’schen Kunstdefinition fortgefahren.
6.1 Beuys: Das Prinzip der Autorschaft im erweiterten Kunstbegriff und inwiefern KI diesem gerecht werden kann
Der Aktionskünstler Beuys ist zeitlebens darum bemüht gewesen, den von ihm als einengend empfundenen Kunstbegriff seiner Zeit zu erweitern, was schließlich in seine bekannte Formulierung mündet: „Alles ist Kunst, jeder ist ein Künstler“268.269 Dabei ist es Beuys stets ein Anliegen gewesen, diese Forderung auf ein breites soziales und durch Denken begründetes kunsttheorethisches Fundament zu stellen.
Bevor Beuys diese Definition publiziert hat, hat er wissenschaftliche Studien - insbesondere naturwissenschaftlicher und zoologischer Art - betrieben, die in ihm die Einsicht haben reifen lassen, dass ein „zu einseitiges Kunst- und Wissenschaftsverständnis“270 zu einer Einengung des Kunstbegriffs geführt hätte, der vor dem Hintergrund moderner Wissenschaftserkenntnissen dahingehend zu erweitern sei, dass ein diesen Erkenntnissen adäquater Kunstbegriff das umfassen sollte, was Beuys „anthropologische Kunst“271 genannt hat.272 Bei der Entwicklung dieses Kunstbegriffs hat im Übrigen die Anthroposophie Rudolf Steiners eine gewichtige Rolle gespielt, die zur Entwicklung Beuys‘ erweiterten Kunstbegriffs und seines Begriffs der „Sozialen Plastik“ geführt hat, beides Konzepte, die die Kunst als Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeit auf die gesellschaftlichen Realitäten auffassen.273 Diese Konzepte münden schließlich in eine Auffassung von Kunst, die Beuys wie folgt formuliert:
Ich finde es vom Standpunkt der Erkenntnistheorie wichtig, hier vom Kunstwerk zu sprechen, weil es sich um eine Formgestalt handelt. Wenn man zu dem Ergebnis gekommen ist, daß die Verständigung zwischen Menschen ganz allgemein nur durch das Kunstwerk des Denkens und der Sprache vollziehbar ist - vorausgesetzt wie jetzt immer, daß man auf diesen anthropologischen Punkt kommt, wo Denken bereits eine Kreation und ein Kunstwerk ist, also ein plastischer Vorgang und fähig ist, eine bestimmte Form zu erzeugen, und sei es nur eine Schallwelle, die das Ohr des anderen erreicht -, wenn ich das also jetzt niederschreibe, gibt es in der Welt eine Form, die ist zweifellos vom Menschen gemacht.274
In dieser Definition legt Beuys seine Vorstellung des erweiterten Kunstbegriffs vor und verweist auf die soziale Dimension, die Kunst seiner Meinung nach einnehmen soll. Allerdings koppelt Beuys das Vermögen des Menschen, Kunst zu schaffen an dasjenige, was er einen „plastischen Vorgang“275 nennt und was dem menschlichen Denken als Vermögen eine „bestimmte Form zu erzeugen“276 zugrunde liegt.277 Wird dieser Gedankengang Beuys‘ auf seine immanenten Voraussetzungen geprüft, stellt sich heraus, dass Beuys dabei auf das rekurriert, was Nida-Rümelin als Autorschaft einfordert.
Damit stellt sich das logische Konstrukt von Beuys Kunstbegriff wie folgt dar: Die Erschaffung von Kunstwerken bleibt - unabhängig davon, was darunter gezählt werden soll - an Autorschaft gebunden. In Analogie zu dem, was Kant als „Hervorbringung durch Freiheit“278 postuliert, bleibt auch bei Beuys die Freiheit notwendige Bedingung zur Schaffung von Kunstwerken.
Vor dem Hintergrund dieser Bedingung erweist sich, dass KI - weil zu Freiheit und Autorschaft nicht befähigt - auch im Sinne der Kunstdefinition Beuys‘ kein Kunstschaffen vermag. Vermutlich daher spricht Beuys in seinem erweiterten Kunstbegriff stets vom kunstschaffenden Menschen, weil Beuys jedem Menschen - aber eben nur dem Menschen - das prinzipielle Vermögen zuspricht, in freier Autorschaft Kunstwerke zu erschaffen. Dabei bleibt es angesichts der Allgemeinheit der Formulierung selbstverständlich auch für Beuys eine Binsenwahrheit, dass dieses allgemeine menschliche Vermögen an die Individualität und damit das Ausleben dieses Vermögens gebunden bleibt: Prinzipiell hat jeder Mensch das Vermögen ein Künstler zu sein, faktisch sind es allerdings nur wenige, die dieses Vermögen in die Tat umsetzen (können).
Zusammenfassend lässt sich damit festhalten, dass KI auch dann keine Kunst zu schaffen in der Lage ist, wenn unter „Kunst“ Kunst im Beuys'schen Sinne gemeint sein soll. Auch hier gilt, was bereits zum Problem der angenehmen Kunst im Sinne Kants angemerkt worden ist, dass KI durchaus die Fähigkeit zuzusprechen bleibt, „angenehme“, d. i. vom Rezipienten als „gefällig“ wahrgenommene scheinbare Kunst zu schaffen, dieses Schaffen jedoch ohne freie Autorenschaft erfolgt und somit nicht über die Imitation von Kunst hinauszureichen vermag.
Aus dem nämlichen Grund wäre KI - eine entsprechende Gesinnung jener, die sie verwenden vorausgesetzt - auch grundsätzlich dazu fähig, Kunstfälschungen zu schaffen: Bei einem entsprechenden Input ist KI in der Lage, einerseits bestehende Kunstwerke mit einem hohen Ähnlichkeitsgrad zu kopieren und andererseits Kunstwerke im Stile eines bestimmten Künstlers neu zu „schaffen“, sofern der KI entsprechende thematische Vorgaben durch einen Menschen eingegeben werden. Ohne diese menschliche Eingabe wäre KI aus sich heraus dazu jedoch nicht in der Lage, da ihr wie oben bereits ausgeführt, das Momentum der freien Autorenschaft, oder, wie Kant es nennen würde, der Freiheit, d. i. Willkür, fehlt.
Nachdem mit dem Beuys’schen Kunstbegriff quasi der für den Kunstbetrieb als solchen introspektive immanente Kunstbegriff abgehandelt worden ist, soll das Augenmerk nunmehr auf den juristischen Kunstbegriff gelenkt werden. Diese Hinwendung zum juristischen Aspekt der Kunst ist insofern angezeigt, als - was sich nicht zuletzt am Problem der Kunstfälschung festmachen lässt - Kunst in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext eingebettet bleibt, der über den rein kunstbetriebimmanenten Aspekt hinaus monetäre, judikable und sonstige gesellschaftliche Aspekte tangiert und demzufolge auf eine gesellschaftlich möglichst exakte Definition dessen ausgerichtet ist, was unter „Kunst“ zu verstehen sei.
6.2 Deutsches Urheberrecht: Das Prinzip der Autorschaft als implizite Prämisse im juristischen Kunstbegriff und inwiefern KI diesem gerecht werden kann
Nachdem das Verhältnis zwischen Kunst und KI anhand der Beuys’schen Kunstdefinition behandelt worden ist, soll in einem zweiten Schritt das Verhältnis zwischen Kunst und KI unter juristischem Aspekt ausgeleuchtet werden. Die Wahl dieses zweiten Aspekts gewinnt dadurch an gesellschaftlicher Relevanz, dass von KI geschaffene Kunst in vielen Bereichen - exemplarisch genannt seien hier vor allem die Musik und die bildende Kunst - bereits heute hergestellt und gehandelt wird und sich spätestens beim Preis für diese Kunstwerke die Frage nach Originalität und Autorschaft stellt - und beantwortet werden muss.
Die hohe Bedeutung, die die Gründungsväter der Bundesrepublik der Kunst respektive der Kunstfreiheit zugebilligt haben, findet ihren Niederschlag in ihrer gesetzlichen Fixierung in Art. 5, Abs. 3, Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG): „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.“279 Damit zählt die Kunstfreiheit zu den Grundrechten, die die Bundesrepublik jedem Bürger zugesteht. Neben dieser grundgesetzlichen Fixierung findet die Kunst im Urheberrechtgesetz ihre nähere Ausgestaltung. So lautet §2 Geschützte Werke, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG):
(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2. Werke der Musik;
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.280
Mit dieser Definition hat der Gesetzgeber nicht nur jenen Bereich abgesteckt, der unter dem Begriff „Kunst“ zu subsumieren sei, sondern auch zwei wichtige Aspekte zur Urheberschaft hervorgehoben: Jedes Kunstwerk bedarf eines persönlichen Schöpfers, wobei diese Schöpfung selbst geistiger Natur sein muss. Diese „geistige Natur“ wird juristisch als „Schöpfungshöhe“ definiert, die als Unterscheidungsmerkmal zwischen Kunstwerk und Handwerk dient. Diesen Unterschied haben bundesdeutsche Gerichte in Auslegung des Urheberrechts festgelegt. Was dabei dem Handwerk zuzuschlagen sei, definiert beispielsweise das Landgericht Berlin, indem es jene Leistung als „handwerkliche Leistung“ festsetzt, „die jedermann mit durchschnittlichen Fähigkeiten ebenso zustande brächte, mag sie auch auf anerkennenswertem Fleiß und auf solidem Können beruhen“281. Diese Festsetzung hebt auf „Fleiß“ und „solides Können“ ab und negiert somit die freie Autorschaft: Weil diese fehlt, kann ein handwerklich erzeugtes Werk kein Kunstwerk sein.
In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass auch Kant die Unterscheidung zwischen Handwerk und Kunstwerk behandelt und als Unterscheidungsmerkmal auf Hervorbringung durch Freiheit verweist.282 Wenn es deshalb nötig ist, Kunst vom Handwerk zu scheiden, so bleibt es KI unbenommen, im Bereich des Handwerks Werke zu schaffen: Mangels des Vermögens zur eigenen Freiheit, kann KI zwar keine Kunst hervorbringen, wird aber in zunehmenden Maße zur Herstellung handwerklicher Erzeugnisse herangezogen.
Gegenüber der Abgrenzung des Landgerichts Berlin zwischen Handwerk und Kunstwerk hat der Bundesgerichtshof 2013 die Schöpfungshöhe bei Kunstwerken wie folgt festgeschrieben: „Die erforderliche Schöpfungshöhe ist bei Werken erreicht, die es nach Auffassung der für Kunst empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen vertrauten Kreise rechtfertigen, von einer künstlerischen Leistung zu sprechen.“ (§ 2 Abs. 2., UrhG). Entsprechend dieser Vorgabe des Bundesgerichtshofs wäre die für die Einstufung eines Werkes als Kunstwerk erforderliche Schöpfungshöhe dann gegeben, wenn fachkundige Rezipienten dem Werk diese erforderliche Schöpfungshöhe zusprechen.
Obwohl diese Definition im juristischen Alltag zur Rechtsprechung taugen mag, ist sie - philosophisch betrachtet - methodisch durchaus fragwürdig, da sie lediglich auf Empirie basiert und allgemein gültige objektive Kriterien vermissen lässt. Allerdings bleibt dieser Mangel zur Bearbeitung der Problemstellung dieser Untersuchung insofern ohne Relevanz, als es auf eine exakte Festlegung dessen, was unter „Schöpfungshöhe“ zu verstehen sei, gar nicht ankommt. Relevant bleibt für diese Untersuchung die Frage nach dem Schöpfer, der in dem Kunstwerk die Schöpfungshöhe erreicht - oder auch nicht, da in der vorliegenden Untersuchung wie bereits mehrfach angeführt, das Augenmerk auf den Schöpfungsprozess respektive den Schöpfer und nicht das Geschaffene gerichtet bleibt.
Wie bereits bei der Beuys’schen Kunstdefinition, so tritt auch hier die freie Autorenschaft als notwendige Bedingung in den Vordergrund: Unabhängig davon, wie das Kunstwerk letztlich ausgestaltet sein mag, wird es auch unter juristischem Aspekt nur dann zum Kunstwerk, wenn es der freien Autorschaft seines Schöpfers zugerechnet werden kann.
Von besonderer Relevanz ist unter juristischem Aspekt das Problem der Kunstfälschung - wird diese doch gesetzlich geahndet. Als Kunstfälschung betrachtet der Gesetzgeber sowohl die Imitation von Künstlern geschaffener Werke als auch die Schaffung neuer Werke, die sich in nachahmender Weise Stil und Form eines Künstlers bedient und dadurch eine Autorschaft vorzugeben bestrebt ist, die dem Werk nicht zusteht.
Hinsichtlich der Ausdeutung des juristischen Kunstbegriffs bezüglich der KI erweist sich die freie Autorschaft erneut als letztlich relevantes Unterscheidungsmerkmal: Fehlt diese freie Autorschaft, §2 Abs. 2, UrhG, spricht von „persönliche[n] geistige[n] Schöpfungen“, fehlt die entscheidende Voraussetzung von Kunst, da jedes Kunstwerk eines individuellen Schöpfers qua Autor bedarf. Da es der KI an dieser individuellen Schöpfungskraft mangelt, ist KI auch unter aktuell geltenden juristischen Aspekten nicht in der Lage, aus sich heraus Kunstwerke zu schaffen. Allerdings ist KI in der Lage, Handwerk und als solche gekennzeichnete Kopien von Kunstwerken herzustellen sowie - was gesetzlich verboten - Kunstfälschungen zu produzieren.
Wie in Abschnitt 5.1 bereits aufgezeigt, werden von KI geschaffene Werke bereits auf dem Kunstmarkt gehandelt - und das völlig legal. Legal deshalb, weil sie keine Fälschungen sind, da sie weder vorhandene Kunstwerke imitieren noch vorgeben, Werke eines anderen Schöpfers zu sein. Allerdings ergibt sich aus den obigen Ausführungen, dass diese Werke weder im Sinne Kants noch nach Beuys’scher oder juristischer Definition als Kunstwerke anzusehen sind. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der Gesetzgeber den Fähigkeiten von KI insofern Rechnung trägt, als er den bestehenden Kunstbegriff erweitert und die Bedingung persönlicher Autorschaft zu Gunsten von KI aufhebt. Es wäre also möglich, dass durch eine entsprechende Änderung des Urhebergesetzes künftig auch von KI geschaffene Werke juristisch den Status von „Kunst“ erhalten könnten.
Um die von dieser Problematik betroffenen Fragestellungen zu veranschaulichen, sei hier auf ein Phänomen des zeitgenössischen Kunstbegriffs eingegangen, an dem sich das Kriterium der Autorschaft exemplarisch darstellen lässt und das den Beuys’schen Kunstbegriff und das Urheberrecht in sich vereint.
Außerhalb von Fälschung und Imitation bewegen sich Kunstobjekte, die in der zeitgenössischen Kunst seit der Moderne zunehmend an Bedeutung gewinnen: Das Objet trouvé respektive das Readymade. Die diesem künstlerischen Konzept zugrundeliegende Kunstform entstammt dem Dadaismus und basiert darauf, Alltags- oder Naturgegenstände zu Kunstwerken umzuwidmen, indem sie in einen neuen Sinnzusammenhang gestellt werden und dadurch eine neue künstlerische Aussage erlangen:283 Erst diese künstlerische Autorschaft erhebt den banalen Alltagsgegenstand auf die Ebene eines Kunstwerks.
Grundsätzlich tangiert das Objet trouvé auf den ersten Blick die Fragestellung dieser Untersuchung insofern nur wenig, als diese Kunstgegenstände bereits „fertig“ vorgefunden werden und ihre Verfertigung insofern künstlerischem Zutun enthoben bleibt. Dadurch wäre es insofern denkbar, dass KI Objets trouvés herstellt, als KI grundsätzlich dazu in der Lage ist, Gegenstände zu produzieren. Jedoch steht auch dem der Einwand entgegen, dass KI prinzipiell nicht zur Autorschaft fähig und damit nicht in der Lage ist, jenen künstlerischen Impuls zu generieren, der einen Gegenstand der Sphäre des alltäglichen Gebrauchs zu entheben und ihn in den Bereich der Kunst zu transzendieren vermag.
Um diese Aussage anhand eines Beispiels nochmals plastisch hervorzuheben: Selbstverständlich ist es KI möglich, Badewannen herzustellen, selbstverständlich vermag KI Badewannen mit Fett zu beschmieren. Jedoch ebenso selbstverständlich ist es, dass KI aus eigenem schöpferischem Impetus heraus und in autonomer Freiheit prinzipiell nicht in der Lage ist, für eine fettbeschmierte Badewanne den Anspruch eines Kunstwerks zu erheben. Diesen Anspruch hingegen kann ein Künstler wie Beuys aus sich heraus erheben und diese fettbeschmierte Badewanne unter den Titel „unbetitelt (Badewanne)“ zum Kunstwerk deklarieren, weil er diese Badewanne qua Autorschaft in einen höheren - also einen künstlerischen - Sinnzusammenhang zu bringen vermag. Aufgrund dieser Autorschaft kann diese Badewanne sowohl entsprechend der Beuys’schen Kunstdefinition als auch des deutschen Urheberrechts den Anspruch erheben, Kunstwerk zu sein. Im Übrigen würde sie durch diese Autorschaft und die damit verbundene Freiheit respektive Genialität des Künstlers auch dem Anspruch Kants an schöne Kunst genügen.
Damit wäre ein weiterer Beleg für die oben aufgestellte These gegeben, die im Rekurs auf Kant fordert, dass jegliche Kunst letztlich in ihrer Entstehung auf das Prinzip der „Willkür“, also der Freiheit und somit der Autorschaft rückführbar bleiben muss: Ob die „schöne Kunst“ im kantischen Sinne, ob die „anthropologische Kunst“ nach dem „erweiterten Kunstbegriff“ Beuys‘ oder Kunst im Sinne des deutschen Urheberrechts - es bleibt letztlich nur der zur Freiheit fähige Mensch, der als Schöpfer von Kunst in Erscheinung treten kann. Dass KI dazu prinzipiell nicht in der Lage ist, liegt daran, dass sie über keine Genialität im kantischen Sinne verfügt und dass sie weder für Kunst Beuys’scher Definition noch Kunst im gesetzlichen Sinne Autorschaft einzunehmen vermag: Weil KI prinzipiell unfähig zu Freiheit und Autorschaft, bleibt KI prinzipiell unfähig, aus sich heraus Kunst zu schaffen.
Diese prinzipielle Unfähigkeit hat weitreichende grundsätzliche Auswirkungen auf dem Felde der Ästhetik: Weil KI prinzipiell kunstunfähig, bleibt das Aufkommen von KI für die Forschungsfragen im Bereich der Ästhetik insofern nebensächlich, als KI nicht als Schöpfer von Kunst aufzutreten vermag.
Conclusio
In Beantwortung der Forschungsfrage, warum KI keine schöne Kunst im kantischen Sinne hervorbringen kann, bleibt festzuhalten, dass diese Frage dadurch beantwortet worden ist, dass aufgezeigt wird, dass Kant das Zustandekommen schöner Kunst unabdingbar an menschliche Freiheit und das Wirken eines menschlichen Genies knüpft und KI damit prinzipiell nicht zur Schaffung von schöner Kunst im Sinne Kants in der Lage ist.
Obwohl KI aufgrund der technischen Fortschritte zwischenzeitlich in der Lage ist, Kunstwerke zu imitieren, die bei einigen Betrachtern in deren ästhetischem Geschmacksurteil einen im kantischen Sinne angenehmen Eindruck hervorzubringen vermögen, den jene fälschlich als schön bezeichnen könnten, ist KI trotzdem prinzipiell nicht in der Lage, Kunst allgemein oder schöne Kunst im Besonderen im Sinne Kants zu schaffen.
Methodisch betrachtet, resultiert dieses Nicht-Vermögen einerseits aus einem Perspektivwechsel und andererseits aus notwendigen sowie hinreichenden Gründen. Dieser Perspektivwechsel besteht darin, dass Kant zur Grundlegung seiner Anforderungen an Kunst allgemein sowie schöne Kunst eben nicht von der Perspektive des Kunst Betrachtenden, sondern von der Perspektive des Kunst Schaffenden ausgeht. Diesen Perspektivwechsel gibt Kant allerdings dann auf, wenn er auf das ästhetische Geschmacksurteil abhebt, das den Betrachtenden befähigt, das dem Kunstwerk innewohnende Schöne als solches wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung geht nach Kant allerdings insofern letztlich auf das Kunstwerk zurück, als es das Kunstwerk ist, das durch seine immanente Schönheit die Befähigung zum ästhetischen Geschmacksurteil in seinem Betrachter zu affizieren vermag.
Es ist demzufolge wichtig, Kants Definition des Schönen im Auge zu behalten, der „schön“ wie folgt definiert: „Geschmack ist das Beurteilungsvermögen eines Gegenstandes oder einer Vorstellungsart durch ein Wohlgefallen, oder Mißfallen, ohne alles Interesse. Der Gegenstand eines solchen Wohlgefallens heißt schön.“284 Daher hat es sich für die gesamte Untersuchung als von fundamentaler Bedeutung erwiesen, diesen kantischen Begriff des „Schönen“ streng gegenüber jener Begriffsverwendung abzugrenzen, die außerhalb des kantischen Begriffskontextes und vor allem in der zeitgenössischen Alltagssprache Einzug gehalten hat.
Dabei stellt sich heraus, dass Kant zwar in der abendländischen Tradition verhaftet bleibt, die die Ursprünge der Kunst in der antiken rs/yn ansetzt, aber eine im historischen Verlauf wichtige Erweiterung dieses Ansatzes um das Element der èmor^^n durchläuft, um schließlich in der Aufklärung der Neuzeit die Frage der Ästhetik in die Frage nach der Kunst und dem Schönen einzubringen. Es steht fest, dass Kant diese Entwicklung gekannt hat - hier sei insbesondere auf Baumgarten verwiesen, in Abgrenzung zu dessen theoretischem Ansatz Kant den eigenen zu schärfen vermocht hat - und auf ihr aufbauend sein Konzept des Ästhetischen entwickelt hat.
Zentrale Begriffe dieses Konzepts sind einerseits Kants Begriff von Kunst und andererseits seine Vorstellung bezüglich des ästhetischen Geschmacksurteils - beides Begriffe, die zugleich von eminenter Wichtigkeit für die Beantwortung der Ausgangsfrage der Untersuchung sind.
Blickt man auf das, was Kant unter einem „ästhetischen Geschmacksurteil“285 versteht, so zeigt sich, dass er damit eine von den Sinnen affizierte Gesetzmäßigkeit ohne Gesetz meint, in der „eine subjektive Übereinstimmung der Einbildungskraft zum Verstande, ohne eine objektive [Übereinstimmung]“286 gegeben ist. Für Kant bedeutsam ist der Hinweis, dass das ästhetische Geschmacksurteil einer logischen Bindung durch vernünftige Gesetzmäßigkeit gerade nicht bedarf - das ästhetische Geschmacksurteil ist kein logisches Erkenntnisurteil, sondern sinnt subjektive Allgemeingültigkeit an.
Ausgehend von dieser theoretischen Grundlegung, stellt sich für Kant der Kunstbegriff insofern als von komplexer Natur dar, als er von dem Begriff der „Kunst allgemein“ auf die Unterscheidung zwischen mechanischer und ästhetischer Kunst und im Bereich der ästhetischen Kunst wiederum auf die Unterscheidung zwischen angenehmer und schöner Kunst verweist.
Für Kant ist Kunst allgemein Hervorbringung durch Freiheit und demzufolge der Kunstschaffende in seiner im Kunstwerk sich manifestierenden Autorschaft stets ein aus innerer Willkür handelnder Akteur. Daher kann die Freiheit insofern als notwendige Bedingung der Kunst aufgefasst werden, als sie vom Inhalt und der Ausgestaltung des je einzelnen Kunstwerkes absieht.
Über die Freiheit als notwendige Bedingung zur Kunst allgemein und damit auch zur schönen Kunst, lässt sich Genialität als hinreichende Bedingung zur schönen Kunst auffassen, weil sie auf die Genialität des Kunstschaffenden rekurriert, die sich im je einzelnen Kunstwerk in einzigartiger Weise singulär manifestiert, weil jedes Kunstwerk in seiner Genialität an Subjektivität gekoppelt sui generis erschaffen wird.
Wie bereits obig ausgeführt, ist für Kant die Genialität das für die Zusprechung der Eigenschaft „schöne Kunst“ hinreichendes Erfordernis, die er anhand von vier Charakteristika näher ausleuchtet. Nur wenn die Charakteristika Originalität, Exemplarität, Unerklärbarkeit und Naturbezug vorliegen, kann Genialität vorliegen und damit schöne Kunst.
KI wäre demnach nur dann fähig, schöne Kunst zu schaffen, wenn sie diese vier Charakteristika und damit Genialität in den Schöpfungsprozess einzubringen in der Lage wäre. Wie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert, ist KI in ihren beiden Ausführungen - der heute bereits existierenden Weak AI und der bislang lediglich theoretisch postulierten Strong AI - prinzipiell dazu nicht in der Lage, da KI in jeder Form Genialität abzusprechen ist und sie lediglich zu Verhalten und nicht zu Handeln aus Gründen und somit auch nicht zu Autorschaft fähig ist.
Diese Unmöglichkeit resultiert daraus, dass jeder mögliche KI-Output einem vorangegangenen KI-Input als Wirkung folgt: KI kann ihrer Möglichkeit nach die Begrenztheit ihrer Programmierung nicht durch eigene Genialität respektive Autorschaft überwinden, sie ist prinzipiell nicht in der Lage, aus dem sie bedingenden Ursache-WirkungPrinzip, auszubrechen und selbst Ursachen und damit Wirkungen aus Willkür respektive Freiheit und Genialität respektive Autorschaft zu generieren.
Damit kann die Fragestellung dieser Untersuchung insofern als beantwortet erachtet werden, als KI prinzipiell nicht fähig ist, schöne Kunst im kantischen Sinne hervorzubringen.
Durch die Ausweitung der Fragestellung auf den erweiterten Kunstbegriff von Beuys und das deutsche Urheberrecht hat diese Untersuchung über die kantische und insofern philosophiehistorische Dimension eine gesamtgesellschaftliche Relevanz angestrebt, indem sie die zu Kant gewonnenen Einsichten in die Gegenwart transzendiert. Sowohl unter Bezugnahme auf Beuys‘ erweiterten Kunstbegriff als auch auf das deutsche Urheberrecht hat sich das Momentum menschlicher Freiheit und somit der Autorschaft als entscheidendes Kriterium dazu erwiesen, KI die prinzipielle Möglichkeit absprechen zu können, Kunst zu schaffen.
Ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz bezieht diese Untersuchung einerseits aus der zunehmenden gesellschaftlichen Implementierung von KI, die quasi exponentiell mit der Zunahme ihrer Möglichkeiten wächst und andererseits aus der bislang relativ geringen Beachtung, die das Verhältnis von KI und Kunst im wissenschaftlichen - und hier speziell im philosophischen - Forschungsbereich unter dem Aspekt der philosophischen Ästhetik gefunden hat. Spätestens seit die ersten „Kunstwerke“, die KI „geschaffen“ hat, auf Auktionen für viel Geld gehandelt worden sind, ist die Frage nach künstlerischer Zuschreibung von KI geschaffener Werke in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Auch wenn es dem Kunstbetrieb unbenommen bleibt, für wie-auch-immer geschaffene Werke Käufer zu finden, sollte diese Untersuchung aus philosophieästhetischer Sicht gute Gründe dafür liefern, von KI geschaffene Kunstwerke nicht menschgeschaffener Kunst gleichzustellen.
Obwohl diese Untersuchung in ihrem prinzipiellen Argumentationsgang Freiheit und Autorschaft als unabdingbare Voraussetzungen von Kunst logisch begründet hat, hätte es ihren Rahmen doch bei weitem überschritten, die Kunstbegriffe anderer Zeiten und regionalen Gebieten einer exakten Prüfung zu unterziehen - eine Prüfung, die sicherlich spannende und relevante Aspekte zur Forschungsfrage hätte beisteuern können. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Forschungsfeld in näherer Zukunft mehr Beachtung erfahren wird.
Literaturverzeichnis
Baumann, Peter: Die Autonomie der Person, Paderborn: Mentis 2000.
Benney, Marnie und Kistler, Pete: „Timeline of AI Art“ zusammengestellt in Kooperation mit BBC, MIT und Forbes, AI Artists, online verfügbar unter: https://aiartists.org/ai- timeline-art (Stand: 04.08.2020).
Beuys, Eva, Beuys, Wenzel und Beuys, Jessyka: Joseph Beuys. Block Beuys, München: Schirmer / Mosel 1990.
Bihalji-Merin, Oto: Die Kunst der Naiven. Themen und Beziehungen (Katalog der gleichnamigen Ausstellung, Haus der Kunst, 1. November 1974 bis 12. Januar 1975) München 1975.
Bloomberg, Jason: Timeline Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril”, Forbes Magazin, online verfügbar unter: https://www.forbes.com/sites/iasonbloomberg/2018/04/29/digitization- digitalization-and-digital-transformation-confuse-them-at-vour-peril/#421e9d062f2c (Stand: 03.09.2020). von Brentano, Franz: Psychologie vom empirischen Standpunkt, Band 1, Hamburg: Meiner 1955.
Bunge, Matthias: „Vom Ready-made zur „Fettecke“. Beuys und Duchamp - ein produktiver Konflikt“, Joseph Beuys. Verbindungen im 20. Jahrhundert, hg. v. Hessisches Landesmuseum Darmstadt.
Butin, Hubertus: DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Amsterdam: Snoeck 2014.
Buxmann Peter und Schmidt, Holger: Künstliche Intelligenz. Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer 2019.
Cohn, Gabe: „AI Art at Christie’s Sells for $432,500”, The New York Times, 25.10.2018, online verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2018/10/25/arts/design/ai-art- sold-christies.html (Stand: 26.08.2020).
Danto, Arthur: „Die Kunstwelt“, Deutsche Zeitschrift für Philosophie 42 Jg. (1994).
Eberl, Ulrich: 33 Fragen - 33 Antworten: Künstliche Intelligenz, München: Piper 2020.
Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1899, online verfügbar unter: https://opacplus.bsb- muenchen.de/Vta2/bsb11172133/bsb:BV020489388?page=7 (Stand 04.08.2020).
Encyclopedia Britannica, online verfügbar unter: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence (Stand: 31.05.2020).
Ermen, Reinhard: Joseph Beuys, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 22010.
Ertel, Wolfgang: Grundkurs Künstliche Intelligenz. Eine praxisorientiere Einführung, Wiesbaden: Springer 420 1 6.
Fischer, Knut und Smerling, Walter: „Joseph Beuys im Gespräch mit Knut Fischer und Walter Smerling“, Schriftenreihe Kunst heute, Heft 1, Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch 1989, S. 47.
Gartner Glossary, online verfügbar unter: https://www.gartner.com/en/information- technology/glossary/digitization (Stand: 03.09.2020).
Gerabek, Werner E., Haage, Bernhard D., Keil, Gundolf und Wegner, Wolfgang: Enzyklopädie Medizingeschichte, Berlin / New York: De Gruyter 2005.
Goertzel, Ben und Pennachin, Cassio: Artificial General Intelligence, Berlin: Springer 2007.
Goodfellow, Ian J., Pouget-Abadie, Jean und Mirza, Mehdi: „Generative Adversarial Nets“, im Rahmen der Neural Information Processing Systems Conference veröffentlicht, online verfügbar unter: https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets (Stand: 04.08.2020).
Harlan, Volker: Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys, Stuttgart: Urachhaus 62001.
Höffe, Otfried: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 1983.
- Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 22018.
Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft (KU) 1790.
- Kritik der reinen Vernunft (KrV) 1781.
Kix, Martina: „Der Glaube an Kunst ist wie in die Kirche gehen“, Zeit Campus, online verfügbar unter: https://www.zeit.de/campus/2017/02/wolfgang-beltracchi- kunstfaelscher-haft-betrug-kunstmarkt (Stand: 22.09.2020).
Kirchner, Friedrich und Michaëlis, Carl: Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe, Leipzig 51907, S. 108-109, online verfügbar unter: http://www.zeno.org/Kirchner- Michaelis-1907/A/Buridans+Esel (Stand: 22.09.2020).
Kulenkampff, Jens: „Immanuel Kant“, in: Julian Nida-Rümelin, Monika Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart: Kröner 1998.
Kuypers, Karel: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972.
Lovelace, Ada Augusta: „Notes on L. F. Menabrea’s ,Sketch of the Analytical Engine
Invented by Charles Babbage’”, Scientific Memoirs 1843, online verfügbar unter: https://todayinsci.com/K/King Augusta/KingAugusta-Quotations.htm (Stand: 11.09.2020).
Lenzen, Manuela: Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet, München: C. H. Beck 2018.
Löbl, Rudolf: Texnh: Untersuchung zur Bedeutung dieses Wortes in der Zeit von Homer bis Aristoteles. Von Homer bis zu den Sophisten, Band 1, Würzburg: Königshausen & Neumann 1997.
Luhmann, Niklas: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt a. M: Suhrkamp 1995.
McCarthy, John, Minsky, Marvin, Rochester, Nathaniel und Shannon, Claude: A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31. August 1955, online verfügbar: http://www- formal.stanford.edu/j mc/history/dartmouth/dartmouth.html.
Nida-Rümelin, Julian und Betzler, Monika: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, Stuttgart: Kröner 1998.
- und Steinbrenner, Jakob: Kunst und Philosophie, Original und Fälschung, Ostfildern: Hatje Cantz 2011.
- Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016.
- und Weidenfeld, Nathalie: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018.
- im Interview (geführt von Bickelmann, Jonas): „Julian Nida-Rümelin: Die ultimative Grenze Künstlicher Intelligenz“, Capital, online verfügbar unter: https://www.capital.de/wirtschaft-politik/iulian-nida-ruemelin-die-ultimative- grenze-kuenstlicher-intelligenz (Stand: 22.09.2020).
- Eine Theorie praktischer Vernunft, Berlin / Boston: De Gruyter 2020.
Ofenbeck, Andreas: Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) Nr. 119 (15.05.2020), online verfügbar unter: https://www.stmwk.bayern.de/pressemitteilung/11941/ki-wettbewerb-50-neue- professuren-mit-fokus-auf-kuenstlicher-intelligenz-fuer-hochschulen-in-ganz- bayern.html (Stand 04.08.2020).
Pietsch, Wolfgang, Wernecke, Jörg und Ott, Maximilian: Berechenbarkeit der Welt? Philosophie und Wissenschaft im Zeitalter von Big Data, Wiesbaden: Springer 2017.
Rich, Elaine: „Computers and the Humanities”, Natural Language Processing 19 / 2 (1985) S. 117-122.
Ritter, Joachim und Gründer, Karlfried: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 4 - I-K, Basel / Stuttgart 1976.
Rehfus, Wulff D.: „Kopernikanische Wende“, Handwörterbuch Philosophie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht / UTB 2003.
Römpp, Georg: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020.
Schumacher, Holger: „Jan Vermeer - Magie des Lichts und der Perspektive“,
Kunstmuseum, online verfügbar unter: https://kunstmuseum.com/jan-vermeer/ (Stand: 11.09.2020).
Searle, John: „Minds, Brains, and Programs“, The Behavioral and Brain Sciences, 1980 (3) S. 417-457.
Dpa, unbekannter Autor: „Gemälde eines Schimpansen erzielt 14.000 Pfund“, Der Spiegel, online verfügbar unter: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kunst- auktion-gemaelde-eines-schimpansen-erzielt- 14-000-pfund-a-361378.html (Stand: 11.09.2020).
Sturma, Dieter: Vernunft und Freiheit. Zur praktischen Philosophie von Julian Nida- Rümelin, Berlin / Boston: De Gruyter 2012.
Weber, Matthias: „Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst“, Dokumentations- und Forschungsprojekt des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, online verfügbar unter: https://www.bkge.de/Projekte/Kant/matthias-
weber/Matthias Weber Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst.php (Stand 04.08.2020).
Willaschek, Marcus, Stolzenberg, Jürgen, Mohr, Georg und Bacin, Stefano: Kant-Lexikon. Studienausgabe, Berlin / Boston: De Gruyter 2017.
Zalta, Edward: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), online verfügbar unter: https://plato.stanford.edu/, Stand 04.08.2020).
[...]
1 Das „Künstlich“ in „Künstlicher Intelligenz“ ist nicht ohne Grund mit einem großen „K“ geschrieben. Wie in Fußnote 2 kurz angerissen und in Abschnitt 4.2 dieser Untersuchung umfassend dargestellt, soll mit dieser Schreibweise auf den festgelegten terminus technicus „Künstliche Intelligenz“ verwiesen werden. Schon an dieser Stelle sei jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass es, nicht nur in der Philosophie, kritische Stimmen und gute Argumente für die Behauptung gibt, dass es sich bei Künstlicher Intelligenz um keine künstliche Intelligenz handelt. Deswegen wird Künstliche Intelligenz als feststehender Begriff und in Referenz darauf, wie er verwendet wird, in der vorliegenden Untersuchung mit großem „K“ geschrieben.
2 Eine exakte Definition dessen, was in dieser Untersuchung unter „KI“ zusammengefasst wird, erfolgt in Abschnitt 4.2. Allerdings sei bereits hier darauf hingewiesen, dass unter „KI“ keine technischen Werkzeuge oder Medien gemeint sind, sondern darunter deren auf Implikationen - mathematisch ausgedrückt: Algorithmen - basierenden theoretischen Grundlagen verstanden werden sollen.
3 Die Begriffe Digitalisierung und Digitale Transformation werden im Deutschen oftmals begrifflich unscharf synonym verwendet. Jedoch im angelsächsischen Sprachraum wird, besonders in wirtschaftswissenschaftlichen und Unternehmenskontexten zunehmend zwischen Digital Transformation, Digitization und Digitalization unterschieden. Unter „Digitization“ versteht man dabei in der Regel das Digitalisieren analoger Informationen durch das binäre Kodieren in Nullen und Einsen, sodass Computer diese Informationen speichern, verarbeiten und übertragen können. Ein Beispiel dafür wäre die Umwandlung eines Textes in eine Folge binärer Zeichen. Bei Digitization werden also Informationen digitalisiert, nicht Prozesse. „Digitization“ lässt sich mit dem Gartner Glossary somit wie folgt definieren: „Digitization is the process of changing from analog to digital form, also known as digital enablement. Said another way, digitization takes an analog process and changes it to a digital form without any different-in-kind changes to the process itself.” (Stichwort: „Digitization”, Gartner Glossary, online verfügbar unter: https://www.gartner.com/en/information-technology/glossarv/digitization (Stand: 03.09.2020), vgl. dazu: Jason Bloomberg: „Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril”, Forbes Magazin, online verfügbar unter: https://www.forbes.com/sites/iasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital- transformation-confuse-them-at-your-peril/#421e9d062f2c (Stand: 03.09.2020). Die Definition des Begriffs „Digitalization” geht dabei weiter, wird er wie folgt nach dem Gartner Glossary festgelegt: „Digitalization is the use of digital technologies to change a business model and provide new revenue and value-producing opportunities; it is the process of moving to a digital business.” (Stichwort: „Digitalization”, Gartner Glossary, online verfügbar unter: https://www.gartner.com/en/information- technology/glossary/digitalization (Stand: 03.09.2020)). Digitalization umfasst also nicht nur Informationen, die digitalisiert werden, sondern auch den Geschäftsbetrieb sowie soziale Interaktionen und Geschäftsmodelle, vgl. dazu: Jason Bloomberg: „Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril”, Forbes Magazin, online verfügbar unter: https://www.forbes.com/sites/iasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital- transformation-confuse-them-at-your-peril/#421e9d062f2c (Stand: 03.09.2020). Im Gegensatz dazu lässt sich Digital Transformation insofern von Digitalization abgrenzen, als sie nichts ist, das Unternehmen als Projekte umsetzen können. Digital Transformation umfasst also übergreifende organisatorische Veränderungen, die jedoch auch die Implementierung digitaler Technologien erfordert. Zusammenfassend lassen sich Digitization, Digitalization und Digital Transformation folgendermaßen voneinander abgrenzen: “[W]e digitize information, we digitalize processes and roles that make up the operations of a business, and we digitally transform the business and its strategy. Each one is necessary but not sufficient for the next. “ (Jason Bloomberg: „Digitization, Digitalization, And Digital Transformation: Confuse Them At Your Peril”, Forbes Magazin, online verfügbar unter: https://www.forbes.com/sites/iasonbloomberg/2018/04/29/digitization-digitalization-and-digital- transformation-confuse-them-at-your-peril/#421e9d062f2c (Stand: 03.09.2020). Mit Digital Transformation wird der gesamte Veränderungsprozess eines Unternehmens bzw. einer Kultur gemeint, während die Digitalization einzelne (meist abgeschlossene) Prozesse und Projekte umfasst. Digitization hingegen ist das Digitalisieren analoger Inhalte.
4 Die Autorin dieser Untersuchung hat sich bewusst dazu entschieden, bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern die männliche Form, das generische Maskulinum, zu verwenden und dies aus folgenden zwei Gründen: Erstens wird in einem wissenschaftlichen Text, der sich mit Kants Werk befasst, mannigfach Kant als Primärquelle zitiert, in dessen Texten zeitgenössische Gendergepflogenheiten nicht eingeflossen sind. Es wäre daher verwirrend, innerhalb der Abschnitte dieser Untersuchung zwischen gendergerechter und nicht gegenderter Sprache zu wechseln - die Lesbarkeit der Untersuchung wäre stellenweise merklich beeinträchtigt. Darüber hinaus stehen zweitens gerade in der Philosophie zahlreiche Begriffe als termini technici seit Jahrhunderten auch grammatikalisch fixiert fest. Deren Deklination respektive Konjugation wäre eine dem Leser nicht zumutbare Abweichung von dieser philosophiehistorischen Praxis, weshalb die Autorin von diesem Ansinnen Abstand genommen hat. Die Autorin hofft auf das Verständnis des geneigten Lesers, der geneigten Leserin und des geneigten Diversen und möchte deutlich herausstellen, dass mit dieser sprachlichen Regelung mitnichten eine wie auch immer geartete Diskriminierung intendiert sein soll: Grundsätzlich und womöglich seien im verwendeten generischen Maskulinum selbstverständlich alle Geschlechter in gleicher Weise sprachlich bedacht.
5 Vgl. dazu Pressesprecher Andreas Ofenbeck in der Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) Nr. 119 vom 15.05.2020, online verfügbar unter: https://www.stmwk.bavern.de/pressemitteilung/11941/ki-wettbewerb-50-neue-professuren-mit-fokus-auf- kuenstlicher-intelligenz-fuer-hochschulen-in-ganz-bayern.html (Stand 04.08.2020).
6 Vgl. dazu folgende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Gesamtforschungsfeld der KI und Kreativität bzw. Kunst befassen, die Forschungsfrage dieser Arbeit jedoch unbeleuchtet lassen und deswegen im Zuge dieser Untersuchung keine nähere Berücksichtigung finden können, obwohl sie interessante Aspekte des Problems bearbeiten und deswegen hier angeführt sein sollen: Marian Mazzone und Ahmed Elgammal: „Art, Creativity, and the Potential of Artificial Intelligence“, Arts 8 (1) 2019; Joo-Wha Hong und Nathaniel Curran: „Artificial Intelligence, Artists, and Art: Attitudes Toward Artwork Produced By Humans vs. Artificial Intelligence“, ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications 2019; Wolfgang Bibel: „Künstliche Kreativität“, MinD Akademie 2007.
7 Termini technici in Englisch, Latein, Französisch und Altgriechisch werden in dieser Untersuchung in originaler Schreibweise kursiv gesetzt verwendet, soweit sie nicht in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und damit den Schreibregeln der deutschen Rechtschreibung nach Duden angepasst worden sind. Diese Kenntlichmachung erfolgt deshalb, um auf die mit dem jeweiligen Begriff verbundenen wissenschaftlichen Konnotationen hinzuweisen.
8 Titel genannter Werke werden durch Kursivsetzung als solche kenntlich gemacht. Kants Werke werden folgend in der für Kant üblichen Zitationsweise unter Angabe der Paginierung der Originalausgaben angegeben und weichen insofern von dem Zitationsstil der anderen Werke ab. Dies trägt zur exakten Nachvollziehbarkeit der direkten und indirekten Zitate bei, auch wenn das Primat der Einheitlichkeit sich dem unterordnen muss.
9 Angemerkt sei an dieser Stelle, dass Kant die Wörter „künstlich“ und „künstlerisch“ dem Sprachgebrauch seiner Zeit gemäß synonym verwendet und nicht die zeitgenössische Unterscheidung kennt. Damit der Sinngehalt des Originaltextes Kants nicht verfälscht wird, wird in dieser Untersuchung bei indirekten oder direkten Zitaten Kants die Verwendung gemäß dem Original entnommen. Wenn jedoch über Kant hinaus über etwas „Künstlerisches“ oder „Künstliches“ gesprochen wird, sollen die beiden Begriffe ihrer zeitgenössischen gängigen Definition gemäß Verwendung finden. Dies ist dringend angezeigt, da genau diese Unterscheidung zwischen Künstlicher und Künstlerischer Intelligenz herausgearbeitet werden soll.
10 Reinhard Ermen: Joseph Beuys, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 22010, S. 71.
11 Knut Fischer und Walter Smerling: „Joseph Beuys im Gespräch mit Knut Fischer und Walter Smerling“, Schriftenreihe Kunst heute, Heft 1, Köln: Kiepenheuer & Witsch 1989, S. 47.
12 Kant unterscheidet die praktische Freiheit von der psychologischen Freiheit und der transzendentalen Freiheit. Die praktische Freiheit bezeichnet das Selbstverständnis eines vernünftigen Wesens, nach selbstenthobenen Prinzipien Entscheidungen zu treffen und sich sodurch als frei anzusehen (vgl. dazu Immanuel Kant: KrV, B 830). Für die vorliegende Untersuchung ist lediglich die Freiheit in praktischer Sicht relevant, die transzendentale und die psychologische seien deswegen für den Fortlauf dieser Untersuchung unberücksichtigt, was in Abschnitt 5.2 ausführlicher erläutert wird.
13 Vgl. Rudolf Eisler: Stichwort: „Gegensatz“, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1899, online verfügbar unter: https://www.textlog.de/4138.html (Stand 04.08.2020).
14 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 98.
15 Vgl. ebd.
16 Vgl. Immanuel Kant: KrV, B VIII.
17 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 22.
18 Vgl. Rudolf Löbl: Texnh: Untersuchung zur Bedeutung dieses Wortes in der Zeit von Homer bis Aristoteles. Von Homer bis zu den Sophisten, Band 1, Würzburg: Königshausen & Neumann 1997, S. 11,1.
19 Vgl. Monika Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 15.
20 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 23.
21 Vgl. Monika Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 15-16.
22 Vgl. ebd. S. 16.
23 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 23.
24 Vgl. Monika Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 16.
25 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 23.
26 Vgl. Klaus Bergdolt: „Bildende Kunst und Medizin“, Enzyklopädie Medizingeschichte, hg. v. Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner, Berlin / New York: De Gruyter 2005, S. 177.
27 Vgl. Jens Kulenkampff: „Immanuel Kant“, Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 448.
28 Vgl. Monika Betzler: Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 23.
29 Vgl. Christel Fri>Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, S. 303.
30 Vgl. ebd.
31 Vgl. Steinar Mathiesen: „Kants System der schönen Künste“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 162.
32 Jens Kulenkampff: „Immanuel Kant“, Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 454.
33 Vgl. ebd.
34 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 24.
35 Vgl. Karel Kuypers: Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft, Amsterdam / London: North-Holland Publishing Company 1972, S. 30.
36 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 1983, S. 259.
37 Otfried Höffe: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 220 1 8, S. 1.
38 Vgl. ebd.
39 Immanuel Kant: KrV, AA III, 43.
40 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 1
41 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 1983, S. 259.
42 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 1.
43 Vgl. ebd.
44 Vgl. ebd.
45 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 1.
46 Vgl. ebd.
47 Vgl. ebd.
48 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 1983, S. 260.
49 Vgl. Immanuel Kant: KU, B IX.
50 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 3-4.
51 Jens Kulenkampff: „Immanuel Kant“, Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 448.
52 Vgl. Jens Kulenkampff: „Immanuel Kant“, Ästhetik und Kunstphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart in Einzeldarstellungen, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Monika Betzler, Stuttgart: Kröner 1998, S. 448.
53 Vgl. Otfried Höffe: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 1983, S. 260.
54 Kant selbst verwendet den Ausdruck nicht wörtlich, vielmehr spricht er u. a. in der Vorrede der zweiten Auflage von 1787 in der Kritik der reinen Vernunft von einer „Umänderung der Denkart“ (Immanuel Kant: KrV, B 16; derselbe: KrV, AA III, 7-10) in der Philosophie zu vollziehen, eben gleich Kopernikus in der Kosmologie oder bei Euklid in der Geometrie. Vgl. dazu auch Wulff D. Rehfus: Stichwort: „Kopernikanische Wende“, Handwörterbuch Philosophie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht / UTB 2003.
55 Vgl. Birgit Recki: Stichwort „Schönheit“, Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, S. 535.
56 Immanuel Kant: „Einleitung in die Kritik der Urteilskraft“ [1. Fassung], KU, Abschnitt: „VII. Von der Technik der Urteilskraft als dem Grunde der Idee einer Technik der Natur“.
57 Immanuel Kant: KU, B 3, 4.
58 Vgl. Birgit Recki: Stichwort „Schönheit“, Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, S. 535.
59 Immanuel Kant: KU, B 3, 4.
60 Vgl. Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur (§43-§50), Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 220 1 8, S. 142.
61 Mehr zu dem Thema findet sich u. a. bei Wolfgang Bartuschat: Zum systematischen Ort von Kants Kritik der Urteilskraft, Frankfurt: Klostermann 1972; Otfried Höffe: Immanuel Kant, München: C. H. Beck 72007 und bei Henry Allison: Kant's Theory of Freedom, Cambridge: Cambridge University Press 1990.
62 Immanuel Kant: KU, B 3, 4.
63 Vgl. Birgit Recki: Stichwort: „Schönheit“, Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, S. 535.
64 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 4.
65 Vgl. ebd. B 3, 4.
66 Vgl. Birgit Recki: Stichwort „Schönheit“, Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, S. 534.
67 Immanuel Kant: KU, B 17.
68 Ebd. B 32.
69 Ebd. B 62.
70 Immanuel Kant: KU, B 89.
71 Vgl. ebd.
72 Ebd. B 177.
73 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 96.
74 Vgl. ebd.
75 Vgl. Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 155.
76 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 188.
77 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 97.
78 Immanuel Kant: KU, B 174.
79 Vgl. ebd.
80 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 174.
81 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 97.
82 Ebd.
83 Immanuel Kant: KU, B 174.
84 Ebd.
85 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 97-98.
86 Vgl. ebd. S. 98.
87 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 174.
88 Vgl. Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 147.
89 Immanuel Kant: KU, B 175
90 Ebd. B 176.
91 Ebd.
92 Vgl. ebd.
93 Vgl. Dpa, unbekannter Autor: „Gemälde eines Schimpansen erzielt 14.000 Pfund“, Der Spiegel, online verfügbar unter: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/kunst-auktion-gemaelde-eines-schimpansen- erzielt-14-000-pfund-a-361378.html (Stand: 11.09.2020).
94 Immanuel Kant: KU, B 176.
95 Ebd.
96 Ebd.
97 Vgl. ebd.
98 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 98.
99 Vgl. Holger Schumacher: „Jan Vermeer - Magie des Lichts und der Perspektive“, Kunstmuseum, online verfügbar unter: https ://kunstmuseum. com/jan-vermeer/ (Stand: 11.09.2020).
100 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 98.
101 Immanuel Kant: KU, B 176.
102 Vgl. ebd. B 174.
103 Vgl. ebd.
104 Vgl. ebd. B 176.
105 Vgl. Matthias Weber: „Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst“, Dokumentations- und Forschungsprojekt des Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, online verfügbar unter: https://www.bkge.de/Proiekte/Kant/matthias- weber/Matthias Weber Immanuel Kant in Werken der modernen Kunst.php (Stand 04.08.2020).
106 Immanuel Kant: KU, B 178.
107 Ebd.
108 Ebd. B 179.
109 Ebd.
110 Ebd.
111 Vgl. ebd.
112 Ebd.
113 Vgl. Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 148.
114 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 98.
115 Immanuel Kant: KU, B 179.
116 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 99.
117 Ebd.
118 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 180.
119 Vgl. ebd. B 179.
120 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 100.
121 Immanuel Kant: KU, B 180.
122 Ebd. B 181.
123 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 100.
124 Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 156.
125 Vgl. ebd.
126 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 180.
127 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 180.
128 Darüber hinaus findet sich zu dem ästhetischen Geschmacksurteil bei Kant bei folgenden Publikationen mehr dazu: Christel Fri>Kants Theorie des reinen Geschmacksurteils, Berlin / Boston: De Gruyter 1990; Georg Kohler: Geschmacksurteil und ästhetische Erfahrung. Beiträge zur Auslegung von Kants „Kritik der ästhetischen Urteilskraft“, Berlin / Boston: De Gruyter 1980; Wolfgang Wieland: Urteil und Gefühl: Kants Theorie der Urteilskraft, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2001.
129 Immanuel Kant: KU, B 186.
130 Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 156.
131 Ebd.
132 Vgl. ebd.
133 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 186.
134 Vgl. ebd. B 182.
135 Vgl. ebd.
136 Vgl. ebd.
137 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 186.
138 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 102.
139 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 182.
140 Ebd.
141 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 103.
142 Immanuel Kant: KU, B 183.
143 Vgl. ebd. B 185.
144 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 185.
145 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 185.
146 Ebd.
147 Ebd.
148 Vgl. ebd.
149 Ebd. B 186.
150 Ebd. Immanuel Kant: KU, B 186.
151 Vgl. ebd.
152 Vgl. ebd.
153 Vgl. ebd. B 183.
154 Vgl. ebd.
155 Vgl. ebd. B 186.
156 Vgl. Georg Römpp: Kants Ästhetik, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 2020, S. 103.
157 Vgl. Ulrich Eberl: 33 Fragen - 33 Antworten: Künstliche Intelligenz, Piper: München 2020, S. 9.
158 Vgl. Peter Buxmann und Holger Schmidt: Künstliche Intelligenz Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer 2019, S. 64.
159 Ulrich Eberl: 33 Fragen - 33 Antworten: Künstliche Intelligenz, München: Piper 2020, S. 13.
160 Vgl. Selmer Bringsjord und Sundar Govindarajulu Naveen: Stichwort: „Artificial Intelligence”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), hg. v. Edward N. Zalta, online verfügbar unter: https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/artificial-intelligence/ (Stand: 11.09.2020).
161 Mehr zur Pascaline findet sich in dem Vortrag von Rudolf Taschner: Blaise Pascal: Die denkende Maschine, vom 21.11.2012 in den Hofstallungen des mumok, online verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=1QG7bJT4aGs (Stand: 04.08.2020).
162 Vgl. dazu Thomas Bayes: An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances 1763.
163 Vgl. Marnie Benney und Pete Kistler: „Timeline of AI Art“ zusammengestellt in Kooperation mit BBC, MIT und Forbes, AI Artists, online verfügbar unter: https://aiartists.org/ai-timeline-art (Stand: 04.08.2020).
164 Beispielhaft können als Meilensteine dieser Entwicklungen folgende Werke angeführt werden: Gottlob Frege: Die Grundlagen der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl, Breslau: Wilhelm Koebner 1884; derselbe: „Über Sinn und Bedeutung“, Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, Band 100 1892, S. 25-50; derselbe: „Grundlagen der Geometrie (Zweite Reihe)“, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Band 15, 1906; Gottfried Wilhelm Leibniz: Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, Leipzig: Dürr 21904 1765; Leonhard Euler: Mechanica, sive motus scientia analytica exposita, Sankt Petersburg: Ex typographia Academiae Scientiarum 1736; derselbe: Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum, Rostock / Greifswald: A. E. Röse 1765.
165 Vgl. dazu Bertrand Russel: Principia Mathematica [1910-1913]; derselbe: The Philosophy of Logical Atomism [1918-1919].
166 Vgl. dazu Alfred Tarski: “The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics”, Philosophy and Phenomenological Research IV,3 (1944), S. 341-375; derselbe: Einführung in die Mathematische Logik und in die Methodologie der Mathematik, Wien: Springer 1937; derselbe: „Über den Begriff der logischen Folgerung“, Actes du Congrès international dephilosophie scientifique, Paris: Sorbonne 1935, S. 1-11.
167 Vgl. Wolfgang Ertel: Grundkurs Künstliche Intelligenz. Eine praxisorientiere Einführung, Wiesbaden: Springer 42016, S. 8.
168 Vgl. Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 111.
169 Vgl. Marnie Benney und Pete Kistler: „Timeline of AI Art“ zusammengestellt in Kooperation mit BBC, MIT und Forbes, AI Artists, online verfügbar unter: https://aiartists.org/ai-timeline-art (Stand: 04.08.2020).
170 Ada Augusta, Countess of Lovelace: „Notes on L. F. Menabrea’s, Sketch of the Analytical Engine Invented by Charles Babbage’”, Scientific Memoirs, September 1843, online verfügbar unter: https://todayinsci.com/K/King Augusta/KingAugusta-Quotations.htm (Stand: 11.09.2020).
171 Auf diesen Aspekt wird im folgenden Abschnitt im Zuge der Differenzierung zwischen Strong AI und Weak AI ausführlicher eingegangen.
172 Original auf Englisch, übersetzt von Manuela Lenzen in: Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet. München: C. H. Beck 2018, S. 22-23. Vgl. dazu das englische Original: John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, Claude Shannon: A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31. August 1955, online verfügbar unter: http://www-formal.stanford.edu/imc/historv/dartmouth/dartmouth.html (Stand 04.08.2020).
173 Alan Turing: „Computing machinery and intelligence”, Mind Vol. 236 (1950) S. 442.
174 Ebd. S. 433.
175 Vgl. Lulu Zhao: Der Turing-Test und John Searles Gedankenexperiment vom chinesischen Zimmer, online verfügbar unter: http://www.alan-shapiro.com/the-turing-test-and-iohn-searles-chinese-room-argument-bv- lulu-zhao/ (Stand 04.08.2020).
176 Vgl. Alan Turing: „Computing machinery and intelligence”, Mind Vol. 236 (1950) S. 433-434.
177 Bei dem „Chinesische Zimmer“-Gedankenexperiment werden einem Menschen, der sich in einem Raum befindet, durch einen Türschlitz Zettel mit chinesischen Zeichen gereicht. Der Mensch selbst spricht kein Chinesisch und versteht somit auch nicht die Zeichen auf den Zetteln. Anschließend erhält der Mensch einen Fragenkatalog zu den Zeichen auf den Zetteln. Darüber hinaus erhält der Mensch auch ein Handbuch mit Erklärungen in seiner Muttersprache, die ihm Schritt für Schritt erklären, wie er den Fragenkatalog richtig auf Chinesisch beantworten kann. Der Mensch folgt also rein mechanisch den Anweisungen des Handbuchs, ohne den Sinngehalt der Zeichen auf den Zetteln, des Fragenkatalogs oder das Chinesische allgemein zu verstehen. Er kann die richtigen Antworten auf Zetteln durch den Türschlitz wieder hinausreichen. Steht nun vor dem Zimmer ein anderer, der chinesischen Sprache mächtiger, Mensch, kommt dieser zu dem Schluss, dass der Mensch im Zimmer Chinesisch lesen, verstehen und schreiben kann. Das Gedankenexperiment soll veranschaulichen, dass Computer nur Regeln ausführen, ohne die Bedeutung zu verstehen (vgl. dazu John Searle: „Minds, Brains, and Programs“, The Behavioral and Brain Sciences, 1980 (3) S. 417-457).
178 Vgl. Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 117.
179 Ebd.
180 Ebd.
181 Ebd. S. 118.
182 Vgl. ebd.
183 Vgl. John Searle: „Minds, Brains, and Programs“, The Behavioral and Brain Sciences, 1980 (3), S. 417457).
184 Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 118.
185 Ebd.
186 Vgl. ebd.
187 Vgl. ebd. S. 19.
188 Ebd. S. 21.
189 Vgl. ebd.
190 Vgl. Manuela Lenzen in: Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet, München: C. H. Beck 2018, S. 22-23.
191 Vgl. dazu die Website von IBM und die offizielle Erklärung des Unternehmens zu DeepBlue und Gary Kasparov, aus online verfügbar unter: https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/ (Stand: 04.08.2020).
192 Selmer Bringsjord und Naveen Sundar Govindarajulu: Stichwort: Artificial Intelligence”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), hg. v. Edward Zalta, online verfügbar unter: https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/artificial-intelligence, Stand 04.08.2020).
193 Vgl. Manuela Lenzen in: Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet, München: C. H. Beck 2018, S. 22-23.
194 Vgl. Wolfgang Ertel: Grundkurs Künstliche Intelligenz. Eine praxisorientiere Einführung, Wiesbaden: Springer 42016, S. 12.
195 John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochestern und Claude Shannon: A proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence, 31. August 1955, online verfügbar unter: http://www- formal.stanford.edu/imc/history/dartmouth/dartmouth.html (Stand 04.08.2020).
196 Julian Nida-Rümelin im Interview (geführt von Jonas Bickelmann): „Julian Nida-Rümelin: Die ultimative Grenze Künstlicher Intelligenz“, Capital, online verfügbar unter: https://www.capital.de/wirtschaft- politik/iulian-nida-ruemelin-die-ultimative-grenze-kuenstlicher-intelligenz (Stand: 22.09.2020).
197 Brian Copeland: Stichwort: „Artificial intelligence”, Encyclopedia Britannica, online verfügbar unter: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence (Stand: 31.05.2020).
198 Elaine Rich: “Computers and the Humanities”, Vol. 19, No. 2, Natural Language Processing (1985), S.117- 122.
199 Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 20.
200 Vgl. Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 20.
201 Auch im deutschen Sprachraum wird zwischen „Starker KI“ und „Schwacher KI“ unterschieden - dies jedoch meist innerhalb des Sprachgebrauchs der wissenschaftlichen Informatik. Da die vorliegende Untersuchung sich dieser Unterscheidung unter philosophischem Blickwickel zuwendet, die philosophische Forschung zu diesem Bereich jedoch primär im angloamerikanischen Wissenschaftsbetrieb erfolgt, sollen hier die englischen Schreibweisen verwendet werden, da sie den dahinterstehenden Konzepten dadurch sprachlich näher bleiben.
202 Vgl. Ben Goertzel und Cassio Pennachin: „Contemporary approaches to artificial general intelligence”, Artificial General Intelligence, hg. v. Ben Goertzel und Cassio Pennachin, Berlin: Springer 2007.
203 Peter Buxmann und Holger Schmidt: Künstliche Intelligenz Mit Algorithmen zum wirtschaftlichen Erfolg, Berlin: Springer 2019, S. 121-122.
204 Vgl. ebd.
205 Vgl. Julian Nida-Rümelin, Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 203-204.
206 Julian Nida-Rümelin: „Handlung, Technologie und Verantwortung“, Berechenbarkeit der Welt? Philosophie und Wissenschaft im Zeitalter von Big Data, hg. v. Wolfgang Pietsch, Jörg Wernecke und Maximilian Ott, Wiesbaden: Springer 2017, S. 498.
207 Vgl. Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018, S. 203-204.
208 Vgl. ebd.
209 Bei einer nicht-autonomen Form der Kunstschöpfung liegt das dem Schöpfungsakt zugrundeliegende Prinzip der Freiheit in der Person des involvierten - menschlichen - Künstlers, das Zutun von KI bleibt auf nichtkünstlerisches Handwerk begrenzt, vgl. dazu die Ausführungen im 6. Abschnitt dieser Untersuchung.
210 Vgl. Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, et al. : „Generative Adversarial Nets“, im Rahmen der Konferenz Neural Information Processing Systems Conference veröffentlicht, online verfügbar unter: https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets (Stand: 04.08.2020).
211 Vgl. Marnie Benney und Pete Kistler: „Timeline of AI Art“ zusammengestellt in Kooperation mit BBC, MIT und Forbes, AI Artists, online verfügbar unter: https://aiartists.org/ai-timeline-art (Stand: 04.08.2020).
212 Vgl. Manuela Lenzen in: Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet, München: C. H. Beck 2018, S. 121.
213 Vgl. ebd.
214 Vgl. Marnie Benney und Pete Kistler: „Timeline of AI Art“ zusammengestellt in Kooperation mit BBC, MIT und Forbes, AI Artists, online verfügbar unter: https://aiartists.org/ai-timeline-art (Stand: 04.08.2020).
215 Vgl. ebd.
216 Vgl. ebd.
217 Gabe Cohn: „AI Art at Christie’s Sells for $432,500”, The New York Times, 25.10.2018, online verfügbar unter: https://www.nytimes.com/2018/10/25/arts/design/ai-art-sold-christies.html (Stand: 26.08.2020).
218 Immanuel Kant: KrV, B 831.
219 Vgl. Peter Baumann: Die Autonomie der Person, Paderborn: Mentis 2000, S. 142.
220 Die von Kant der praktischen Freiheit entgegengestellte transzendentale Freiheit ist ihrer Konzeption nach weiter gefasst und für die Anwendung auf künstlerische Schöpfung scheinbar wenig ergiebig, da sich das Kunstwerk dem Betrachter insofern als Ausfluss praktischer Freiheit darstellt, als er die transzendentale Freiheit als Bedingung des Kunstwerks lediglich theoretisch anzunehmen, im konkreten Kunstwerk jedoch nicht wahrzunehmen vermag. Vgl. zu Kants Konzeption der Transzendentalen Freiheit u. a.: Herbert Meyer: Kants transzendentale Freiheitslehre, München: Alber 1906; Jochen Bojanowski: Kants Theorie der Freiheit: Rekonstruktion und Rehabilitierung, Berlin / Boston: De Gruyter 2006.
221 Rudolf Eisler: Stichwort: „Freiheit des Willens“, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1899, online verfügbar unter: https://www.textlog.de/32302.html (Stand: 22.09.2020).
222 Immanuel Kant: KrV, B 830.
223 Vgl. ebd. B 831.
224 Rudolf Eisler: Stichwort: „Willkür“, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Berlin 1899, online verfügbar unter: https://www.textlog.de/33282.html (Stand: 22.09.2020).
225 Vgl. Andrea Esser: Stichwort: „Willkür“, Kant-Lexikon. Studienausgabe, hg. v. Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr und Stefano Bacin, Berlin / Boston: De Gruyter 2017, Sp. 2659
226 Vgl. Immanuel Kant: KrV, A 448 / B 476.
227 Verwiesen sei an dieser Stelle auf Nida-Rümelins Humanistische Reflexionen, in denen im Zweiten Abschnitt das Paradoxon aufgezeigt wird, dass die Annahme der Freiheit des Menschen im Urteilen und Handeln zwar in die lebensweltliche Praxis des menschlichen Umgangs unauflöslich verwoben ist, im Mainstream der Philosophie und den Naturwissenschaften Freiheit jedoch bestritten wird. Nida-Rümelin beleuchtet die Freiheitsproblematik in der analytischen Philosophie, da er in ihr den Verlauf der Debatte in den Spezifika, Stärken und Schwächen begründet sieht. Darin vermutet er auch den Grund dafür, dass die zweifellos bedeutendste Strömung der Philosophie des 20. Jahrhunderts zunächst versuchte, die Freiheitsproblematik auszuklammern, wie es noch bis in die Gegenwart teilweise geschieht. Ausgehend davon, zeigt er die, wie er es nennt, „Strawson’sche Perspektive“, auf, „also die in unsere Lebenswelt eingelassenen reaktiven Einstellung und moralischen Empfindungen und ihre Prämisse menschlicher Freiheit und Verantwortung“ (Julian Nida - Rümelin: Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 173.), anhand derer Nida-Rümelin seine eigene systematische Position entwickelt, die er als „theoretischen Humanismus“ bezeichnet (vgl. ebd.).
228 Immanuel Kant: KU, B 180-B 183.
229 Vgl. dazu: „Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben, und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würden.“ (Franz von Brentano: Psychologie vom empirischen Standpunkt, Band 1, Hamburg: Meiner 1955, S. 124-125).
230 Vgl. Eva-Maria Engelen: „Intentionalität und Kontrolle“, Vernunft und Freiheit. Zur praktischen Philosophie von Julian Nida-Rümelin, hg. v. Dieter Sturma, Berlin / Boston: De Gruyter 2012, S. 93.
231 Vgl. Pierre Jacob: Stichwort: “Intentionality”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), hg. v. Edward Zalta, online verfügbar unter: https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/intentionality (Stand 05.08.2020).
232 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 281.
233 Vgl. ebd. S. 280.
234 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 281.
235 Vgl. ebd.
236 Ebd. S. 279.
237 Siehe Abschnitt 4.1 der vorliegenden Untersuchung.
238 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 281.
239 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Eine Theorie praktischer Vernunft, Berlin / Boston: De Gruyter 2020, S. 394.
240 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Eine Theorie praktischer Vernunft, Berlin / Boston: De Gruyter 2020, S. 394.
241 Vgl. ebd.
242 Vgl. ebd.
243 Ebd.
244 Vgl. ebd. S. 41.
245 Julian Nida-Rümelin: „Handlung, Technologie und Verantwortung“, Berechenbarkeit der Welt? Philosophie und Wissenschaft im Zeitalter von Big Data, hg. v. Wolfgang Pietsch, Jörg Wernecke und Maximilian Ott, Wiesbaden: Springer 2017, S. 498.
246 Vgl. ebd.
247 Vgl. ebd. S. 499-500.
248 Immanuel Kant: KU, B 177.
249 Immanuel Kant: KU, B 186.
250 Mit dieser Aussage soll sich innerhalb der Debatte um Strong AI jener Position angeschlossen werden, die eine Ausbildung von Willkür, Freiheit und Autonomie bei KI grundsätzlich für unmöglich erachtet, vgl. dazu die Ausführungen in Abschnitt 4.2, sowie der philosophischen Position des Digitalen Humanismus, wie Nida- Rümelin ihn in dem gleichnamigen Werk vertritt, vgl. dazu: Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld: Digitaler Humanismus. Eine Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, München: Piper 2018.
251 Immanuel Kant: KU, B 177.
252 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 177.
253 Vgl. ebd.
254 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 180-B 181.
255 Vgl. Jens Kulenkampff: „Die ästhetische Bedeutung von Original und Fälschung“, Kunst und Philosophie, Original und Fälschung, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Jakob Steinbrenner, Ostfildern: Hatje Cantz 2011, S. 31-32.
256 Vgl. Martina Kix: „Der Glaube an Kunst ist wie in die Kirche gehen“, Zeit Campus, online verfügbar unter: https://www.zeit.de/campus/2017/02/wolfgang-beltracchi-kunstfaelscher-haft-betrug-kunstmarkt (Stand: 22.09.2020).
257 Vgl. Jens Kulenkampff: „Die ästhetische Bedeutung von Original und Fälschung“, Kunst und Philosophie, Original und Fälschung, hg. v. Julian Nida-Rümelin und Jakob Steinbrenner, Ostfildern: Hatje Cantz 2011, S. 39.
258 Vgl. Friedrich Kirchner und Carl Michaelis: Stichwort: „Buridans Esel“, Wörterbuch der Philosophischen Grundbegriffe, Leipzig 51907, S. 108-109, online verfügbar unter: http://www.zeno.org/Kirchner-Michaelis- 1907/A/Buridans+Esel (Stand: 22.09.2020).
259 Die bekannte physikalische Tatsache, dass ein Objekt nicht gleichzeitig den Raum eines zweiten Objekts annehmen kann, resultiert aus dem logischen Axiom, dass das Merkmal A und das Merkmal Nicht-A einem Objekt nicht gleichzeitig zugesprochen werden können.
260 Andreas Kablitz: „Die Kunst und ihre prekäre Opposition zur Natur“, Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg. v. Otfried Höffe, Berlin / Boston: De Gruyter 22018, S. 148.
261 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 182.
262 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 182.
263 Nur am Rande sei hier angemerkt, dass diese Unerklärbarkeit auch Friedrich Nietzsche in seinem Werk Ecce Homo 1908 beschreibt, indem er die Grundlagen der Inspiration großer Kunstschaffender näher ausleuchtet und in dem er betont, dass der Künstler kein Schöpfer, sondern der Entstehung seiner Werke als bloßer „Zuschauer“ beiwohne (vgl. „Inspiration“, Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 4, Basel 1976, Sp. 401-403).
264 Vgl. Immanuel Kant: KU, B 182.
265 Vgl. ebd.
266 Vgl. Oto Bihalji-Merin: Die Kunst der Naiven. Themen und Beziehungen (Katalog der gleichnamigen Ausstellung, Haus der Kunst, 1. November 1974 bis 12. Januar 1975), München 1975.
267 Vgl. Julian Nida-Rümelin: Humanistische Reflexionen, Berlin: Suhrkamp 2016, S. 281.
268 Volker Harlan: „Das Gespräch mit Joseph Beuys. Was ist Kunst?“, Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys, hg. v. Volker Harlan, Stuttgart: Urachhaus 62001, S. 81.
269 Vgl. Eva Beuys, Wenzel Beuys und Jessyka Beuys: Joseph Beuys. Block Beuys, München: Schirmer / Mosel 1990, S. 270.
270 Ebd.
271 Ebd.
272 Vgl. ebd.
273 Vgl. Barbara Lange: Stichwort: „Soziale Plastik“, DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, hg. v. Hubertus Butin, Amsterdam: Snoeck 2014, S. 276.
274 Volker Harlan: „Das Gespräch mit Joseph Beuys. Was ist Kunst?“, Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys, hg. v. Volker Harlan, Stuttgart: Urachhaus 62001, S. 81.
275 Volker Harlan: „Das Gespräch mit Joseph Beuys. Was ist Kunst?“, Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Joseph Beuys, hg. v. Volker Harlan, Stuttgart: Urachhaus 62001, S. 81.
276 Ebd.
277 Vgl. ebd.
278 Immanuel Kant: KU, B 174.
279 Art. 5, Abs. 3, Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG).
280 §2 Geschützte Werke, Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG).
281 Vgl. dazu das LG Berlin, Urteil vom 6. Mai 1986, Az. 16 O 72/86, online verfügbar unter: https://web.archive.org/web/20060104142213/http://www.netlaw.de/urteile/lgb 20.htm (Stand 22.09.2020).
282 Vgl. dazu Abschnitt 4.3 dieser Untersuchung.
283 Vgl. Matthias Bunge: „Vom Ready-made zur „Fettecke“. Beuys und Duchamp - ein produktiver Konflikt“, Joseph Beuys. Verbindungen im 20. Jahrhundert, hg. v. Hessisches Landesmuseum Darmstadt, S. 28.
284 Immanuel Kant: KU, B 17.
285 Ebd. B 3.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die Titel, Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es analysiert Themen in einer strukturierten und professionellen Weise, insbesondere im akademischen Kontext.
Was sind die Hauptthemen des Dokuments?
Die Hauptthemen umfassen die Philosophie der Kunst, insbesondere Kants Begriff der "schönen Kunst", künstliche Intelligenz (KI) unter philosophischen Aspekten, und die Frage, ob KI in der Lage ist, schöne Kunst im kantischen Sinne zu schaffen. Es wird auch das Prinzip der Autorschaft als Prämisse für Kunst im Zeitalter der KI untersucht.
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Das Dokument ist in mehrere Abschnitte unterteilt: Inhaltsverzeichnis, Einleitung, methodische Vorbemerkungen, Verortung der Forschungsfrage (philosophiehistorische Einordnung des Kunstbegriffs und Stellung der Kritik der Urteilskraft im Gesamtwerk Kants), Definition der schönen Kunst im kantischen Sinne, philosophische Aspekte der KI, die Frage ob KI schöne Kunst schaffen kann, und eine zeitgenössische Ausweitung des Kunstbegriffs im Zeitalter der KI, eine Schlussfolgerung und ein Literaturverzeichnis.
Welche Rolle spielt Immanuel Kant in diesem Dokument?
Immanuel Kant spielt eine zentrale Rolle, da seine Ästhetik und sein Begriff der "schönen Kunst" als Grundlage für die Analyse der Fähigkeiten von KI dienen. Die Kritik der Urteilskraft wird ausführlich diskutiert.
Was versteht Kant unter "schöner Kunst"?
Schöne Kunst ist für Kant die Kunst, die aus dem Genie hervorgeht und die Regeln der Kunst vorgibt. Sie unterscheidet sich von Natur, Wissenschaft und Handwerk und zeichnet sich durch Originalität, Exemplarität, Unerklärbarkeit und Naturbezug aus.
Kann KI im kantischen Sinne schöne Kunst hervorbringen?
Das Dokument argumentiert, dass KI nicht in der Lage ist, schöne Kunst im kantischen Sinne hervorzubringen, da ihr die für Kant notwendige Freiheit und das Genie fehlen. Auch nach dem Prinzip der Autorschaft ist KI unfähig Kunst zu schaffen.
Was ist der Unterschied zwischen Strong AI und Weak AI im Kontext des Dokuments?
Strong AI bezieht sich auf die Realisierung kognitiver Leistungen und Fähigkeiten, die denen des Menschen ähneln, während Weak AI sich auf die Simulation kognitiver Leistungen zur Lösung spezifischer Probleme konzentriert. Das Dokument verwendet den Begriff KI im Sinne des Konzepts einer Weak AI.
Was bedeutet das Prinzip der Autorschaft im Zusammenhang mit KI und Kunst?
Das Prinzip der Autorschaft besagt, dass Kunst ein Ergebnis menschlicher Intention, Kontrolle und Verantwortlichkeit sein muss. Da KI diese Eigenschaften nicht besitzt, kann sie keine originäre Kunst schaffen.
Welche Rolle spielt Joseph Beuys und sein "erweiterter Kunstbegriff" in diesem Dokument?
Das Dokument untersucht, inwiefern KI dem erweiterten Kunstbegriff von Joseph Beuys gerecht werden kann. Auch hier wird argumentiert, dass KI keine Kunst schaffen kann, da ihr die Freiheit und Autorschaft fehlen.
Wie wird das deutsche Urheberrecht im Dokument behandelt?
Das Dokument analysiert, ob von KI erstellte Werke nach deutschem Urheberrecht als Kunstwerke gelten können. Es wird argumentiert, dass das Urheberrecht persönliche geistige Schöpfungen erfordert und somit von KI erstellte Werke nicht als Kunstwerke anerkannt werden können.
- Citation du texte
- Dorothea Winter (Auteur), 2020, Kann Künstliche Intelligenz (KI) schöne Kunst schaffen? Eine zeitgenössische Ausweitung des Kunstbegriffs von Immanuel Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025318