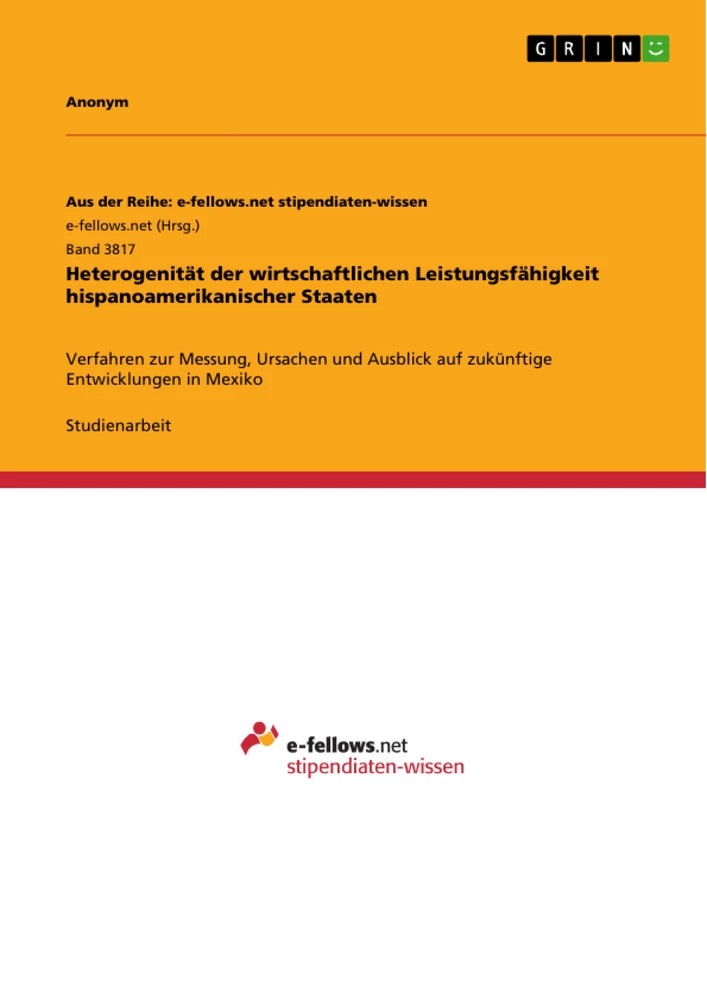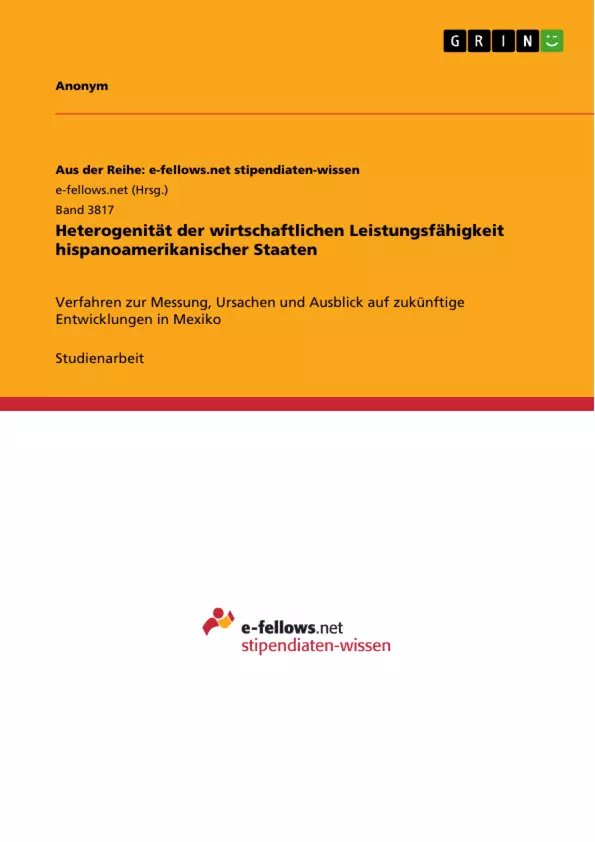Ein Teilziel dieser Arbeit soll sein, für wirtschaftliche Leistungen eine theoretische Grundlage zu schaffen. Dafür werden zunächst generell die zentralen Begriffe definiert und erklärt. Hierbei stehen die Art und Weise der Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie Faktoren, die auf sie Einfluss haben, im Fokus. Ein weiteres Modalziel ist eine Beschreibung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Hispanoamerikas. Darauf aufbauend gilt als finales Ziel dieser Arbeit, mögliche Ursachen der Heterogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hispanoamerikanischer Staaten herauszuarbeiten. Als letztes Teilziel soll gelten, mit Hilfe der zuvor definierten Einflussfaktoren einen Ausblick auf die Entwicklung wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit anhand des konkreten Beispiels Mexikos zu geben.
"Over the past 15 years, Latin America’s economies have grown by around 3 percent a year, slower than any other developing region." Diese Aussage findet sich in einem Discussion Paper des McKinsey Global Institute (MGI) aus dem Jahr 2017 und sie verdeutlicht, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der hispanoamerikanischen Volkswirtschaften in den letzten Jahrzehnten stark hinter anderen Entwicklungsländern zurückblieb. China, Südasien und auch Subsahara-Afrika haben über den gleichen Zeitraum Wachstumsraten ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) von über 5% vorweisen können. Aber auch innerhalb der Region des Wirtschaftsraums Hispanoamerika lässt sich eine signifikante Heterogenität in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erkennen. Die Staaten Peru und Panama liegen mit 5,3% und 6,5% jährlichem Wachstum des BIP deutlich über der Wachstumsrate von Ländern wie El Salvador und Venezuela mit 1,9% und 2,1%. An diesen Beispielen lässt sich die Relevanz der Themenstellung deutlich erkennen, denn das wirtschaftliche Wachstum eines Landes ist in Abhängigkeit von anderen Faktoren ein essenzieller Indikator über den zukünftigen Wohlstand der jeweiligen Bevölkerung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau und Vorgehen
- 1.4 Abgrenzung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Klärung zentraler Begriffe und Definitionen
- 2.2 Verfahren zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- 2.3 Determinanten wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
- 3 Analyse
- 3.1 Heterogene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hispanoamerikanischer Staaten
- 3.2 Ursachen der Heterogenität wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
- 3.3 Reflexion der Analyseergebnisse
- 3.4 Ausblick auf zukünftige Entwicklungen in Mexiko
- 4 Zusammenfassung und kritische Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, die Heterogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hispanoamerikanischer Staaten zu analysieren und zu erklären. Sie möchte die Ursachen für die Unterschiede im Wirtschaftswachstum der Region untersuchen und die zukünftige Entwicklung, am Beispiel Mexikos, prognostizieren.
- Messung und Definition der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Faktoren, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinflussen
- Analyse der Heterogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Hispanoamerika
- Ursachen für die Unterschiede im Wirtschaftswachstum in der Region
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Mexiko
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hispanoamerikanischer Staaten ein. Es stellt die Problemstellung dar, die in der unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Länder liegt. Weiterhin werden die Ziele und der Aufbau der Arbeit erläutert, sowie eine Abgrenzung zu anderen Themen vorgenommen.
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen behandelt. Es werden wichtige Begriffe und Definitionen geklärt, sowie Verfahren zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Determinanten des Wirtschaftswachstums untersucht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Analyse der Heterogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Hispanoamerika. Hier werden die Unterschiede im BIP-Wachstum der einzelnen Staaten beleuchtet und mögliche Ursachen für diese Heterogenität untersucht.
Schlüsselwörter
Hispanoamerika, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Heterogenität, BIP-Wachstum, Determinanten des Wirtschaftswachstums, Mexiko, Analyse, Entwicklung, Einflussfaktoren, Wachstumsunterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Hispanoamerika so unterschiedlich?
Die Heterogenität resultiert aus verschiedenen Faktoren wie politischer Stabilität, dem Grad der Korruption, der Qualität der Infrastruktur, Bildungsniveaus und der Abhängigkeit von Rohstoffexporten.
Wie wird wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gemessen?
Der zentralste Indikator ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und dessen jährliche Wachstumsrate. Ergänzend werden oft Faktoren wie Kaufkraftparität und soziale Indikatoren herangezogen.
Welche Länder in der Region zeigen ein besonders starkes Wachstum?
Staaten wie Peru und Panama verzeichneten in den letzten Jahren Wachstumsraten von über 5 %, während Länder wie Venezuela oder El Salvador deutlich dahinter zurückblieben.
Was sind die Hauptursachen für das langsame Wachstum der Region insgesamt?
Im Vergleich zu Regionen wie China oder Südasien leidet Lateinamerika oft unter strukturellen Problemen, geringer Produktivität und einer unzureichenden Diversifizierung der Wirtschaft.
Wie wird die wirtschaftliche Zukunft Mexikos eingeschätzt?
Mexiko dient als Beispiel für eine Volkswirtschaft mit großem Potenzial, deren Entwicklung jedoch stark von externen Faktoren (wie dem Handel mit den USA) und internen Reformen abhängt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Heterogenität der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hispanoamerikanischer Staaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025832