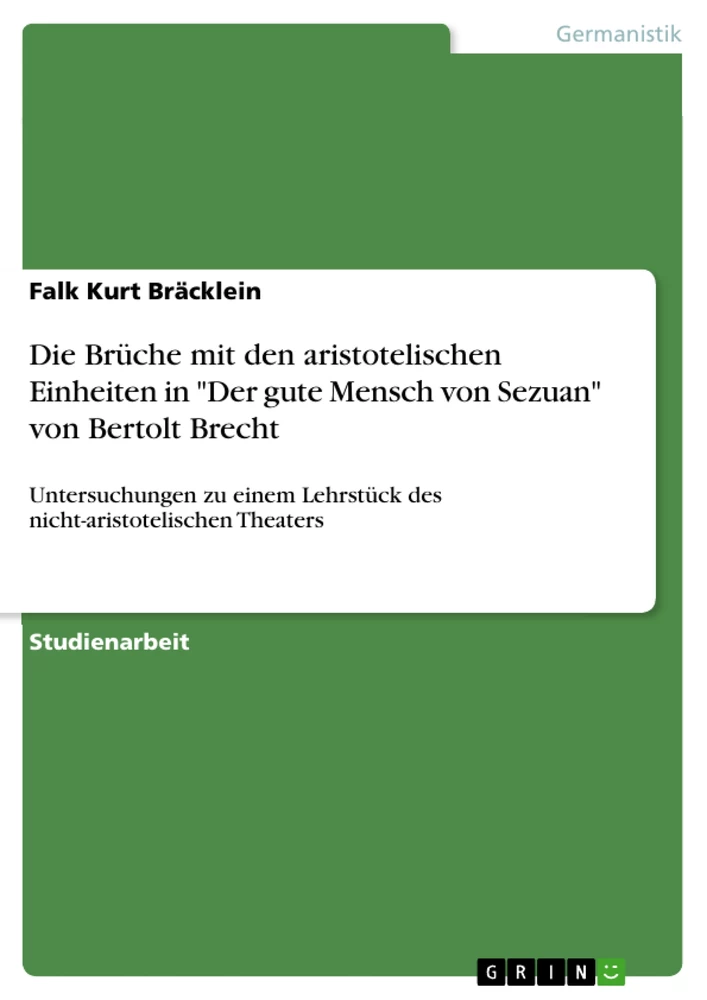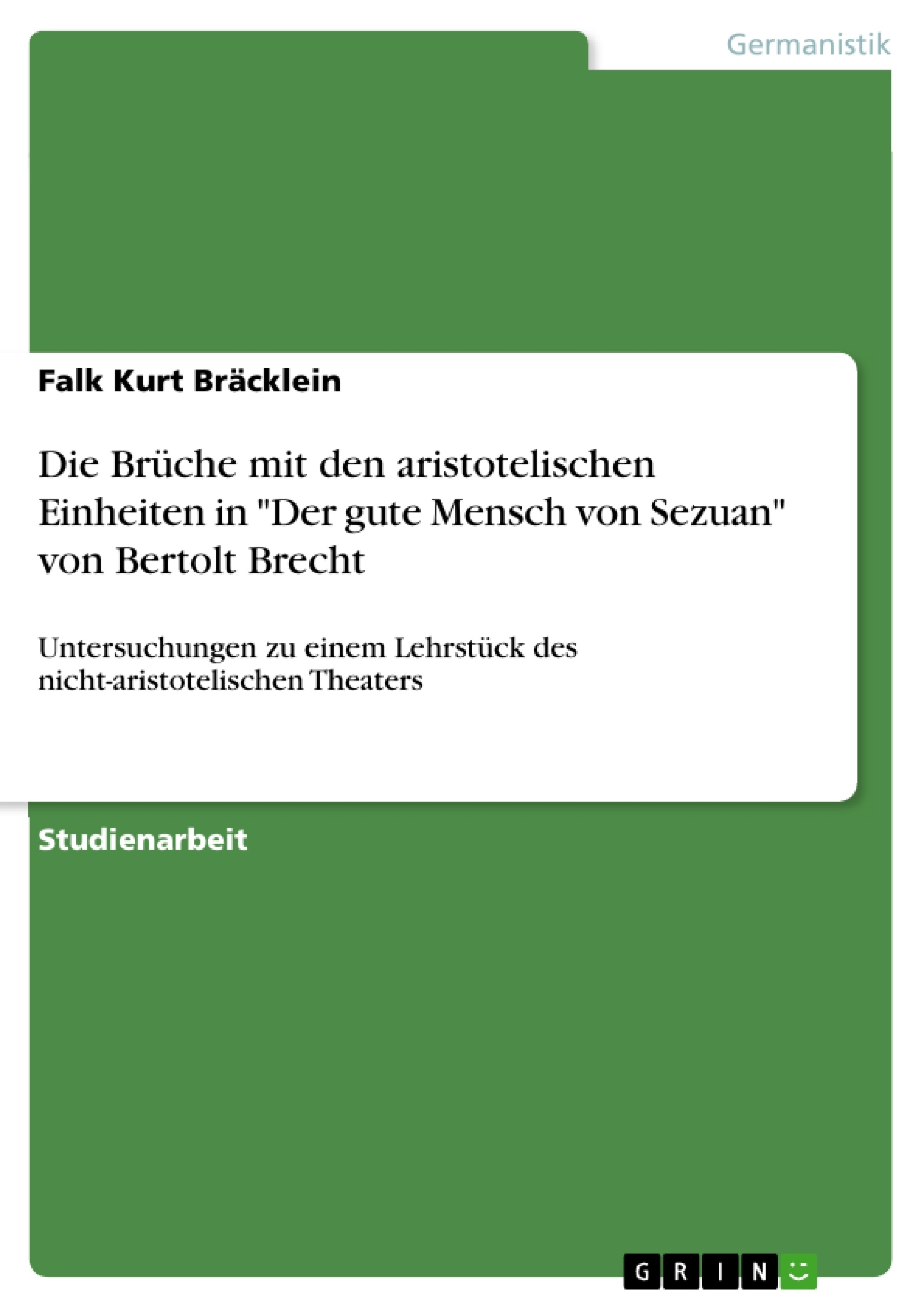Ziel dieser Arbeit ist es, am Beispiel von Bertolt Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" nachzuvollziehen, mit welchen Mitteln das epische Theater Brüche mit den stilistischen Konventionen des aristotelischen Theaters erwirkt.
Zu diesem Zweck wird der Einsatz von Verfremdungseffekten auf der Figuren- sowie der Handlungsebene untersucht. Darüber hinaus sollen die Brüche des Stückes mit den drei aristotelischen Einheiten (Ort, Zeit und Handlung) anhand von Textstellen nachgewiesen und deren Wirkung auf das Publikum untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Brüche des Epischen Theaters mit dem Aristotelischen Theater im Drama "Der gute Mensch von Sezuan"
- Verhinderung der Einfühlung durch den V-Effekt
- Aufhebung der Einheit der Zeit
- Aufhebung der Einheit der Handlung
- Aufhebung der Einheit des Ortes
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Bertolt Brechts Drama "Der gute Mensch von Sezuan" mit dem Ziel, die Brüche mit den aristotelischen Einheiten im klassischen Theater aufzuzeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Untersuchung, wie Brecht die Prinzipien des epischen Theaters im Stück umsetzt und welche Auswirkungen dies auf die Rezeption des Dramas hat.
- Verhinderung der Einfühlung durch den V-Effekt
- Aufhebung der aristotelischen Einheiten (Zeit, Handlung, Ort)
- Das epische Theater als Mittel der kritischen Reflexion und Handlungsanregung
- Die Darstellung von Moral und Kapitalismus im Stück
- Die Rolle der Götter und ihre Funktion innerhalb der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über Bertolt Brechts Werk und das Drama "Der gute Mensch von Sezuan". Sie führt in die Thematik der Arbeit ein und skizziert die Forschungsfrage, welche die Analyse des Stückes im Hinblick auf die aristotelischen Einheiten betrifft.
Das zweite Kapitel befasst sich ausführlich mit der Analyse von Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" im Hinblick auf die aristotelischen Einheiten. Dabei wird insbesondere auf die Verhinderung der Einfühlung durch den V-Effekt, die Aufhebung der Einheit der Zeit, Handlung und Ort sowie die Funktionsweise des epischen Theaters eingegangen.
Das dritte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Bedeutung der Brüche mit den aristotelischen Einheiten in Brechts "Der gute Mensch von Sezuan".
Schlüsselwörter
Bertolt Brecht, "Der gute Mensch von Sezuan", episches Theater, V-Effekt, Verfremdungseffekt, aristotelische Einheiten, Katharsis, Einfühlung, Moral, Kapitalismus, China, Götter.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei aristotelischen Einheiten?
Die drei Einheiten des klassischen Dramas sind die Einheit des Ortes (ein Schauplatz), die Einheit der Zeit (Handlung innerhalb von 24 Stunden) und die Einheit der Handlung (ein geschlossener Handlungsstrang).
Wie bricht Bertolt Brecht diese Einheiten in „Der gute Mensch von Sezuan“?
Brecht nutzt wechselnde Orte, Zeitsprünge über Monate hinweg und eine episodische Handlung, um die Illusion des Zuschauers zu durchbrechen und kritisches Denken zu fördern.
Was ist der Verfremdungseffekt (V-Effekt)?
Der V-Effekt ist ein Mittel des epischen Theaters, das dem Zuschauer das Gezeigte fremd erscheinen lässt, um eine emotionale Einfühlung zu verhindern und stattdessen Reflexion zu ermöglichen.
Warum verzichtet Brecht auf die Katharsis?
Anstatt den Zuschauer durch Mitleid und Furcht zu reinigen (Katharsis), will Brecht ihn aktivieren, damit er die gesellschaftlichen Verhältnisse (z.B. Kapitalismus) hinterfragt und verändert.
Welche Rolle spielen die Götter in dem Stück?
Die Götter fungieren als Beobachter, die nach einem „guten Menschen“ suchen, aber an der Realität der wirtschaftlichen Zwänge scheitern, was die Ohnmacht moralischer Appelle im Kapitalismus verdeutlicht.
- Quote paper
- Falk Kurt Bräcklein (Author), 2019, Die Brüche mit den aristotelischen Einheiten in "Der gute Mensch von Sezuan" von Bertolt Brecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1025848