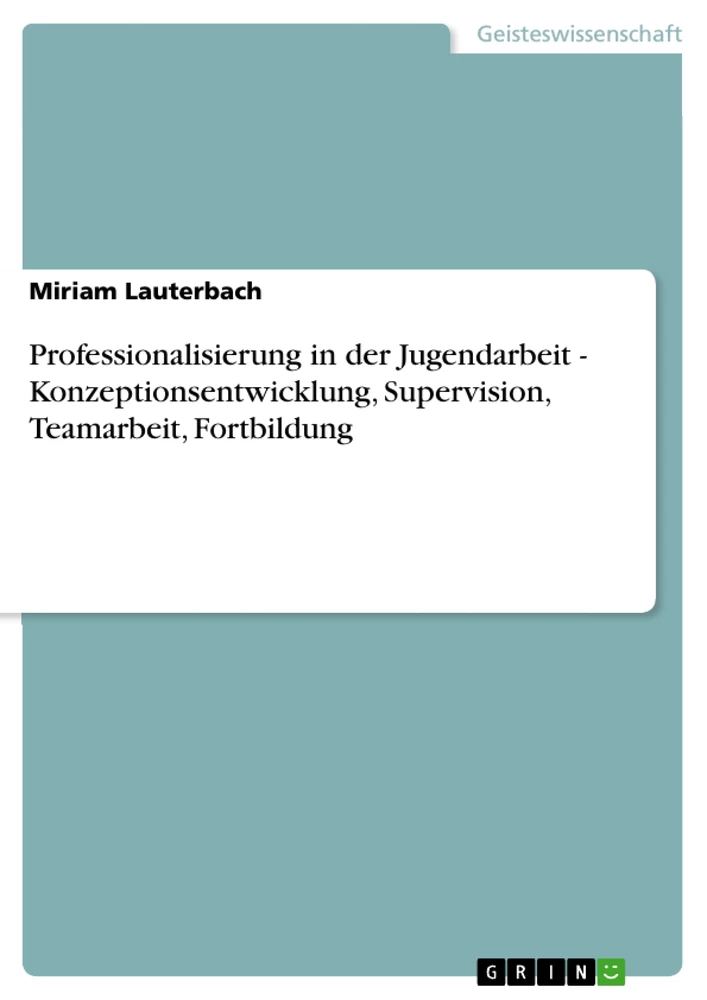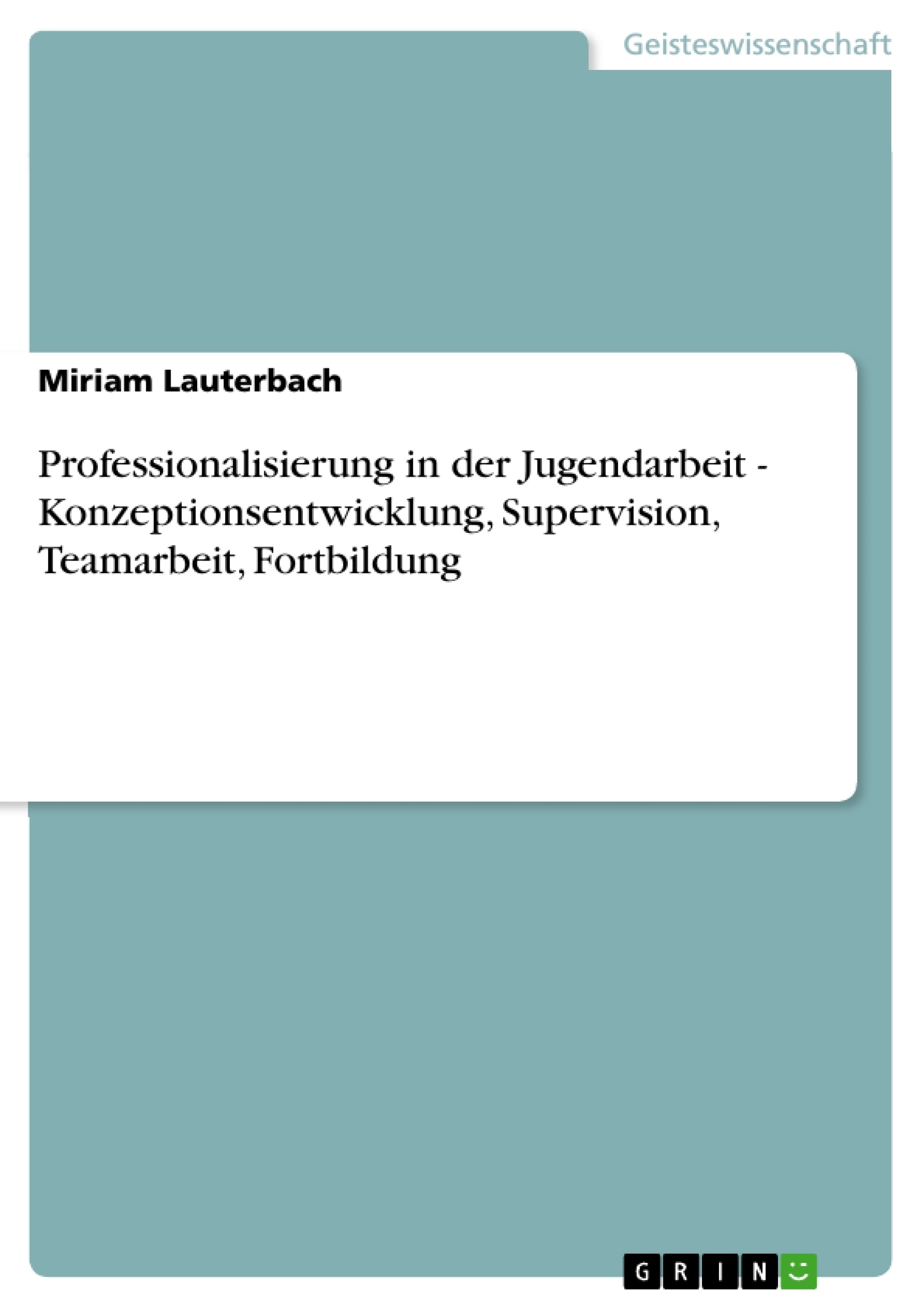Konzeptionsentwicklung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Konzeptionen sind Texte, welche auf Grundlage einer umfassenden Sozialraumanalyse Zielformulierungen erarbeiten, feststellen und anstreben. Des weiteren beschreiben sie mittels konkreten einzelnen Handlungsschritten, welche auf
die vorhandenen Ressourcen abgestimmt sind, wie diese Teil- und Gesamtziele zu erreichen sind und wie im Nachhinein eine Kontrolle der Qualität dieser erreichten Ziele stattzufinden hat.
1. Konzeptionsverständnis
Konzeptionen sind das Verbindungsglied zwischen Theorie und Praxis.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Inhalte von Konzeptionen
- Bestimmung von Leitbildern bzw. Grundsatzerklärungen
- Analyse der Lebensbedingungen, Probleme und Bedürfnisse
- Bestimmung der daraus resultierenden Problem- oder Aufgabenstellung
- Bestimmung der Zielgruppe
- theoretische Grundlagen
- Bestimmung von Global- und Teilzielen
- Bestimmung von Handlungsformen (Operationalisierungen)
- Bestimmung von Rahmenbedingungen (Organisationsstrukturen, Finanzen, Personal, Methoden, Handlungsprinzipien...)
- Festlegung der Reflexionsmethoden
3. Die Sozialraumanalyse
„Der erste Schritt sozialräumlicher Konzeptentwicklung besteht darin, sich unabhängig von Vorgaben, Rahmenbedingungen und Zielen der Jugendarbeit ein Bild von den Orten und Räumen der Kinder und Jugendlichen und deren Qualitäten, Einschränkungen und Möglichkeiten zu machen. Erst auf Grundlage dieser Lebensweltanalyse kann es um die Fragestellung gehen, welchen Stellenwert die [vorhandene oder entstehende] Einrichtung der Jugendarbeit in der jeweils spezifischen Lebenswelt als Teil der sozialen Infrastruktur aus der Sicht von den Kindern und den Jugendlichen einnimmt, und welche neue Funktionen und Aufgaben der Jugendarbeit sich daraus ergeben.“
Analyse der Lebenswelt u.a. durch folgende Methoden:
- Interviews mit Jugendlichen
- Stadterkundung mit Jugendlichen
- Erstellen von subjektiven Landkarten, bei denen die Jugendlichen ihre eigene Wahrnehmung des Umfeldes deutlich machen
- Fremdbilderkundungen, durch Befragung von Anwohnern, Passanten usw.
- die Cliquenbeobachtung
4. Funktionen von Konzeptionen
- Erhöhung der Professionalität und Fachlichkeit (Qualifizierung);
- Integration aller Beteiligten (Träger, Mitarbeiter, Klienten, Umfeld).
- Förderung von Verständigungsprozessen durch die gemeinsame Erarbeitung;
- Vergewisserung des eigenen Standortes mit all seinen Bereichen;
- Festlegung der Problem- und Aufgabendefinition;
- Orientierung für das praktische Handeln (durch Planungs- und Entscheidungsrichtlinien) und des eigene Verhaltens nach außen („Corporate Identity“);
- Schaffen von Planungs- und Verfahrensstrukturen;
- Eingrenzung der Handlungsbereiche;
- reflexionsfördernd;
- Legitimationsmittel nach außen.
Supervision
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Supervision ist ein Instrument zur Unterstützung und
Beratung von Berufstätigen. Als „Nachdenken unter Anleitung“ ist sie eine Beratungsform für berufliche Probleme. Neben einer psychischen Entlastung strebt Supervision die Erhöhung der
Professionalität der Beteiligten und eine Verbesserung von institutionellen Rahmenbedingungen an.
1. Ziele von Supervision
- Professionalisierung des beruflichen Handelns
- Bewältigung von Belastungen
- Vermittlung neuer Handlungsperspektiven
- Persönlichkeitsentwicklung
- Verbesserung von Arbeitsklima
2. Wirkungsweise von Supervision
- Betrachtung und Reflexion von Problemen aus der Distanz
- Einsicht in innere Gegebenheiten (Interpretations- und Bewertungsmuster)
- Entlastung durch emotionale Annahme
- Erweiterung der Reflexionskompetenz
- Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstexploration
- Differenzierung der eigenen Wahrnehmung konkrete Problembearbeitung:
- tieferes Verstehen des Problems durch Darstellen, Verbalisieren und Herausarbeiten
- Perspektivenwechsel
- Ideen zur Lösung der Schwierigkeiten
- Ausprobieren und Reflexion von Lösungs- und Handlungsalternativen
- Aufdeckung von tiefergehenden Problemursachen (z.B. Störungen im Kollegenkreis, in der Familie)
Teamarbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Was leistet das Team?
Team = Arbeitsgemeinschaft
Teamarbeit = Arbeit eines gut aufeinander abgestimmten Teams
Das Team hat die Funktion einer kollegialen Gemeinschaft, die nicht nur fachlichen Halt bietet, sondern zudem Qualitäten auf ganz persönlicher Ebene aufweist
1. Team als Gewähr professioneller Sicherheit durch Emotionalität und fachlichen Austausch (persönliche Identitätsfindung)
- Rückkoppelung der Teammitglieder in seiner inhaltlichen Arbeitsform
- Gefühl von Geborgenheit
- Gefühl, als Person wichtig zu sein
- „Nest“ und „Spiegel“
- Pool von Fachwissen
- Fallverstehen als kommunikativer Prozeß
- Ort für fachliche Selbstreflexion und Konsensfindung
- Korrektiv für inhaltliche Entscheidungen
- social support
2. Team als Lernfeld für Kommunikation
- Teammitglieder stellen gemeinsame Spielregeln der Kommunikation auf (z.B. sich gegenseitig zuhören)
- gemeinsamer Lernprozeß
3. Team als Modell oder Vorbild für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Gleichberechtigung untereinander als Grundlage, um Jugendlichen unter den gleichen Voraussetzungen zu begegnen
- Umgang der Teammitglieder miteinander haben Vorbildfunktion für die Jugendlichen
4. Team als fachliche Solidargemeinschaft und soziales Netzwerk
- Team als „Gemeinschaft unter Gleichen“
- Persönlichkeit des einzelnen wichtig
- Sympathie entsteht im privaten Verhältnis der Teammitglieder
Fortbildung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Aufgaben der Fortbildung
- Weiterentwicklung der pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Fachlichkeit
- Prozesse der Persönlichkeitsbildung, insbesondere der berufsbiographischen Selbstreflexion
- Verschränkung wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnis- und Handlungsperspektiven
2. Elemente der Fortbildung
- Arbeit mit Gruppen aus konkreten lokalen Arbeitszusammenhängen
- Fortbildner müssen konkrete Realitäten zunächst zur Kenntnis nehmen
- Konfrontation der PraktikerInnen mit theoretischen Sichtweisen ihrer Praxis
- kooperative Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen für die Gestaltung von Handlungsbedingungen, die professionelles Arbeiten erst ermöglichen
- Erarbeitung von Konzeptionen durch die PraktikerInnen
- Diskussion der Konzeptionen mit beteiligten Theoretikern
3. Fortbildung als „beratende Rekonstruktion“ (Dewe)
- explizit knowledge: Informationen wie z.B. Fakten. Wissen, welches man einfach beschreiben kann ; tacit knowledge: Wissen aufgrund von Erfahrung (Verständnis, Instinkt, Ahnung oder Intuition)
- Ziele der „beratenden Rekonstruktion“: Reflexion, Rationalisierung und Innovation des zur Verfügung stehenden Repertoires, vor allem Explikation des „tacit knowledge“
- wissenschaftlicher Berater: Anfertigung von Beobachtungsprotokollen unter der Maxime „Was irritiert mich“
- gezieltes Nachfragen und argumentative Konfrontation –> Professioneller unter Rechtfertigungsdruck –> was bisher implizit sein Handeln bestimmte, wird in den Rechtfertigungen explizit
- Reflexion des eigenen Wahrnehmens und Handelns
- Wahrnehmung, Kommunikation und Selbstreflexion als Kompetenzen für soziales Handeln werden gefördert
Literatur:
- Deinet, Ulrich und Sturzenhecker, Benedikt: Handbuch Offene Jugendarbeit,
Münster: Votum-Verlag, 3. Aufl. , 2000
- Kolbe, F./Kiesel, D.: Professionalisierung durch Fortbildung in der Jugendarbeit. Frankfurt: Haag & Hercken Verlag, 1997
- Böhnisch et al. Jugendarbeit als Lebensort
- Dewe, B. Et al. Erziehen als Profession.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Konzeptionen laut diesem Dokument?
Konzeptionen sind Texte, welche auf Grundlage einer umfassenden Sozialraumanalyse Zielformulierungen erarbeiten, feststellen und anstreben. Sie beschreiben mittels konkreten einzelnen Handlungsschritten, welche auf die vorhandenen Ressourcen abgestimmt sind, wie diese Teil- und Gesamtziele zu erreichen sind und wie im Nachhinein eine Kontrolle der Qualität dieser erreichten Ziele stattzufinden hat.
Welche Inhalte haben Konzeptionen typischerweise?
Konzeptionen beinhalten die Bestimmung von Leitbildern, die Analyse der Lebensbedingungen, Probleme und Bedürfnisse, die Bestimmung der Problem- oder Aufgabenstellung, die Bestimmung der Zielgruppe, theoretische Grundlagen, die Bestimmung von Global- und Teilzielen, die Bestimmung von Handlungsformen, die Bestimmung von Rahmenbedingungen und die Festlegung der Reflexionsmethoden.
Was ist eine Sozialraumanalyse?
Eine Sozialraumanalyse ist der erste Schritt sozialräumlicher Konzeptentwicklung und dient dazu, sich unabhängig von Vorgaben, Rahmenbedingungen und Zielen der Jugendarbeit ein Bild von den Orten und Räumen der Kinder und Jugendlichen und deren Qualitäten, Einschränkungen und Möglichkeiten zu machen.
Welche Methoden werden für die Analyse der Lebenswelt im Rahmen einer Sozialraumanalyse genannt?
Zu den genannten Methoden gehören Interviews mit Jugendlichen, Stadterkundungen mit Jugendlichen, das Erstellen von subjektiven Landkarten, Fremdbilderkundungen durch Befragung von Anwohnern und die Cliquenbeobachtung.
Welche Funktionen haben Konzeptionen?
Konzeptionen erhöhen die Professionalität und Fachlichkeit, integrieren alle Beteiligten, fördern Verständigungsprozesse, vergewissern den eigenen Standort, legen die Problem- und Aufgabendefinition fest, orientieren das praktische Handeln, schaffen Planungs- und Verfahrensstrukturen, grenzen die Handlungsbereiche ein, fördern Reflexion und dienen als Legitimationsmittel nach außen.
Was ist Supervision?
Supervision ist ein Instrument zur Unterstützung und Beratung von Berufstätigen. Sie ist eine Beratungsform für berufliche Probleme, die neben einer psychischen Entlastung auch die Erhöhung der Professionalität der Beteiligten und eine Verbesserung von institutionellen Rahmenbedingungen anstrebt.
Welche Ziele verfolgt Supervision?
Supervision zielt auf die Professionalisierung des beruflichen Handelns, die Bewältigung von Belastungen, die Vermittlung neuer Handlungsperspektiven, die Persönlichkeitsentwicklung und die Verbesserung des Arbeitsklimas ab.
Wie wirkt Supervision?
Supervision wirkt durch die Betrachtung und Reflexion von Problemen aus der Distanz, die Einsicht in innere Gegebenheiten, die Entlastung durch emotionale Annahme, die Erweiterung der Reflexionskompetenz, die Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstexploration, die Differenzierung der eigenen Wahrnehmung und die konkrete Problembearbeitung.
Welche Bedeutung hat Teamarbeit?
Teamarbeit bietet fachlichen Halt und Qualitäten auf persönlicher Ebene. Das Team dient als kollegiale Gemeinschaft, die emotionale Sicherheit, fachlichen Austausch, ein Lernfeld für Kommunikation, ein Modell für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und eine fachliche Solidargemeinschaft bietet.
Welche Aufgaben hat Fortbildung?
Fortbildung dient der Weiterentwicklung der pädagogischen und sozialwissenschaftlichen Fachlichkeit, den Prozessen der Persönlichkeitsbildung, insbesondere der berufsbiographischen Selbstreflexion, und der Verschränkung wissenschaftlicher und praktischer Erkenntnis- und Handlungsperspektiven.
Was sind Elemente der Fortbildung?
Elemente der Fortbildung sind die Arbeit mit Gruppen aus konkreten lokalen Arbeitszusammenhängen, die Kenntnisnahme der konkreten Realitäten durch die Fortbildner, die Konfrontation der PraktikerInnen mit theoretischen Sichtweisen ihrer Praxis, die kooperative Erarbeitung von Vorschlägen und Empfehlungen und die Diskussion der Konzeptionen mit beteiligten Theoretikern.
Was ist "beratende Rekonstruktion" im Kontext der Fortbildung?
"Beratende Rekonstruktion" zielt auf die Reflexion, Rationalisierung und Innovation des zur Verfügung stehenden Repertoires ab, vor allem auf die Explikation des "tacit knowledge". Dies beinhaltet die Reflexion des eigenen Wahrnehmens und Handelns, wodurch Wahrnehmung, Kommunikation und Selbstreflexion als Kompetenzen für soziales Handeln gefördert werden.
Welche Literatur wird in dem Dokument genannt?
Es werden genannt: Deinet, Ulrich und Sturzenhecker, Benedikt: Handbuch Offene Jugendarbeit; Kolbe, F./Kiesel, D.: Professionalisierung durch Fortbildung in der Jugendarbeit; Böhnisch et al. Jugendarbeit als Lebensort; Dewe, B. Et al. Erziehen als Profession; Deinet, U./Sturzenhecker, B.: Konzepte entwickeln.
- Citation du texte
- Miriam Lauterbach (Auteur), 2001, Professionalisierung in der Jugendarbeit - Konzeptionsentwicklung, Supervision, Teamarbeit, Fortbildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102618