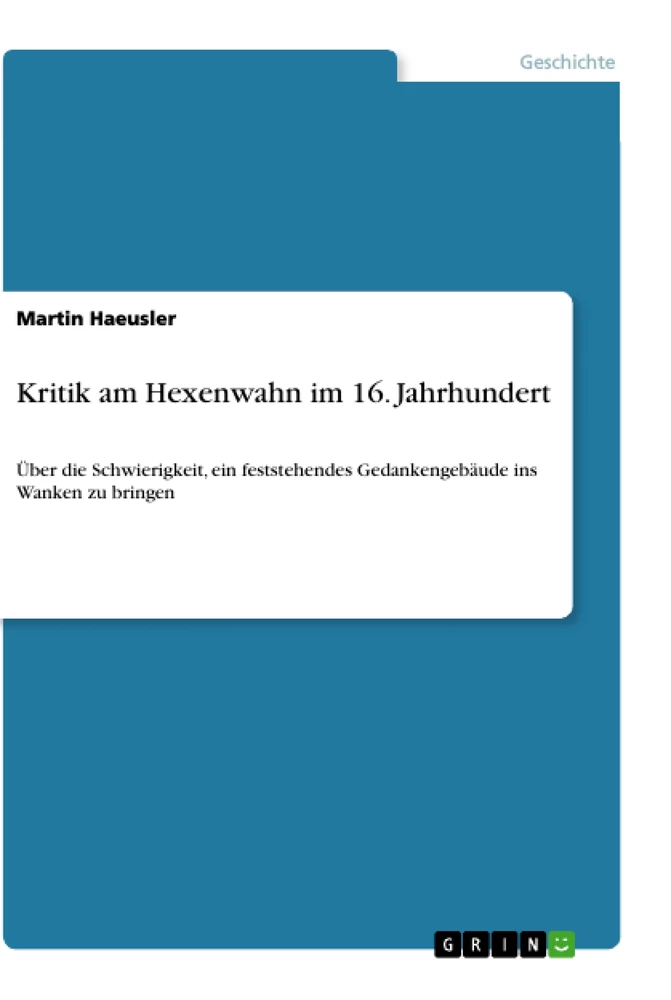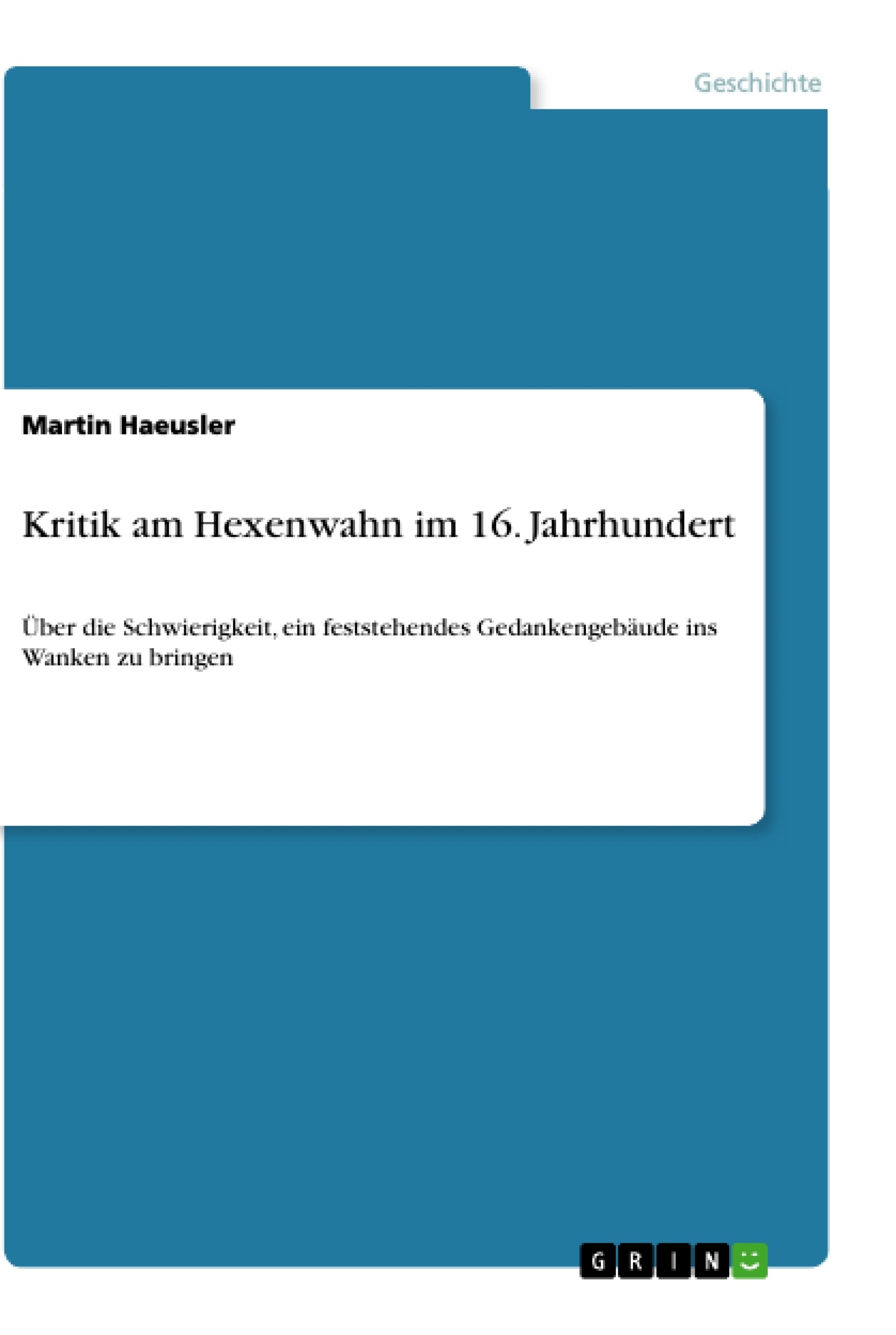Die Arbeit befasst sich mit den Schwierigkeiten, auf die Autoren der frühen Neuzeit gestoßen sind, die sich von unterschiedlichen Ansätzen aus kritisch mit dem Hexenwahn befasst haben. Es wird gezeigt, dass die Vorstellung, das "dunkle Mittelalter" sei von Aufklärern überwunden worden, viel zu einfach und schematisch ist. Tatsächlich sind die Wege, auf denen sich die Kritik am Hexenwahn dann schließlich Bahn gebrochen hat, recht verschlungen gewesen.
Im Mittelalter sind von der katholischen Inquisition Millionen Frauen als Hexen verbrannt worden. Diese und ähnliche Behauptungen kann man immer wieder hören, obwohl an dem Satz so gut wie alles schief, wenn nicht falsch ist. Dazu vier Bemerkungen:
Erstens halten die teils abenteuerlichen Opferzahlen – manche sprechen gar von neun Millionen – einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Tatsächlich dürfte die richtige Zahl eher bei 60.000 als bei 100.000 Opfern liegen.
Zweitens sind nicht nur Frauen angeklagt und hingerichtet worden. Neuere sorgfältige Auswertungen der erhalten Akten haben gezeigt, dass jeder vierte Angeklagte männlichen Geschlechts gewesen ist, örtlich sogar ein Drittel. Erstaunlicherweise sind in protestantischen Gegenden prozentual mehr Frauen hingerichtet worden und weniger Männer.
Drittens: Irrig ist auch die immer wieder zu findende Auffassung, die katholische Kirche und vor allem die Inquisition habe eine führende Rolle bei der Hexenverfolgung gespielt. Dem ist entgegenzuhalten, dass aus Spanien, dem Kernland der katholischen Inquisition, nur etwa 30 Tötungen von Hexen zu beklagen sind, im katholischen Irland waren es zwei, in Portugal sieben – auch das katholische Italien liegt bei der Zahl der Opfer etwa gleichauf mit dem protestantischen Dänemark, obwohl die Bevölkerungszahl Dänemarks damals nur etwa 7% der Italiens betragen hat.
Viertens: Die Verfolgung und Hinrichtung von Menschen als Hexen war keineswegs ein mittelalterliches Phänomen. Der Schwerpunkt wird also darauf liegen zu zeigen, wie sich die Diskussion in kleinen Schritten langsam weiterbewegt hat, nicht in einem gradlinigen Prozess, sondern eher in Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärts-Schrittchen.
Inhaltsverzeichnis
- Zauber, Gegenzauber
- Ein Magier verteidigt Hexen: Agrippa von Nettesheim
- Zwischen Bibel und praktischer Vernunft: Johannes Weyer
- Die Realität des Hexenfluges: De Spina, Molitor, Ponginibbi, Grillando, Alciato, Vignati….........
- Planetengeister statt Teufel: Paracelsus
- Melancholie: Hexerei als psychiatrisches Phänomen
- Nichts als albernes Zeugs: Antonio de Ferrariis
- Ein Aufklärer als Hexenjäger: Jean Bodin
- Ein Inquisitor als Aufklärer: Alonso de Salazar y Frías
- Hexen gibt es nicht - aber Strafe muss sein: Thomas Hobbes
- Ausblick: Weise Frauen, scharfe Orgien und „rassereine“ Germaninnen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Kritik am Hexenwahn im 16. Jahrhundert“ untersucht die Debatte um den Hexenwahn im 16. Jahrhundert und analysiert die unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Phänomen. Die Autorin beleuchtet dabei die Schwierigkeiten, die mit der Infragestellung etablierter Denkgebäude verbunden sind, und zeigt auf, wie verschiedene Denker und Persönlichkeiten der damaligen Zeit versuchten, den Hexenwahn zu erklären, zu widerlegen oder zu rechtfertigen.
- Die Entwicklung des Hexenwahns im 16. Jahrhundert
- Die Rolle von Magie und Gegenzauber in der Gesellschaft
- Die Auseinandersetzung mit der Bibel und der praktischen Vernunft
- Die verschiedenen Perspektiven auf Hexerei: von der Realität des Hexenfluges bis hin zur psychiatrischen Deutung
- Die Verbindung von Hexenwahn und Aufklärungsgedanken
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel „Zauber, Gegenzauber“ stellt die historische und gesellschaftliche Bedeutung von Magie und Gegenzauber im 16. Jahrhundert dar. Es untersucht, wie diese Praktiken in der damaligen Zeit wahrgenommen wurden und welche Rolle sie in der Alltagskultur spielten.
- Im Kapitel „Ein Magier verteidigt Hexen: Agrippa von Nettesheim“ wird die Position des Renaissance-Gelehrten Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim vorgestellt, der sich gegen den Hexenwahn und die Verfolgung von Hexen einsetzte. Es werden seine Argumente und seine Kritik an den damaligen Hexenprozessen beleuchtet.
- Das Kapitel „Zwischen Bibel und praktischer Vernunft: Johannes Weyer“ beschäftigt sich mit dem deutschen Arzt Johannes Weyer, der ebenfalls ein entschiedener Gegner des Hexenwahns war. Es analysiert seine medizinische Sichtweise auf Hexerei und seine kritische Auseinandersetzung mit der Bibelinterpretation, die den Hexenwahn beförderte.
- Das Kapitel „Die Realität des Hexenfluges: De Spina, Molitor, Ponginibbi, Grillando, Alciato, Vignati….........“ befasst sich mit der Sichtweise derjenigen, die an der Realität des Hexenfluges glaubten. Es werden die Argumente von verschiedenen Autoren aus dieser Zeit vorgestellt, die die Existenz von Hexen und ihre bösen Machenschaften bezeugten.
- Im Kapitel „Planetengeister statt Teufel: Paracelsus“ wird die Theorie des Schweizer Arztes Paracelsus vorgestellt, der Hexerei als eine Form der Magie sah, die von Planetenwesen beeinflusst wurde. Es wird die Verbindung seiner Theorien zum Hexenwahn und zu den damaligen magischen Praktiken untersucht.
- Das Kapitel „Melancholie: Hexerei als psychiatrisches Phänomen“ betrachtet Hexerei aus einer psychiatrischen Perspektive. Es werden die Theorien von Autoren vorgestellt, die Hexerei als ein psychisches Phänomen, wie beispielsweise Melancholie, interpretierten. Dieses Kapitel beleuchtet die Anfänge der wissenschaftlichen Betrachtung von Hexerei.
- Das Kapitel „Nichts als albernes Zeugs: Antonio de Ferrariis“ beschäftigt sich mit der Sichtweise des italienischen Arztes Antonio de Ferrariis, der den Hexenwahn als eine Form des Aberglaubens und der Unwissenheit verurteilte. Es werden seine Argumente gegen die Hexenprozesse und seine kritische Haltung gegenüber der damaligen Zeit beleuchtet.
- Das Kapitel „Ein Aufklärer als Hexenjäger: Jean Bodin“ analysiert die Position des französischen Juristen und Politiktheoretikers Jean Bodin, der sich trotz seiner aufklärerischen Tendenzen für die Verfolgung von Hexen einsetzte. Es werden seine Argumente und seine Begründung für die Hexenprozesse untersucht.
- Das Kapitel „Ein Inquisitor als Aufklärer: Alonso de Salazar y Frías“ beleuchtet die Geschichte des spanischen Inquisitors Alonso de Salazar y Frías, der sich kritisch mit den Hexenprozessen auseinandersetzte und sich für eine gerechtere und menschenwürdigere Verfahrensweise einsetzte. Es wird seine Rolle als Aufklärer innerhalb der Inquisition und seine Erkenntnisse über die Hexenprozesse dargestellt.
- Das Kapitel „Hexen gibt es nicht - aber Strafe muss sein: Thomas Hobbes“ beschäftigt sich mit der Position des englischen Philosophen Thomas Hobbes, der zwar die Existenz von Hexen bezweifelte, aber gleichzeitig die Verfolgung von „Hexen“ als notwendig erachtete, um die öffentliche Ordnung zu schützen. Es werden seine Argumente und seine justizphilosophische Sichtweise auf den Hexenwahn vorgestellt.
Schlüsselwörter
Hexenwahn, Magie, Gegenzauber, Hexenprozesse, Renaissance, Reformation, Aufklärungsgedanken, Bibel, praktische Vernunft, Melancholie, Psychiatrie, Aberglaube, Inquisition, Justizphilosophie
Häufig gestellte Fragen
War die Hexenverfolgung ein rein mittelalterliches Phänomen?
Nein, der Schwerpunkt der Hexenverfolgung lag in der frühen Neuzeit, insbesondere im 16. Jahrhundert, und nicht im Mittelalter.
Wie hoch war die Zahl der Opfer tatsächlich?
Wissenschaftliche Überprüfungen schätzen die Zahl der Opfer eher auf 60.000 bis 100.000, statt der oft behaupteten Millionen.
Wurden nur Frauen als Hexen hingerichtet?
Nein, etwa jeder vierte Angeklagte war männlich, in manchen Regionen sogar bis zu ein Drittel.
Wer war Johannes Weyer?
Ein deutscher Arzt, der Hexerei als psychiatrisches Phänomen (Melancholie) deutete und sich gegen die Verfolgungen einsetzte.
Welche Rolle spielte die Inquisition?
Entgegen der landläufigen Meinung war die Zahl der Hinrichtungen in Ländern mit starker Inquisition (wie Spanien oder Portugal) extrem gering.
- Citation du texte
- Dr. Martin Haeusler (Auteur), 2021, Kritik am Hexenwahn im 16. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027375