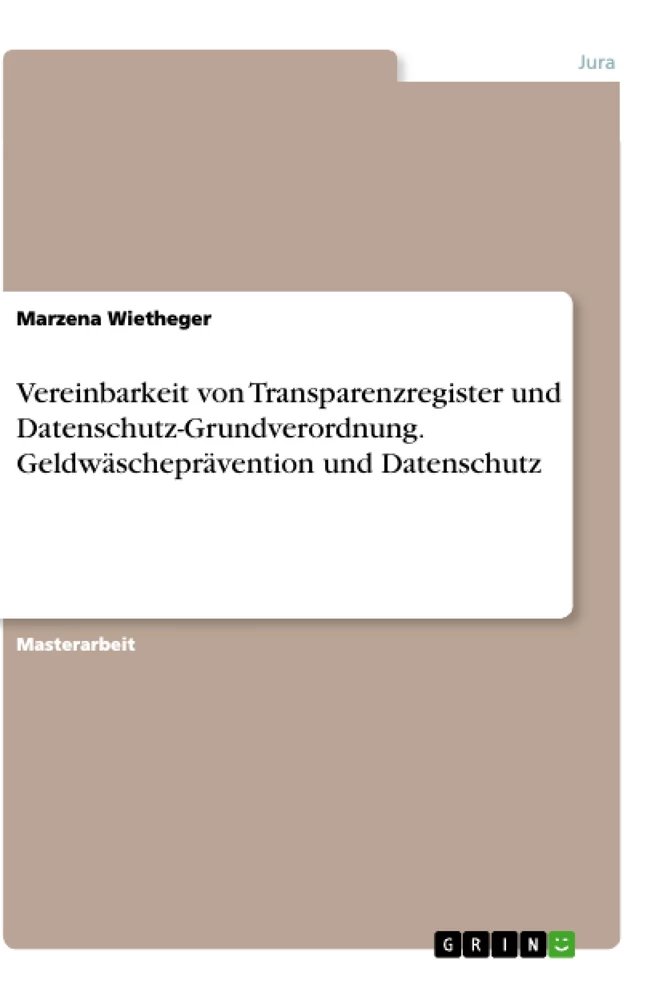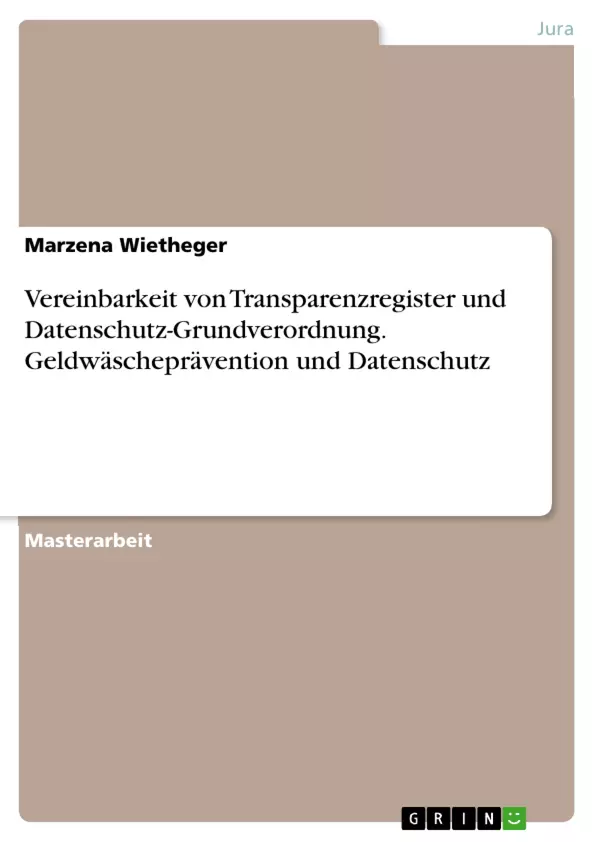Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Transparenzregister. Insbesondere wird der von der Datenverarbeitung des Transparenzregisters betroffene wirtschaftlich Berechtigte näher definiert. Zudem werden die im Zusammenhang mit dem Transparenzregister bestehenden Transparenzpflichten sowie Sanktionen bei Pflichtverletzungen dargestellt; ferner die Funktionsweise des Transparenzregisters und die durch die Fünfte Geldwäscherichtlinie erfolgte Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten erläutert.
Außerdem zeigt die Arbeit auf, wann der Anwendungsbereich der DSGVO eröffnet ist und nimmt Bezug auf die der Datenverarbeitung zugrunde liegenden Verarbeitungsgrundsätze sowie die Betroffenenrechte. Anschließend wird dargestellt, wie tief das Transparenzregister in die von der DSGVO geschützten Rechte natürlicher Personen eingreift und analysiert, ob ein entsprechender Eingriff gerechtfertigt ist. Zu diesem Themenbereich wird eine umfangreiche
Literaturrecherche durchgeführt.
Zuletzt werden die Ergebnisse kritisch betrachtet und reflektiert und es soll festgestellt werden, ob das Transparenzregister eine ausgewogene Balance zwischen den Bemühungen um mehr Transparenz sowie den schutzwürdigen Interessen des Einzelnen herstellen kann. .
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung und Zielsetzung
- Aufbau
- Motivation
- Transparenzregister
- Hintergrund
- „Wirtschaftlich Berechtigter“ als zentraler Begriff
- Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
- Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
- Vereinigungen
- Rechtsgestaltungen
- Transparenzpflichten
- Pflichten der Vereinigungen
- Einholen
- Aufbewahren
- Aktualisieren
- Mitteilen
- Pflichten der Anteilseigner
- Pflichten bestimmter Rechtsgestaltungen
- Fiktionswirkung
- Sanktionen bei einer Pflichtverletzung
- Bußgeldkatalog
- Naming & Shaming-Verfahren
- Funktionsweise des Registers
- Registrierung
- Antrag auf Einsichtnahme
- Protokollierung der Einsichtnahme
- Einsichtsberechtigung
- Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten
- Beschränkung der Einsichtnahme
- Datenschutzgrund-Verordnung
- Räumlicher Anwendungsbereich
- Niederlassungsprinzip
- Marktortprinzip
- Erstreckung aufgrund Völkerrechts
- Sachlicher Anwendungsbereich
- Personenbezogene Daten
- Identifikation
- Abgrenzung zu Sachdaten
- Verarbeitung
- Grundsätze der Verarbeitung
- Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz
- Rechtmäßigkeit
- Treu und Glauben
- Transparenz
- Zweckbindung
- Datenminimierung
- Richtigkeit
- Speicherbegrenzung
- Integrität und Vertraulichkeit
- Rechenschaftspflicht
- Betroffenenrechte
- Vereinbarkeit von Transparenzregister und DSGVO
- Eingriff in datenschützende Grundrechte
- Gesetzesvorbehalt
- Achtung des Wesensgehalts
- Gemeinwohl
- Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
- Geeignetheit
- Erforderlichkeit
- Mildestes Mittel
- Schutz der personenbezogenen Daten
- Zweckbindungsgrundsatz
- Erweiterung des Nutzerkreises
- Speicherbegrenzung
- Recht auf Einschränkung
- Widerspruchsrecht
- Angemessene Sicherheit
- Kritische Betrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Master-Thesis untersucht die Vereinbarkeit von Geldwäscheprävention durch Transparenzregister und den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ziel ist es, die potenziellen Konflikte zwischen den Anforderungen an Transparenz und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen aufzuzeigen und Lösungsansätze zu diskutieren.
- Analyse des Transparenzregisters und seiner Funktionsweise
- Detaillierte Betrachtung der DSGVO und ihrer relevanten Bestimmungen
- Untersuchung der rechtlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung im Kontext des Transparenzregisters
- Bewertung der Vereinbarkeit von Transparenz und Datenschutz
- Diskussion von Lösungsansätzen zur Minimierung von Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Geldwäscheprävention und des Datenschutzes ein. Sie beschreibt die Problemstellung, die sich aus der Notwendigkeit von Transparenz einerseits und dem Schutz personenbezogener Daten andererseits ergibt. Der Aufbau der Arbeit und die Motivation des Autors werden ebenfalls erläutert. Die Einleitung legt den Fokus auf den Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Transparenz zur Bekämpfung der Geldwäsche und dem Recht auf Datenschutz, das durch die DSGVO garantiert wird.
Transparenzregister: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Transparenzregister, seine rechtlichen Grundlagen und seine Funktionsweise. Es definiert den zentralen Begriff des "wirtschaftlich Berechtigten" und erläutert die damit verbundenen Transparenzpflichten für verschiedene Akteure wie Vereine und Anteilseigner. Besonders relevant sind die Ausführungen zu den Sanktionen bei Pflichtverletzungen, inklusive Bußgeldkatalog und Naming & Shaming-Verfahren. Das Kapitel analysiert somit die Mechanismen zur Durchsetzung der Transparenzpflichten.
Datenschutzgrund-Verordnung: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Es behandelt den räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich, die Grundsätze der Datenverarbeitung (Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung etc.) und die Betroffenenrechte. Die detaillierte Erläuterung der DSGVO-Bestimmungen bildet die Grundlage für den Vergleich mit den Anforderungen des Transparenzregisters im folgenden Kapitel.
Vereinbarkeit von Transparenzregister und DSGVO: In diesem zentralen Kapitel werden die Anforderungen des Transparenzregisters und der DSGVO miteinander verglichen und auf potenzielle Konflikte untersucht. Es analysiert, inwieweit das Transparenzregister in datenschutzrechtliche Grundrechte eingreift und welche Kriterien (Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit, Erforderlichkeit, mildestes Mittel) für eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllt sein müssen. Das Kapitel beleuchtet verschiedene Aspekte des Datenschutzes, die im Kontext des Transparenzregisters eine besondere Rolle spielen, wie Zweckbindung, Nutzerkreis und Speicherbegrenzung.
Schlüsselwörter
Geldwäscheprävention, Datenschutz, Transparenzregister, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), wirtschaftlich Berechtigter, Transparenzpflichten, Datenverarbeitung, personenbezogene Daten, Verhältnismäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Konfliktlösung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Vereinbarkeit von Transparenzregister und DSGVO
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Vereinbarkeit der Geldwäscheprävention durch Transparenzregister mit den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sie analysiert potenzielle Konflikte zwischen Transparenzanforderungen und Datenschutzbestimmungen und diskutiert Lösungsansätze.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse des Transparenzregisters und seiner Funktionsweise, detaillierte Betrachtung der DSGVO und ihrer relevanten Bestimmungen, Untersuchung der rechtlichen Anforderungen an die Datenverarbeitung im Kontext des Transparenzregisters, Bewertung der Vereinbarkeit von Transparenz und Datenschutz sowie Diskussion von Lösungsansätzen zur Konfliktminimierung.
Was ist das Transparenzregister und wie funktioniert es?
Das Transparenzregister ist ein zentrales Register, das Informationen über wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen und Vereinigungen enthält. Die Arbeit beschreibt detailliert seine rechtlichen Grundlagen, Funktionsweise, die Pflichten der Akteure (z.B. Vereine, Anteilseigner) und die Sanktionen bei Pflichtverletzungen (Bußgeldkatalog, Naming & Shaming).
Was ist der "wirtschaftlich Berechtigte"?
Der "wirtschaftlich Berechtigte" ist ein zentraler Begriff im Kontext des Transparenzregisters. Die Arbeit definiert diesen Begriff und erläutert, wie er in verschiedenen Rechtsgestaltungen und Vereinigungen bestimmt wird.
Welche Rolle spielt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)?
Die DSGVO ist die zentrale europäische Datenschutzverordnung. Die Arbeit beschreibt ihren räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich, die Grundsätze der Datenverarbeitung (Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung etc.) und die Betroffenenrechte. Sie bildet die Grundlage für den Vergleich mit den Anforderungen des Transparenzregisters.
Welche Konflikte gibt es zwischen Transparenzregister und DSGVO?
Die Arbeit untersucht potenzielle Konflikte zwischen den Anforderungen des Transparenzregisters und der DSGVO, insbesondere den Eingriff in datenschutzrechtliche Grundrechte. Sie analysiert die Kriterien für eine rechtmäßige Datenverarbeitung (Verhältnismäßigkeit, Geeignetheit, Erforderlichkeit, mildestes Mittel) im Kontext des Transparenzregisters.
Wie können Konflikte zwischen Transparenz und Datenschutz minimiert werden?
Die Arbeit diskutiert Lösungsansätze zur Minimierung von Konflikten zwischen Transparenz und Datenschutz. Dies beinhaltet Aspekte wie Zweckbindung, Erweiterung des Nutzerkreises, Speicherbegrenzung (Recht auf Einschränkung, Widerspruchsrecht) und angemessene Sicherheit der Daten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geldwäscheprävention, Datenschutz, Transparenzregister, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), wirtschaftlich Berechtigte, Transparenzpflichten, Datenverarbeitung, personenbezogene Daten, Verhältnismäßigkeit, Rechtmäßigkeit, Konfliktlösung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Transparenzregister, ein Kapitel zur DSGVO, ein Kapitel zur Vereinbarkeit beider und eine kritische Betrachtung. Jedes Kapitel wird in der Arbeit detailliert zusammengefasst.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Sie einen Link zu einem Repository oder der vollständigen Arbeit einfügen, falls verfügbar)
- Citation du texte
- Marzena Wietheger (Auteur), 2020, Vereinbarkeit von Transparenzregister und Datenschutz-Grundverordnung. Geldwäscheprävention und Datenschutz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1027611