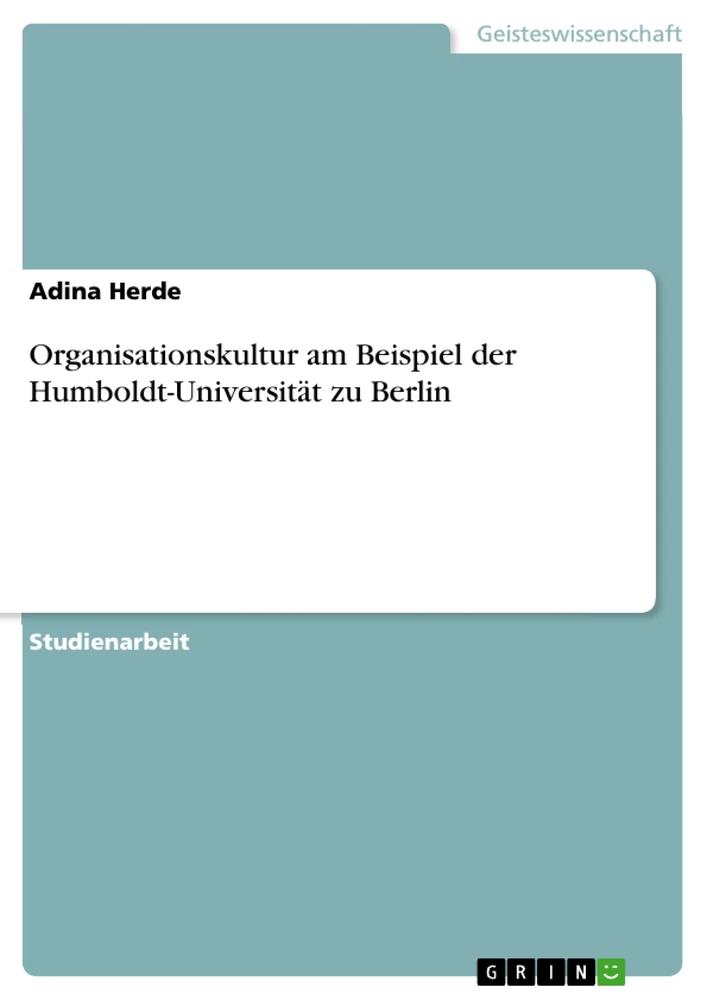Inhaltsverzeichnis
Theoretischer Teil
1. Elemente der Organisationskulturforschung
1.1 Begriffe: Organisation, Kultur, Organisationskultur
1.2 Organisationskultur als Variable oder als Metapher?
1.3 Starke und schwache Kulturen
1.4 Wirkungen von Organisationskulturen
1.5 Kulturwandel in Organisationen
2. Gründe für die Hinwendung zum Konzept der Organisationskultur
3. Organisationskultur als Paradigmenwechsel in der Organisationssoziologie
4. Folgen
4.1 für die Wissenschaft
4.2 für die Praxis
5. Kritik am Konzept der Organisationskultur
Empirischer Teil
6. Ein Beispiel: Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
6.1 Organisationskultur der HU
6.2 Gründe für das Interesse an der Organisationskultur der HU
6.3 Paradigmenwechsel am Beispiel der HU
6.4 Folgen für die HU
6.5 Probleme bei der Bestimmung der Organisationskultur der HU
Literaturverzeichnis
Theoretischer Teil
1. Elemente der Organisationskulturforschung
1.1 Begriffe: Organisation, Kultur, Organisationskultur
Beim Begriff der Organisationskultur handelt es sich um einen sehr abstrakten Terminus, das läßt sich vorab schon einmal sagen, und deshalb fällt eine klare Definition schwer. „Auch dem flüchtigen Beobachter der Organisationskulturforschung fällt die allgemein herrschende, sprachliche Verwirrung auf, die in dieser Forschungsdisziplin herrscht“ (Kaschube 1993:90), daher bietet es sich an, den Begriff zunächst nicht als solchen zu klären, sondern ihn in einem ersten Schritt in seine Bestandteile zu zergliedern: in den Begriff der Organisation und der Kultur.
Eine Organisation zeichnet sich aus durch
- die Offenheit des Systems gegenüber der Umwelt
- die Existenz über einen längeren Zeitraum
- die Verfolgung spezifischer Ziele
- die Existenz als soziales System (Individuen oder Gruppen)
- die Struktur, als deren häufige Merkmale Arbeitsteilung und Verantwortungshierarchie gelten (Kaschube 1993:93).
An dieser Stelle sollte erwähnt werden, daß dem Begriff der Organisation gegenüber dem Begriff des Unternehmens der Vorrang gegeben wird, weil die Begrenzung auf „Unterneh- men“ in Sinne der Definition als „industrielle Organisation“ zu eng erscheint.
Was unter Kultur verstanden werden kann, läßt sich nicht problemlos umschreiben. Nach Kroeber und Kluckhohn kann man zwischen ca. 170 Kulturdefinitionen unterscheiden. Es gibt allerdings einen kleinsten gemeinsamen Nenner in dieser Fülle von Definitionen. Demnach ist Kultur
- ein spezifisches Denkmuster einer Gruppe von Menschen, das gemeinsame Orientierun- gen und Werte in dieser Gruppe vorgibt
- „selbstverständlich“, d.h. sie wird in der Regel nicht reflektiert
- ein dynamischer und variabler Prozeß
- das Ergebnis eines Lern- und Sozialisationsprozesses.
Anknüpfend an die Begriffe der Organisation und der Kultur kann auf die Grundzüge der Organisationskultur geschlossen werden.
Organisationskultur zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- sie ist ein implizites Phänomen, das die Selbstinterpretation einer Organisation prägt
- sie ist „selbstverständlich“
- sie bezieht sich auf gemeinsame Orientierungen und Werte, macht so das organisatorische Handeln einheitlich
- sie ergibt sich aus einen Lernprozeß im Umgang mit den Bedingungen inner- und außer- halb der Organisation
- sie vermittelt Orientierung in einer komplexen Welt und vereinheitlicht so deren Interpre-tation
- sie ist das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses, der dazu führt, aus einer kulturellen Tradition heraus zu handeln, was bedeutet, daß sie nicht bewußt gelernt wird (Rosenstiel 1993:15).
Ein verbreitetes Modell der Organisationskultur ist das Drei-Ebenen-Modell von Edgar H. Schein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(in Anlehnung an Schein 1995:30, Schreyögg 1995:113f., Gussmann & Breit 1987:109)
Unter Basisannahmen können Überzeugungs- und Vorstellungsmuster verstanden werden, die das Fundament einer Organisationskultur bilden und die den Organisationsmitgliedern nicht bewußt sind. Sie fügen sich zu einer Art „Weltbild“ der Organisation zusammen.
Grundlegend sind dabei die Auffassungen über
- die Umwelt: Wird die Umwelt beispielsweise als Bedrohung oder als Herausforderung angesehen?
- die Wahrheit: Wird eine Entscheidung aufgrund von normativen (Autorität, Wissenschaft) oder von pragmatischen Beweggründen getroffen?
- die Natur des Menschen: Sind Menschen z.B. eher arbeitsscheu oder haben sie Freude an der Arbeit?
- menschliches Handeln: Sind Menschen eher aktiv oder eher passiv? Gehen sie die Dinge selbst an oder warten sie ab?
- zwischenmenschliche Beziehungen: Wird auf den Status einer Person Wert gelegt? Über- wiegt Wettbewerb oder Kooperation? (Schreyögg 1995:114)
Aus den Basisannahmen einer Organisation ergeben sich bestimmte Werte und Normen, die teils sichtbar, teils unbewußt sind. Unter Werten können Maßstäbe oder Standards verstanden werden, die Handlungsorientierungen vorgeben. Normen sind Regeln und Vorschriften für Handlungen. Werte und Normen schränken die persönliche Handlungsfreiheit ein, bieten je- doch Orientierung, indem sie die Umweltkomplexität verringern. Der Unterschied zwischen beiden Begriffen ist, daß sich Werte auf einem höheren Abstraktionsniveau befinden, sie sehr stabil sind und einen wesentlich geringeren Zwangcharakter als Normen aufweisen (Jacobsen 1996:37).
Die Werte und Normen manifestieren sich in Symbolen. Sie unterscheiden sich nach Abstraktionsgrad, Inhalt und Ziel ihrer Wirkungsrichtung. Einerseits gibt es primär instrumentelle Symbole wie materielle Vergütungen, Produkte oder Organigramme, die auf rationale, „logische“ Aspekte organisationalen Handelns gerichtet sind. Daher sind sie leicht verständlich - allerdings immer im Zusammenhang mit den zugrundeliegenden Wertvorstellungen. Andererseits gibt es expressive Symbole wie Mythen, Zeremonien oder Ehrenbezeigungen, die auf emotionale Aspekte gerichtet sind und deshalb einer Interpretation bedürfen. Dazwischen existiert ein Kontinuum möglicher Symbole (Gussmann & Breit 1987:110f.).
Sathe unterscheidet dagegen vier Formen der Manifestation von Kultur :
- Objekte (shared things, z.B. einheitliche Kleidung, Logos, Gebäude)
- Sprache (shared sayings, z.B. Geschichten, Anekdoten, Legenden, Witze, Sprüche)
- Verhalten (shared doings, z.B. Routinen, Bräuche, Riten, Feiern, Zeremonien)
- Gefühle (shared feelings, z.B. Sicherheit, Gleichbehandlung, Überschaubarkeit, Sachlich-keit, Stolz) (Staehle 1990:480).
Diese strikte Kategorisierung kann allerdings in einigen Fällen problematisch sein, da z.B. „Gründungsväter“ oder „Helden“ als Manifestation einer Organisationskultur keiner der vier Typen zugeordnet werden können und bestimmte Verhaltensweisen wie Riten und Zeremo- nien vor allem praktiziert werden, um Gefühle (Zusammengehörigkeit, Stolz usw.) hervorzu- rufen.
1.2 Organisationskultur als Variable oder als Metapher?
Seit ihren Anfängen beschäftigt sich die Organisationskulturforschung mit der Frage, ob eine Organisation nun eine Kultur hat oder ob sie eine ist.
Die Vertreter des in den USA dominierenden Variablen-Ansatzes gehen davon aus, daß eine Organisation eine Kultur hat. Sie ist eine Variable neben vielen anderen Elementen, z.B. ne- ben der Technologie und der Planung. Im Mittelpunkt stehen das Wertsystem der Organisa- tionskultur und die Frage, wie dieses in Erinnerung gehalten werden kann. Die Anwort darauf ist das „symbolische Management“, zu dessen Aufgaben der planmäßige Aufbau einer einzig- artigen Symbolwelt und die Schaffung einer spezifischen Kultur gehören. Die Symbolträger sind die Manager, die die Werte und Normen der Organisation vorleben. Die Kultur wird durch Rituale und Zeremonien vermittelt. Der Variablen-Ansatz ist ergebnisorientiert: das Ziel ist der Aufbau einer gewünschten Organisationskultur. Da die Organisationskultur eine Variable unter vielen ist, kann ihre Analyse mittels standardisierter Methoden, d.h. mit Hilfe der quantitativen empirischen Sozialforschung, erfolgen.
Die Befürworter des in der BRD vorherrschenden Metaphern-Ansatzes vertreten dagegen die Position, daß ein Organisation selbst eine Kultur ist. Alles, was in einer Organisation beob- achtbar ist, wird zum Ausdruck bestimmter Werte und Normen. Kultur fungiert als Ideensy- stem, ist konkret nicht faßbar und nicht beobachtbar. Sie kann von Managern nicht einfach vorgegeben werden, vielmehr ist sie das Ergebnis von Deutungs-, Interpretations- und Aus- handlungsprozessen. Organisationskultur existiert jedoch nicht in einem Machtvakuum, wes- halb Deutungen von Mitarbeitern, die in der Hierarchie höher stehen, meist einen größeren Einfluß auf die Gestaltung der Organisationskultur haben als die Interpretationen von Mitar- beitern mit einem niedrigeren Rang. Da Organisationskultur nicht systematisch und gezielt veränderbar ist, sondern komplexen sozialen Vorgängen unterliegt, ist der Metaphern-Ansatz prozeßorientiert. Zur Analyse sind qualitative Verfahren der empirischen Sozialforschung geeignet, z.B. die Beobachtung der Akteure, die Befragung der Handelnden, die Analyse von Symbolen und die Partizipation am organisatorischen Prozeß. (siehe Kaschube 1993:103ff., Staehle 1990: 465ff., Jacobsen 1996:61ff., Rosenstiel 1993:16)
Beide Ansätze stellen Extrempositionen dar, eine Synthese des Metaphern- und Variablen- Ansatzes wird u.a. von Schein vertreten. Danach kann Organisationskultur als dynamisches Konstrukt verstanden werden. Organisationen sind und haben Kultur. Der Ansatz erklärt die Entstehung von Organisationskultur als Interpretation ihrer Organisationsmitglieder (Meta- phern-Ansatz), räumt aber auch ein, daß Kultur durch gezieltes Einbringen von Interpretationen gestaltet werden kann (Variablen-Ansatz) (Kaschube 1993:107).
1.3 Starke und schwache Kulturen
In der Organisationskulturforschung geht es in erster Linie darum, Kultur als Erfolgsfaktor einer Organisation zu analysieren und zu untersuchen, wie bestimmte Kulturen das organisatorische Handeln so beeinflussen, daß herausragende Organisationsleistungen erbracht werden. Dieser Effekt wird insbesondere bei starken Kulturen vermutet (Schreyögg 1991:540f.). Um starke Organisationskulturen von schwachen unterscheiden zu können, hat Schreyögg (1991) drei Dimensionen aufgestellt, und zwar
- die Prägnanz
- den Verbreitungsgrad
- die Verankerungstiefe (Schreyögg 1991:543).
Unter der Prägnanz einer Organisationskultur versteht man die Klarheit der Orientierungsund Wertmuster innerhalb einer Organisation. Starke Kulturen zeichnen sich durch relativ stabile, universelle, für viele Situationen geltende Werte aus. Ziel der Organisationskulturforschung ist nicht die Bewertung des jeweiligen Wertsystems, die Gegenstand der Unternehmensethik ist. Der Organisationskulturansatz versteht sich als wertfrei, wichtig ist nur, inwieweit das betreffende Wertsystem zum Erfolg der Organisation beiträgt.
Der Verbreitungsgrad untersucht die Konformität der in der Organisation herrschenden Werte und Normen. Stimmen die Werte und Normen innerhalb der Organisation weitgehend über- ein, handelt es sich um eine starke Kultur. Sind sie dagegen vielfältig und existieren in der Organisation mehrere Subkulturen, kann man nur von einer schwachen Kultur sprechen. Die Verankerungstiefe ist das Maß für die Übereinstimmung der Werte und Normen, die von der Organisation vertreten werden, und den Wertvorstellungen des einzelnen Organisations- mitgliedes.
Es kann zwischen vier Formen der Identifikation unterschieden werden:
- die natürliche Identifikation: hier stimmen die Werte der Organisation und des Individu-ums von Anfang an überein
- die selektive Identifikation: der Bewerber tritt nur dann in die Organisation ein, wenn die Werte mit denen der Organisation übereinstimmen
- die hervorgerufene Identifikation: zum Anfang stimmen die Werte der Organisation und des Individuums nicht überein, aber es erfolgt eine schrittweise Sozialisation des Indivi- duums in der Organisation, bis das Individuum die Werte der Organisation internalisiert hat
- die kalkulierte Identifikation: die Werte stimmen nicht überein, obwohl durch das oppor-tunistische Verhalten des Individuums der Anschein erweckt wird; das scheinbar kulturkonforme Verhalten des Individuums ist nur das Ergebnis einer kalkulierten Anpassung (Meiler 1998:29).
Je kleiner eine Organisation ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Wertvorstellungen der Organisation und des Individuums übereinstimmen und daß sich eine starke Organisationskultur herausbilden kann (Meiler 1998: 21).
In größeren Organisationen können Subkulturen entstehen, denen verschiedene kulturelle Orientierungsmuster eigen sind. Sie spielen eine große Rolle, wenn es um die Ausprägung einer starken oder schwachen (Gesamt-)Organisationskultur geht. Es kann zu Widersprüchen zwischen verschiedenen hierarchischen Ebenen (Arbeiterkultur, Angestelltenkultur, Mana- gerkultur) oder zwischen unterschiedlichen Funktionsbereichen (Abteilungen) kommen. Die Kultur der jeweiligen Organisation zeichnet sich dann nicht durch gemeinsame Wert- und Orientierungsmuster aus, sondern durch die spezifische Mischung von Subkulturen (Schreyögg 1991:543). Von einer starken Organisationskultur kann man demnach nicht spre- chen.
1.4 Wirkungen von Organisationskulturen
Schreyögg (1991) weist darauf hin, daß sich die Ausführungen über Wirkungen von Organisationskulturen in erster Linie auf starke Kulturen beziehen, die nicht über Subkulturen verfügen. Hierbei kann zwischen positiven und negativen Effekten unterschieden werden. Positive Wirkungen entstehen, wenn die Funktionen von Organisationskulturen tatsächlich in die Realität umgesetzt werden können.
Zu den originären Funktionen der Organisationskultur gehören:
- die Integrationsfunktion: Kultur dient allen Organisationsmitgliedern als Basiskonsens über Grundfragen und erleichtert damit auch in Konfliktsituationen die Konsensfindung. Durch die Vorgabe bestimmter Handlungsorientierungen reduziert sie die Komplexität der Umwelt, vermittelt ein klares „Weltbild“ und macht die Umwelt für das einzelne Organisationsmitglied verständlich und überschaubar. Kultur wirkt demnach sozial integrativ.
- die Koordinationsfunktion: Durch Kultur gelingt die Abstimmung von Einzeltätigkeiten in der Organisation. Von allen Organisationsmitgliedern akzeptierte Werte und Normen ge- ben eine gemeinsame Orientierung vor. So können unterschiedliche Handlungen koordi- niert werden. Positive Effekte sind eine reibungslose Kommunikation, eine rasche Ent- scheidungsfindung und eine zügige Implementation von Plänen, Projekten und Program- men. Durch die Verinnerlichung von Orientierungsmustern ist zudem nur ein geringer Kontrollaufwand nötig.
- die Motivationsfunktion: Kultur vermittelt Sinn und befriedigt so ein zentrales Bedürfnis der Organisationsmitglieder. Die Orientierung an gemeinsamen kulturellen Mustern und die gegenseitige Verpflichtung auf zentrale Werte der Organisation führen zu einer hohen Bereitschaft, sich für die Organisation zu engagieren („intrinsische Motivation“) und das nach außen hin auch nachdrücklich zu bekunden. Kultur fördert demzufolge nach innen die Motivation und nach außen die Legitimation der Organisation.
- die Identifikationsfunktion: Kultur kann die Mitglieder einer Organisation dazu bewegen, ihre eigenen Wertvorstellungen in denen der Organisation wiederzuerkennen. So wird ein Wir-Gefühl hervorgerufen, das Selbstbewußtsein gestärkt und der Zusammenhalt in der Organisation gefestigt.
Als derivate Funktion der Organisation wäre die Effizienz- und Effektivitätssteigerung zu nennen, die aus den originären Funktionen abgeleitet werden kann und die in den meisten Fällen das eigentliche Ziel der Organisationsführung darstellt. Sind die originären Funktionen der Organisationskultur sehr ausgeprägt, besteht für die Organisationsmitglieder wenig Neigung, ein solches kohärentes System zu verlassen oder dem Arbeitsplatz fernzubleiben. Die geringe Fluktuations- und Fehlzeitenrate kann zu effizienterer Arbeit und höherer Rentabilität führen (Staehle 1990:480, Schreyögg 1991:545).
Starke Organisationskulturen können jedoch nicht nur positive, sondern auch negative Effekte hervorrufen. Diese laufen alle darauf hinaus, daß starke Organisationskulturen innovative Impulse hemmen und so zu Wettbewerbsnachteilen beitragen können.
Zu den negativen Wirkungen werden gezählt:
- die Tendenz zur Abschließung: Starke Kulturen neigen dazu, Kritik und Warnsignale, die der bestehenden Kultur widersprechen, zu überhören. Veränderungen werden als suspekt angesehen, unangenehme, dem herrschenden Weltbild entgegenstehende Standpunkte werden frühzeitig blockiert oder gar nicht registriert. Es besteht das Risiko zur Bildung von „geschlossenen Systemen“.
- die Fixierung auf traditionelle Erfolgsmuster: Starke Kulturen schaffen eine emotionale Bindung an bestimmte Denk- und Orientierungsmuster, die sich über einen längeren Zeit- raum entwickelt haben und durch Erfolg bestätigt wurden. Zu neuen Vorgangsweisen wurde noch keine gefühlsmäßige Beziehung aufgebaut, daher sind sie schwer durchzuset- zen.
- eine kollektive Vermeidungshaltung: Kritik wird von den Organisationsmitgliedern auf subtile Weise für unzulässig erklärt. Es herrscht eine Art „Kulturdenken“ vor: konträre Meinungen, Bedenken usw. werden zugunsten der kulturellen Werte zurückgestellt.
- strategische Barrieren: Die aufgeführten Effekte bringen das Problem der Starrheit und der mangelnden Anpassungsfähigkeit mit sich. Starken Kulturen mangelt es an Flexibilität. Selbst wenn neue Impulse in den Entscheidungsprozeß Eingang gefunden haben, wird deren vollständige Umsetzung tendenziell durch die starke Organisationskultur gehemmt. Die Sicherheit, die starke Kulturen in hohem Maße bieten, gerät in Gefahr. Folgen sind Angst und Abwehr (Schreyögg 1995:118f.).
Das Streben nach einer starken Organisationskultur erscheint aufgrund dieser Überlegungen „als zweischneidiges Schwert“ (Schreyögg 1991:549).
1.5 Kulturwandel in Organisationen
Die weitreichenden positiven und negativen Wirkungen von Organisationskulturen werfen die Frage auf, ob es möglich ist, die Kultur einer Organisation gezielt zu verändern. Nach Schreyögg (1991) unterliegt der Organisationswandel einem bestimmten Kreislauf:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Schreyögg 1991:549)
Hinsichtlich der Realisierung eines geplanten Wandels von Organisationskulturen gibt es zwei klassische Ansätze:
- Die „Kulturingenieure“ gehen davon aus, daß sich Kultur ähnlich wie andere Führungsin-strumente gezielt einsetzen und planmäßig verändern lassen. Die Organisation kann über symbolisches Management versuchen, den Wandel zu einer neuen Organisationskultur zu initiieren und so die Funktionsweise der Organisation mit dem Ziel der Effizienzverbesserung zu ändern. Der Wandel muß jedoch nicht nur top down (von oben nach unten) erfolgen, sondern kann auch bottom up (von unten nach oben) und from middle both ways (von der Mitte aus) verlaufen (Staehle 1990: 837). Die „Kulturingenieure“ stehen in einer Denktradition mit den Vertretern des Variablen-Ansatzes.
- Die „Kulturalisten“ verstehen Kultur als organisch gewachsene Lebenswelt. Die Organi-sationskultur wandelt sich langsam automatisch, denn Kultur verändert sich ständig. Wandlungsprozesse sind nicht intendiert, zufällig und lange Zeit unbemerkt. Gegen das Konstruieren von Organisationskulturen werden starke normative Bedenken erhoben, dem symbolischen Management wird Manipulation vorgeworfen. Die „Kulturalisten“ folgen dem Metaphern-Ansatz. (Schreyögg 1991:550f., Kaschube 1993:116)
Im Anschluß an Scheins Ansatz, der Organisationskultur als dynamisches Konstrukt versteht, versucht auch die „Kurskorrektur“, die zwei klassischen Ausgangspositionen miteinander zu verbinden. Die Idee des geplanten Wandels wird grundsätzlich akzeptiert. Im Unterschied zu den „Kulturingenieuren“ wird aber davon ausgegangen, daß das Initiieren einer Veränderung in einem offenen Prozeß erfolgt und daß somit auch mit nicht intendierten Folgen gerechnet werden muß. Das Ziel kann niemals ein vollständiger Wandel sein, denn Organisationskultu- ren sind zu komplex, um gezielt gesteuert zu werden. Daher können nur Anstöße zu einer Kurskorrektur angestrebt werden (Schreyögg 1991:551). In Wirklichkeit sind fast alle Organi-sationsmaßnahmen solche der Reorganisation, denn ein vollständiger Organisationswandel ist unrealistisch (Staehle 1990: 547). Zudem handelt es sich dabei um einen evolutionären und somit langfristigen Prozeß (Raab 1989:55).
Der Prozeß der „Kurskorrektur“ kann in einzelne Phasen eingeteilt werden:
- Diagnose: Es erfolgt eine systematische Erfassung der kulturellen Ausdrucksweisen oder der elementaren Orientierungsmuster.
- Beurteilung: Die Wirkungen der Ist-Kultur werden beurteilt. Danach wird ermittelt, in-wieweit die Organisationskultur veränderungsbedürftig ist.
- Maßnahmen: In Absprache mit den beteiligten Organisationsmitgliedern wird eine Kurskorrektur entworfen. Interventionen werden eingeleitet und die Neuorientierung wird bestärkt (Schreyögg 1991:552).
Anders als Schreyögg (1991) unterscheidet Staehle (1990) zwischen
- Macheransatz: Der Organisationswandel erfolgt vollkommen von oben, beispielsweise durch symbolisches Management.
- Gärtneransatz: Bei der Initiierung des Wandels wird langsamer vorgegangen, da die Or-ganisationsmitglieder erst aus ihrer überholten Organisationskultur herausgelöst werden müssen.
- Krisenansatz: In schwierigen Situationen wird durch den Austausch der Führungsmann-schaft der Wandel eingeleitet, während die übrigen Mitarbeiter nur Zuschauer sind (Staehle 1990:549).
Da Schreyöggs Kategorisierung nach „Kulturingenieuren“, „Kulturalisten“ und „Kurskorrek- tur“ an die bereits in Abschnitt 1.2 aufgeworfenen Frage nach der Kultur als Variable, Meta- pher oder dynamisches Konstrukt anknüpft, erscheint es nur allzu konsequent, die Einteilung nach Staehle zu vernachlässigen. Die Erwähnung des Krisenansatzes bei Staehle ist jedoch ein wichtiger Hinweis darauf, daß einige Organisationskulturforscher annehmen, ein Kulturwan-del könne nur dann erfolgreich sein, wenn das Management ausgetauscht wird. Bei Schreyögg wird das nur am Rande erwähnt.
2. Gründe für die Hinwendung zum Konzept der Organisationskultur
Die Gründe für die Hinwendung zur Organisationskulturforschung sind sicherlich vielfältig und deshalb nur schwer zu kategorisieren. Trotzdem sollte man den Versuch starten zu erfor- schen, warum dem Konzept der Organisationskultur seit dem Beginn der 1980er Jahre so viel Beachtung zuteil wird.
Von Rosenstiel (1993) nennt folgende Gründe:
- den aktuellen Wertwandel in den westlichen Industriegesellschaften
- die Verschärfung des nationalen und internationalen Wettbewerbs
- den Erfolg der japanischen Unternehmen
- das Erkennen der Grenzen eines rationalen Managements.
In Verbindung mit dem aktuellen Wertwandel stellte Inglehart im Jahr 1977 folgende Soziali- sierungshypothese auf: Wer in Wohlstand und Frieden aufwächst, für den sind Versorgung und Sicherheit Selbstverständlichkeiten. Da die traditionellen Werte der Versorgung und Si- cherheit an Bedeutung verloren, setzte das Streben nach „höheren“ Werten, z.B. nach Selbst- entfaltung und Individualität, ein (Rosenstiel 1993:10f., auch Jacobsen 1996:59, Raab 1989:20).
Organisationen können sich als offene Systeme nur schwer von den gesellschaftlichen Ent- wicklungen abkoppeln, und so fand auch dort ein Wechsel von materialistischen Werten („wirtschaftliche Stabilität“) zu postmaterialistischen Werten („mehr Mitbestimmung“) statt. Die bürgerliche Arbeits- und Leistungsethik im Weberschen Sinne wurde abgelöst durch eine „Gleichgewichtsethik“: den Versuch, Arbeit und Freizeit in Einklang zu bringen (Kaschube 1993:115f.)
Einen Überblick über den Wertwandel in Arbeit und Beruf bietet Hillmann (1989).
WERTWANDEL IN ARBEIT UND BERUFM
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Hillmann 1989:179ff.)
Für den Wertwandel in Arbeit und Beruf macht Hillmann (1989) die gestiegenen Bildungsni- veaus und die dementsprechend höher entwickelten individuellen Reflexionsmöglichkeiten verantwortlich. Eine zu weit gehende Abwertung der überkommenen bürgerlichen Arbeits- und Leistungsethik wurde allerdings durch die Einsicht gebremst, daß eine gewisse Einhal- tung der Arbeitstugenden für das Funktionieren der Industriegesellschaft und für die Siche- rung des Wohlstandes unerläßlich ist. Zudem hat in letzter Zeit durch die anhaltende Be- schäftigungskrise eine Restabilisierung der bürgerlichen Arbeits- und Leistungsethik stattge- funden (Hillmann 1989:181).
Die Verschärfung des nationalen und internationalen Wettbewerbs geht mit der Internationa- lisierung der Märkte einher: durch den Wegfall der Handelsschranken verstärkt sich die Kon- kurrenz. Die Folgen, z.B. der Zusammenbruch traditionsreicher westlicher Unternehmen, läßt Zweifel aufkommen, ob die bisherigen Motivationssysteme noch ausreichen. Es wird zuneh- mend auf Konzepte zurückgegriffen, die zur Identifikation der Arbeitskräfte mit dem Unter- nehmen und seinen Zielen führen.
In Zeitalter der Globalisierung spielen „Standortfaktoren“ eine große Rolle. Unter ihnen gibt es „harte“ und „weiche“. Zu den harten Faktoren zählen u.a. die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und die Höhe der Lohnkosten. Zu den weichen Faktoren gehören das kulturelle Umfeld und der Freizeitwert. Tendenziell nimmt die Bedeutung der harten Faktoren ab, wäh- rend die der weichen zunimmt. Die harten Faktoren sind dem Wettbewerb viel direkter ausge- setzt und neigen deshalb zur Vereinheitlichung. Beispielsweise sind Arbeitskräfte mit Stan- dardqualifikationen nahezu überall zu haben. Hochqualifizierte Kräfte wie Forscher, Mana- ger, Ingenieure und Informatiker sind dagegen verhältnismäßig knapp. Daher lassen sie sich oft nur gewinnen, wenn auch der Kulturfaktor des Arbeitsumfeldes hoch ist (BpB 1999:18).
Der Erfolg der japanischen Unternehmen seit dem Beginn der 1970er Jahre lenkte die Auf- merksamkeit auf die „weichen Faktoren“, die zur Identifikation der Organisationsmitglieder mit der Organisation führen. Es setzte sich die Annahme durch, daß der Wettbewerbsvorteil der japanischen Wirtschaft auf kulturellen Faktoren basiert, die den Gruppenzusammenhalt fördern (Raab 1989:11).
Sydow (1993) ist dagegen der Meinung, daß die japanische Industrie „ihren Wettbewerbs-vorteil und ihre Wettbewerbsstärke der Subkontrakt-Struktur“ schuldet (Sydow 1993:45). Die Subkontrakt-Unternehmen dienen den fokalen Keiretsu-Unternehmungen als sekundäre Zulie- ferbetriebe. Es handelt sich dabei meist um kleinere Familienbetriebe, die arbeitsintensive Funktionen übernehmen. Die Beziehungen zwischen den Unternehmen zeichnen sich durch Langfristigkeit und durch eine große ökonomische Abhängigkeit der Subkontrakt-Unterneh- mungen aus (Sydow 1993:41ff.).
Die Imitation der japanischen Organisationsstrukturen erscheint angesichts der gravierenden Unterschiede zwischen der japanischen und der westeuropäischen Industriegesellschaft pro- blematisch. Im Vergleich zu westeuropäischen Industriegewerkschaften mangelt es den japa- nischen Betriebsgewerkschaften an Durchsetzungskraft. Der Staat übt massiven Einfluß in Form einer aktiven, mit Unternehmensverbänden und Kammern abgestimmten Industriepoli- tik aus. Der Kapitalmarkt ist anders strukturiert. Im Unterschied zu westeuropäischen Organi- sationen überschreitet der Gruppenzusammenhalt in Japan auch die Organisationsgrenzen. Zudem zeichnet sich Japan durch eine kulturell verwurzelte Identifikation des einzelnen mit seiner Organisation aus. Japan ist eine Kultur gegenseitigen Gebens und Nehmens, deren Vo- raussetzung und Folge gegenseitiges, auch in interorganisationalen Beziehungen wirksames Vertrauen ist. Und vor allem die bereits erwähnte „duale Ökonomie“ ist von großer Bedeu- tung: auf der einen Seite gibt es kapitalintensive Großunternehmungen mit einer großen Ar-beitsplatzsicherheit, auf der anderen Seite Subkontrakt-Unternehmen mit einem hohen Arbeitsplatzrisiko.
In Westeuropa existiert der Gruppenzusammenhalt wegen des vorherrschenden Individualismus oft nicht einmal innerhalb des Betriebes. Statt einer Betriebsorientierung herrscht aufgrund des professionellen Bildungssystems eine Berufsorientierung vor (Sydow 1993:46). Die aktuelle Lage der japanischen Wirtschaft - die Verringerung der Industrieproduktion, der stagnierende Konsum und die steigende Arbeitslosenrate (Kaufmann 2000:33) - zeigt zudem, daß die vermeintliche Überlegenheit Japans nicht überbewertet werden sollte.
Das Erkennen der Grenzen des rationalen Managements, das seine Aufgabe in der Kontrolle und der Motivierung der Mitglieder mit Hilfe von Entlohnungssystemen sieht, führt dazu, daß die Organisationskultur neben den traditionellen Produktionsfaktoren Kapital, Personal und Management an Bedeutung gewinnt. Die technisch-organisatorische Rationalisierung macht die Arbeit immer abstrakter, wodurch ein zunehmender Sinnverlust der Arbeit einsetzt. Den Mitarbeitern fehlen Kenntnisse der Zusammenhänge ihrer Arbeit. Deshalb wird sich das Ma- nagement in Zukunft verstärkt damit beschäftigen müssen, einen glaubwürdigen Sinnzusam- menhang organisatorischen Handelns herzustellen. Das Problem dabei ist, daß sich die Orga- nisation als Einheit darstellen soll, obwohl sie aus einer Vielzahl von mehr oder weniger au- tonomen Komponenten besteht. Ein Ansatzpunkt könnte hier die Organisationskultur sein, die diese „loosely coupled systems“ durch ein Wir-Gefühl zusammenführt und auf diese Weise Sinn und Orientierung vermittelt (Scholz & Hofbauer 1990:12ff.). Fraglich ist allerdings, ob tatsächlich die Rationalisierung der Arbeit, die ja bereits zur Zeit der industriellen Revolution eingesetzt hat, ein Grund für die Hinwendung zum Konzept der Organisationskultur ist. Hat nicht vielmehr wieder der Wertwandel, durch den Arbeit nicht mehr als reine Existenzsiche- rung, sondern als Teil der Selbstverwirklichung betrachtet wird, dazu geführt, daß die Mana- ger zusätzlich immaterielle Anreize schaffen müssen, um die Mitarbeiter zu motivieren?
3. Organisationskultur als Paradigmenwechsel in der Organisationssoziologie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Max Weber und Frederick W. Taylor, zwei Klassiker der Organisationssoziologie, verstanden unter Organisationen geschlossene, zweckrationale Systeme, die bewußt und geplant Men- schen und Mittel einsetzen, um einen maximalen ökonomischen Erfolg zu erzielen (Rosen-stiel 1993:8f.). Sowohl in Webers „Bürokratietheorie“ als auch in Taylors „Scientific Mana- gement“ steht die Maschinen-Metapher in Mittelpunkt (Kaschube 1993:95). Die Organisation wird als Maschine, als Instrument verstanden ,„mit dem ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll und dessen einzelne Teile in wohlabgestimmter Anordnung effektiv ineinandergreifen“
(Neuberger & Kompa 1987:22). Eine effektive Arbeitsplanung kann nur durch hochgradige Arbeitsteilung und durch ein straffes Kontrollsystem erreicht werden. Der Mensch ist ein homo oeconomicus: er tauscht seine Arbeitskraft gegen Geld, interessiert sich jedoch nicht für den Inhalt der Tätigkeit, sondern ist grundsätzlich arbeitsscheu und unmotiviert (Kaschube 1993:100).
Den Ausgangspunkt einer Umorientierung stellte die Human Relations Bewegung dar. An- fangs zeigten die Vertreter der Human Relations Bewegung nur ein tayloristisches Interesse an der Wirkung äußerer Arbeitsbedingungen (z.B. dem Einfluß von Licht) auf die Arbeitslei- stung. Erst die unklaren Ergebnisse dieser Untersuchungen, den Hawthorne-Experimenten, richteten den Blick der Forscher auf die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen (Ka- schube 1993:101f.).
Im Vergleich zur Maschinen-Metapher handelt es sich bei der Organisationskultur um einen sehr vagen Terminus, weil der Begriff der Kultur höchst unterschiedliche Bedeutungen haben kann (Neuberger & Kompa 1987:22). Das Konzept der Organisationskultur führte dazu, daß die klassischen Untersuchungsfelder wie Strukturen und Technologien abgelöst wurden durch die Analyse von Normen und Werten. Die Forschungsinteressen verlagerten sich von der „or- ganization“ als „objektiver Realität“ hin zum „organizing“ als Ausdruck eines Prozesses der Wirklichkeitskonstruktion. Menschen fungieren als Schöpfer von Werten, Normen und Sym- bolen (Lasser 1987:1927ff.). Die Organisation wird als Miniaturgesellschaft verstanden, die ihre eigene charakteristische Kultur entwickelt. Als Organisationskultur gilt die Gesamtheit der organisationsbezogenen Werte und Normen. Sie ist das Ergebnis eines historischen Pro- zesses, dessen Verlauf wesentlich von menschlichen Entscheidungen und Handlungen geprägt ist (Gussmann & Breit 1987:108). Das Menschenbild des homo oeconomicus wird abgelöst durch das des homo sociologicus, in dem soziale Beziehungen eine wichtige Rolle spielen und in dem die Organisation als einzigartige Symbolwelt wahrgenommen wird.
4. Folgen
4.1 für die Wissenschaft
Die noch von Weber und Taylor vertretende Ansicht, bei einer Organisation handele es sich um eine objektive Realität, ist in das Konzept der Organisationskultur kaum integrierbar. Eine Organisation ist keine von den handelnden Personen unabhängige, objektiv existierende Welt, sie ergibt sich aus den Deutungen und Interpretationen der jeweils beteiligten Personen. Es kann keine Gesetzmäßigkeiten geben, die auf alle Organisationen anwendbar sind, denn die soziale Wirklichkeit wird in jeder Organisation von anderen Individuen auf verschiedene Weise interpretiert. Die Auffassung von der Organisation als Miniaturgesellschaft führt zum Rückgriff auf den Symbolischen Interaktionismus und somit zu einem Übergang vom quanti- tativen, auf Gesetzmäßigkeiten basierenden Verfahren zum qualitativen, beschreibenden Vor- gehen (Rosenstiel 1993: 17ff.).
Verantwortlich für die Hinwendung zur qualitativen empirischen Sozialforschung ist die zunehmende Skepsis gegenüber der Eignung naturwissenschaftlich orientierter, quantitativer Forschungskonzeptionen, die eine Reduzierung komplexer Sachverhalte auf wenige Variablen vorsehen (Jacobsen 1996:59).
4.2 für die Praxis
Das Konzept der Organisationskultur hat durchaus Auswirkungen auf die Praxis, was - auch bei anwendungsorientierten Theorien - nicht zwangsläufig der Fall sein muß. Kultur wird von vielen Organisationen als Erfolgsfaktor erkannt und genutzt. Insbesondere bei nicht so erfolgreichen Organisationen entsteht der Wunsch, eine erfolgversprechende Kultur zu „machen“, beispielsweise durch die Schaffung neuer Symbole (Logos, Slogans) oder die Schulung der Führungskräfte. Bei einer derartigen Instrumentalisierung von Kultur sollten allerdings Zweifel angebracht sein. Kultur ist zwar nicht stabil. Sie unterliegt einem ständigen Wandel, wobei der Wandel auch initiiert werden kann. Es ist durchaus nachvoll- ziehbar, auf eine Organisation als Kultur Einfluß nehmen zu wollen, aber es ist naiv, von der Wissenschaft allgemeingültige und zeitlose Rezepte und Regeln dafür zu erhoffen (Rosenstiel 1993:19f.). Es ist äußerst fraglich, ob Organisationskultur in einem so hohen Maße konstru- ierbar ist.
Es gibt Unternehmensberatungen, die da anderer Meinung sind und Organisationen ihre Lei- stungen anbieten. So hält das Albert-Schweitzer-Institut für Unternehmenskultur es für „empfehlenswert, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob zwischen den Ebenen der Unternehmenskultur ein einigermaßen harmonisches Verhältnis besteht“ (Albert-Schweitzer-Insti- tut für Unternehmenskultur). Das hört sich leicht an, aber nur wenigen Organisationen gelingt es tatsächlich, Werte und Normen zu schaffen, die die Verwirklichung der angestrebten Ziele und den Erfolg auf dem Markt fördern (Scholz & Hofbauer 1990:31).
5. Kritik am Konzept der Organisationskultur
Viele Vertreter der Organisationskulturforschung bestehen auf einer Abgrenzung der Organisationskultur gegenüber anderen Begriffen. So beschäftigt sich die Unternehmensethik zwar auch mit Werten und Normen, versucht aber zu begründen, warum spezifische Normen in einer Organisation entstehen oder entstehen sollen. Die Unternehmensphilosophie gibt der Organisation schriftlich fixierte, idealisierte Werte und Normen vor, ohne sie zu hinterfragen. Die Corporate Identity ist zwar eng verknüpft mit der Organisationskultur, präsentiert jedoch die Organisationsidentität im Sinne einer Selbstdarstellung, um ein Wir-Gefühl zu vermitteln und so bestimmte Ziele zu erreichen (Jacobsen 1996: 44f.).
In Wirklichkeit herrscht innerhalb der Organisationskulturforschung keine Einigkeit über die eindeutige Abgrenzbarkeit der Begriffe. Ein gutes Beispiel dafür findet man auf der Internetseite des Albert-Schweitzer-Instituts für Unternehmenskultur, das die Organisationskultur in drei Ebenen unterteilt - und zwar in die Unternehmensphilosophie, die Unternehmensethik und die Unternehmensidentität (Corporate Identity).
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Uneinheitlichkeit der empirischen Methoden, da eine Modellbildung auf der Suche nach schnellen Anwendungsmöglichkeiten vernachlässigt wurde. Kaschube (1993) begrüßt zwar die Methodenvielfalt, da es eine einzige Methode zur Erfassung von Organisationskultur aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben kann. Zudem weißt er darauf hin, daß die Organisationskulturforschung noch sehr jung und von ihrer je- weiligen Herkunftsdisziplin geprägt ist, daß aber das Bewußtsein über angemessene Metho- den über einen längeren Zeitraum wächst (Kaschube:132f.). Die Frage nach einer adäquaten Methode kann nach Jacobsen (1996) ohnehin nicht geklärt werden, solange keine Einigkeit über die Inhalte von Organisationskultur herrscht. „´Alles´kann zur Analyse einer Kultur herangezogen werden, weil es kein überzeugendes Ausschlußkriterium gibt“ (Jacobsen 1996:137).
Das vordergründige Problem ist, daß es sich bei der Analyse von Organisationskulturen allen- falls um die Beschreibung von Kulturäußerungen, aber nicht um deren Erklärung handelt. Die offiziellen Normen und Werte der Organisation müssen nicht mit den informalen Orien- tierungsmustern übereinstimmen (Staehle 1990:467). Begriffe wie Werte und Normen gehö- ren ohnehin einer Abstraktionsebene an, die schwer zu operationalisieren ist (Krappmann 1972: 199). Außerdem ist die Zuordnung von einheitlichen Orientierungsmustern schwierig, da es verschiedene Subkulturen in der Organisation geben kann. So können beispielsweise organisationsübergreifende Berufskulturen einer einheitlichen Organisationskultur entgegen- wirken.
Entsprechende Analysen können also nur einen explorativen Charakter haben (Krappmann 1972:201). Sie sind zudem nur für kleinere Organisationen geeignet.
Der Erklärungswert des Organisationskulturansatzes liegt für Schein (1995) u.a. darin, daß die Analyse der Kultur notwendig für ein Verständnis der Wirkungen von neuen Technologien in Organisationen ist und die Wandlungsfähigkeit von Organisationen nur mit einem tiefen Ver- ständnis organisationskultureller Prozesse erhalten bleiben kann (Schein 1995:10f.). Im Fall der Organisationskultur handelt es sich aber nicht um ein Konzept, das innovative Entwicklungen innerhalb der Organisation fördert, sondern Werte und Normen weisen eher Beharrungstendenzen auf. Interessant ist, daß in der Organisationskulturforschung unter einer Organisation bis zu einem gewissen Grad ein geschlossenes System verstanden wird. Schließlich kann eine Organisation nur dann eine spezifische Kultur ausbilden, wenn sie sich von ihrer Umwelt abgrenzt und nicht alle neumodischen Erscheinungen übernimmt. Die Ab- geschlossenheit des Systems wird allerdings im Vergleich zu Weber oder Taylor als nicht so rigoros angesehen. Man ist sich durchaus gewußt, daß gesellschaftliche Prozesse Einfluß auf die Entwicklung von Organisationen haben und umgekehrt. So hat z.B. der Wertwandel, ein gesellschaftliches Phänomen, zu dem veränderten Verständnis der Organisation als Kultur geführt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Organisationskulturforschung nicht selbst eine Modeerscheinung ist.
Nach Scheins Ansicht ist die Kulturanalyse zudem „notwendig für ein Managementüber na-tionale und ethnische Grenzen hinweg“ (Schein 1995:10). Aber er selbst geht nicht darauf ein, inwieweit zwischen Kultur und Mentalität ein Zusammenhang besteht und ob Kultur ein Problem in multinationalen Organisationen darstellen kann. Scholz und Hofbauer (1990) ha- ben sich eingehend mit den Verhältnis von Organisationskultur und Landeskultur auseinan- dergesetzt. Sie geben die Ergebnisse einer Studie von Hofstede wieder. Die Studie kommt zu dem Schluß, daß es bestimmte Partner-Kulturen gibt, die besonders effektiv miteinander ko- operieren können. Länder mit gleichen oder zumindest ähnlichen Werten wurden zu insge- samt acht Kulturregionen zusammengefaßt. So können Österreich, Israel, Deutschland und die Schweiz als germanische Länder gut gemeinsam arbeiten. Und auch bei Organisationen, die aus den höher entwickelten romanischen Ländern Belgien, Frankreich, Spanien, Brasilien und Italien stammen, stehen die Chancen für eine produktive Zusammenarbeit gut. Japan als das einzige höher entwickelte asiatische Land findet dagegen nur schwer passende Kooperations- partner (Scholz & Hofbauer 1990:100).
Auf der einen Seite gibt allerdings genug praktische Beispiele, die zeigen, daß auch eine mul- tinationale Zusammenarbeit erfolgreich sein kann: Kooperationen zwischen Fluggesellschaf-ten von meist allen fünf Kontinenten, wie z.B. oneworld oder die Star Alliance, laufen sehr erfolgreich. Auf der anderen Seite ist es beispielsweise vorstellbar, daß Deutschland und Israel, die laut Kategorisierung einer Kulturregion angehören, aufgrund der nationalsozialistischen Geschichte Deutschlands auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Es gibt nun einmal kein Rezept für eine effektive Zusammenarbeit.
Ein entscheidender Vorteil des Konzeptes der Organisationskultur ist allerdings, daß nicht nur dieökonomische, sondern auch die soziale Dimension von Organisationen berücksichtigt wird. Schließlich sind Organisationen nicht nur „Maschinen“, die einen bestimmten Zweck verfolgen, sondern sie sind auch soziale Systeme, in denen Menschen soziale Beziehungen pflegen und wo Menschen sozialisiert werden. Menschen werden als Träger sozialen Handeln gesehen und bringen ihre eigenen Interpretationen in die Organisationen ein, obwohl es mitunter angebracht ist zu fragen, ob das Management den Mitarbeitern nicht kulturelle Denkund Werthaltungen aufzwingt, um eine starke Organisationskultur zu gestalten.
Empirischer Teil
6. Ein Beispiel: Die Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
Vorab sei angemerkt, daß an dieser Stelle nicht der Versuch unternommen werden soll, die Organisationskultur der Humboldt-Universität umfassend darzustellen. Das ist angesichts der verwendeten „Erhebungsmethoden“ (teilnehmende Beobachtung als Student und als studentische Hilfskraft) gar nicht möglich. Die Absicht des folgenden Abschnitts ist es lediglich, „an der Oberfläche des Konzepts der Organisationskultur zu kratzen“ und die Anwendbarkeit des Konzeptes der Organisationskultur an einem praktischen Beispiel ansatzweise zu testen. Vielleicht könnte dies als explorative Studie bezeichnet werden.
6.1 Organisationskultur der HU
Wo, wenn nicht in einer Universität, sollte es eine Organisationskultur geben? Universitäten sind quasi ein Sinnbild für Kultur: dort wird Kultur vermittelt, wird nach kulturellen Ausprägungen geforscht und dort entsteht mitunter auch Kultur.
Zudem handelt es sich bei einer Universität um eine Organisation, auch wenn ihr vorrangiges Ziel nicht darin besteht, materiellen Gewinn zu erwirtschaften und nicht an Effizienzkriterien festgemacht werden kann. Es handelt sich also nicht um eine Organisation im Sinne einer Unternehmung.
Die Humboldt-Universität zu Berlin zeichnet sich jedoch wie jede andere Organisation aus durch
- die Offenheit des Systems gegenüber der Umwelt, was sich vor allem darin manifestiert, daß ihr Mitgliederkreis kontinuierlich wechselt
- die Existenz über einen längeren Zeitraum: die Humboldt-Universität wurde im Jahr 1810 gegründet und existiert somit seit fast 200 Jahren
- die Verfolgung spezifische Ziele, allem voran die Ausbildung der nächsten Generation und die Forschung (Schley 2000b:10)
- die Existenz als ein soziales System: Lernende, Lehrende, Forschende und das nichtwis-senschaftliche Personal bilden Gruppen und interagieren miteinander
- eine Struktur, als deren Ausprägungen die Aufteilung in Fakultäten und die Tatsache, daß Professoren in der Hierarchie höher stehen als beispielsweise Studenten, gelten können.
Zu den Basisannahmen, die nach Scheins Drei-Ebenen-Modell grundlegend für die Bestim- mung der Organisationskultur sind, gehören im Fall der Humboldt-Universität folgende Aspekte:
- die Umwelt wird als Herausforderung gesehen: man ist bemüht, sie zu erklären und sie unter Umständen zu verändern
- bei Entscheidungen bezieht man sich auf Fakten (Theorien), Autoritäten (Professoren, Dozenten) und wissenschaftliche Ergebnisse
- die Universität hat vor allem konsensualen Charakter: in Lehre und Forschung muß zusammengearbeitet werden, wenn Erfolge erzielt werden sollen; aber auch der Wettbewerb wird als unerläßlich angesehen, da er die Universität vor eingefahrenen Strukturen bewahrt und so verschiedene Sichtweisen aufeinandertreffen, die nur zusammen zu einer umfassenden Deutung der Welt beitragen können, obwohl die HU oft bezeichnet wird als „Universität der 450 professoralen Leuchttürme, die sich sinnloseinander bestrahlen“ (Schley 2000b:10).
Ausgehend von den Basisannahmen kann nach Schein jetzt auf die Werte und Normen der Humboldt-Universität geschlossen werden.
Zu den Werten, die von der HU vertreten werden, gehören
- Bildung durch Lehre und Forschung
- Tradition, aber auch
- Fortschritt.
Normen sind im Wissenschaftsbetrieb der Universitäten generell nicht so hoch anzusiedeln, da hier die Abhängigkeit nicht so groß ist wie in anderen Organisationen. Zumindest Studen- ten können im Gegensatz zur arbeitenden Bevölkerung relativ einfach ihren Studienplatz wechseln, wenn ihnen an der jeweiligen Universität irgend etwas nicht gefällt. Als Norm in Universitäten kann jedoch gelten, daß auch dort Leistungen erbracht werden müssen: von den Studenten, um in ihrem Studium weiterzukommen, und vom wissenschaftlichen Personal, um seine Arbeit und so letztlich seinen Verdienst zu legitimieren. Im nichtwissenschaftlichen Universitätsbereich, z.B. in der Verwaltung, spielt die Leistungsnorm allerdings eine größere Rolle als in der Lehre und Forschung. So wird schon seit Jahren darüber nachgedacht, ein- zelne Abteilungen, z.B. die Gebäudeunterhaltung (Pförtner, Hausmeister, Werkstätten), zu privatisieren.
Die Werte und Normen der HU manifestieren sich u.a. in folgenden Symbolen:
Die Humboldt-Brüder, die Gründungsväter der Universität, versinnbildlichen den Wert der Bildung. Sie schlagen eine Brücke zwischen Natur- und Geisteswissenschaften: Alexander von Humboldt war Naturforscher, Wilhelm von Humboldt dagegen Philosoph und Sprachfor- scher. Zudem sind die Gebrüder Humboldt auf dem Logo der HU zu sehen, wodurch sie noch immer allgegenwärtig sind.
Die Tradition ist gegeben durch das Hauptgebäude. Volker Gerhardt, Professor an der Hum- boldt-Universität, spielt im folgenden Zitat darauf an, daß das Gebäude in den Jahren 1748- 1766 als Palais für Prinz Heinrich erbaut wurde und somit ursprünglich nicht als Universitäts- gebäude gedacht war:
„Um auch nur eine Ahnung zu haben, wo wir im Augenblick sind, brauchen wir die Geschichte. In ausgezeichneten historischen Räumen, wie etwa in diesem Gebäude, ist das offenkundig: Die Steine, das Glas, das Holz oder die Textilien um uns herum sagen nichts darüber, daßwir uns hier in einer Universität befinden.“(Gerhardt 1993:3)
Der Wert der Tradition spiegelt sich nicht nur im Hauptgebäude der HU wider. Er wird auch versinnbildlicht durch den Mythos der Geschichte der Universität, obwohl Gerhardt durch die Wechselhaftigkeit der historischen Ereignisse anzweifelt, daß es an der HU so etwas wie eine Tradition geben kann:
„Die Humboldt-Universität war durch den Geniestreich ihrer Gründung, durch ihre weltweit wirkende Vorbildfunktion während eines ganzen Jahrhunderts, [...], durch ihr wechselvolles politisches Schicksal in unmittelbarer Nachbarschaft zur politischen Macht und schließlich durch das Experiment ihrer Erneuerung bei laufendem Betrieb historisch so extremen Erwartungen und Belastungen ausgesetzt, dass fraglich ist, ob manüberhaupt von ihrer Tradition sprechen kann und sprechen soll.“(Gerhardt 2000b)
Einen Slogan hatte die HU bisher nicht. Es wurde jedoch kürzlich das Motto „Hier lebt dieWissenschaft.“ (Schley 2000b:11) vorgeschlagen, das auf die „Lebendigkeit“ der HU und somit auf den Fortschrittsgedanken abzielt.
Hat die Humboldt-Universität nun eigentlich eine starke Kultur?
Wie oben bereits erwähnt, würde man das bei einer Universität - der höchsten Bildungseinrichtung überhaupt - vermuten. Bei näherer Betrachtung zeigt sich allerdings, daß die HU über viele Subkulturen (Fakultäten bzw. Studienfächer) verfügt und sich durch eine hohe Fluktuation der Mitglieder auszeichnet. Das sind eher Merkmale, die auf eine schwache Organisationskultur hinweisen, und die z.B. die mitunter unzureichende Identifikation der Studenten und des Personals mit der Massenuniversität und die mangelhafte Koordination zwischen den einzelnen Universitätseinheiten erklären können.
Diese Unzulänglichkeiten führten zu einer Image-Krise der HU. Einen Ausweg aus dem Dilemma soll das Projekt „Verbesserung des Leitungs- und Entscheidungssystems an der Humboldt-Universität zu Berlin“ (Lessy) bieten, daß von der Volkwagen-Stiftung mit 1,5 Millionen DM ausgestattet ist. Seit dem Frühjahr 1998 existiert als Teilprojekt die AG Leitbild, dessen Vorsitz Volker Gerhardt innehat (Schröder 2000).
Das von der AG Leitbild erarbeitete Thesenpapier „60 Leitlinien für ein Leitbild“ kommt da- bei einer Art Unternehmensphilosophie gleich, die Dozenten und Studenten der Humboldt- Universität vereinen soll. Herausgehoben wird die „Brückenfunktion zwischen Ost und West“ und die Internationalität in Forschung und Lehre, insbesondere die Ausrichtung der HU nach Nord- und Osteuropa (Gerhardt 2000b). Das erklärte Ziel ist eine „angestrebte Exzellenz“ (Gerhardt: 2000a). Für den Organisationswandel der Universität müssen alle Mitglieder zur Partizipation bereit sein: er soll von unten nach oben („bottom up“) in Lehre und Forschung, gepaart mit gezielten Initiativen der Gremien und Amtsträger, vollzogen werden (Mlynek 2000).
Bisher wurde den Interessen der AG Leitbild innerhalb der HU jedoch noch nicht viel Aufmerksamkeit zuteil.
6.2 Gründe für das Interesse an der Organisationskultur der HU
Einer der wichtigsten Gründe für den angestrebten Organisationswandel und für das damit verbundene Interesse an der Organisationskultur der HU ist sicherlich die Verschärfung des Wettbewerbs .„Wir wollen in der internationalen Champions League der Universitäten dabei sein“, meint Jürgen Mlynek, der derzeitige Präsident der Universität, dazu (Tomik 2000:15). Voraussetzung dafür ist seiner Meinung nach die Orientierung an amerikanischen Methoden, insbesondere die Einführung von Master- und Bachelor-Abschlüssen.
„Auch deutsche Universitäten sind einem starken Wettbewerb ausgesetzt“ (Gerhardt 2000a), sie haben dies beim wachsenden Zustrom der Studierenden nur nicht gemerkt. Die Leistung in Lehre und Forschung hat nachgelassen, vor allem durch die Uneffektivität der starren Universitätsverfassung und der Universitätsstrukturen. Folge ist, daß die deutschen Hochschulen international kaum noch gefragt sind. Deswegen ist eine Reorganisation nötig. Um diese schwierige Reorganisation zu verwirklichen, muß sich die Universität über ihre vorrangigen Aufgaben verständigen. Damit muß sie dann auch nach außen werben, um Achtung, Nachfrage und Förderung zu bekommen (Gerhardt 2000a, auch Mlynek 2000).
Das Erkennen der Grenzen rationaler und technokratischer Unternehmensführung spielt im Fall der HU nicht so die Rolle, weil der Anreiz, an eine Uni zu gehen, zumindest im Bereich der Lehre und Forschung nicht primär über Rationalität (Entlohnung) gesteuert wird. Eher ist wie an vielen Universitäten zunehmend eine Rationalisierung, hervorgerufen durch den verschärften Wettbewerb, bemerkbar, was sich beispielsweise in der gesteigerten Kontrolle der Leistung der Lehrenden und der Verwaltung äußert.
6.3 Paradigmenwechsel am Beispiel der HU
Im allgemeinen wird davon ausgegangen, daß das Konzept der Organisationskultur in der Organisationssoziologie zu einem Paradigmenwechsel geführt hat: Das Maschinen-Modell der Organisation, wie es von Weber und Taylor vertreten wurde, wurde abgelöst durch den Symbolischen Interaktionismus, der die Organisation als Miniaturgesellschaft versteht. Im Fall der Universitäten kann der beschriebene Paradigmenwechsel jedoch nicht nachvoll- zogen werden. Hier findet momentan ein Übergang von einer eher kulturellen zu einer eher technisierten Ausrichtung statt. Während Hochschulen früher als reines Kulturgut galten und sich im Prinzip bereits als Miniaturgesellschaften verstanden, wird in letzter Zeit aufgrund des verschärften Wettbewerbs zunehmend auf Rationalisierungs- und Privatisierungsmaßnahmen gesetzt, die unter dem Stichwort New Public Management laufen und im Wesentlichen einen Rückgriff auf Webers Bürokratietheorie darstellen. Die Universität wird nicht mehr nur als Miniaturgesellschaft - oder als „Gemeinwesen“, wie es Jürgen Mlynek formuliert - verstan- den, wo Gemeinschaftsgefühl und Teamgeist gefordert werden gemäß dem Motto: „Nur ge-meinsam sind wir stark.“ Die Universität soll neueren Bestrebungen zufolge auch stärker zum Dienstleister werden: Kunden sind die Studierenden (Mlynek 2000). Gründe für das Umdenken sind u.a. die Finanznot der öffentlichen Verwaltung, die Globalisierung, die Delegitimierung der Verwaltung und der Verlust an deren Glaubwürdigkeit.
6.4 Folgen für die HU
Auch die Humboldt-Universität bedient sich der Hilfe externer Experten. So untersucht das Berliner Büro der Unternehmensberatung McKinsey, die sich u.a. auch mit Organisations- kultur beschäftigt, an der HU ein neues Leitungsmodell, mit dem die Selbstverwaltung erheb- lich professionalisiert werden soll. An der Humboldt-Universität verspricht man sich von dem Programm, das unter dem Titel „Humboldt 2010“ läuft, zum einen eine Art „Heilserwartung“ in Sinne einer Imagepflege, zum anderen soll die Unternehmensberatung auch als Experten- waffe gegen den kontinuierlich öffentliche Mittel kürzenden Staat dienen. Demnach zählen an der HU eher die Moderationsfähigkeiten der Unternehmensberatung McKinsey als deren Ex- pertenrat. Die Erwartungen sind also nicht utopisch, man erwartet von „Humboldt 2010“ keine radikalen Veränderungen hinsichtlich der Organisationsstrukturen und der Organisa- tionskultur der HU, dennoch wurde die Zusammenarbeit mit McKinsey von vielen Seiten als Image-Schnellschuß bezeichnet (Schley 2000a). Ob sich durch das Programm überhaupt et- was ändern wird, bleibt abzuwarten.
6.5 Probleme bei der Bestimmung der Organisationskultur der HU
Aufgrund ihrer schwachen Organisationskultur, die aus den vielen verschiedenen Subkulturen resultiert, ist es fraglich, ob die Humboldt-Universität überhaupt über einheitliche Basisan- nahmen verfügt. So werden z.B. Juristen und Philosophen Hierarchie und Status in zwi- schenmenschlichen Beziehungen unterschiedlich bewerten, Afrikanisten und Skandinavisten aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturbereichen über verschiedene Menschenbilder verfügen. Sind schon die Basisannahmen so uneinheitlich, kann es auch keine gemeinsamen Werte, Normen und Symbole geben. Schein selbst hat sich die Frage ge- stellt, ob es tatsächlich möglich ist, daß eine große Organisation eine einzige Kultur haben kann. Er schlägt vor, diese Frage empirisch zu behandeln. Wird festgestellt, daß bestimmte Prämissen von allen Verbänden der Organisation geteilt werden, dann kann trotz ausgeprägter Subkulturen auch von einer Organisationskultur ausgegangen werden (Schein 1995:27). Scheins Position zufolge kann man also annehmen, daß die HU eine Organisationskultur hat, die auf den gemeinsamen Prämissen, die in Abschnitt 6.1 dargelegt wurden, basieren. Trotz- dem ist die Frage berechtigt, ob es aufgrund des hohen Abstraktionsgrades überhaupt möglich ist, die Basisannahmen, die innerhalb der Universität existieren, so eindeutig festzulegen. In bezug auf das Thesenpapier „Leitlinien für ein Leitbild“ handelt es sich wohl eher um eine Art Unternehmensphilosophie als um eine Aufschlüsselung der Organisationskultur der HU in einzelne Kernelemente. Allerdings kann man die Begriffe der Unternehmensphilosophie und der Organisationskultur nicht strikt voneinander trennen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwer abzuschätzen, ob die „Leitlinien“ Auswirkungen auf die künftige Organisationskultur der HU haben werden oder nicht. Derzeit wird von mehreren Seiten, aber vor allem von der Univer- sitätsleitung, ein verstärktes Gemeinschaftsgefühl gefordert. Ein ausgeprägtes Wir-Gefühl findet man aber nur bei starken Organisationskulturen. Die Humboldt-Universität zu verein- heitlichen und sie somit zu einer starken Organisationskultur zu machen, ist wohl kaum er- strebenswert. Die Universität ist nun einmal nicht nur eine Miniaturgesellschaft, sie ist eine multikulturelle Gemeinschaft. Diese Vielfältigkeit stellt eine Bereicherung der einzelnen Dis- ziplinen dar, und daran wird wohl selbst die zunehmende Rationalisierung so schnell nichts ändern.
Auch nach der Anwendung des Organisationskulturansatzes an einem empirischen Beispiel bleibt dessen Erklärungskraft also weitgehend im Unklaren. Dennoch hat das theoretische Konzept, so uneinheitlich es ist, nach wie vor einen festen Platz in der Organisationssoziolo- gie.
Literatur
Albert-Schweitzer-Institut für Unternehmenskultur: Unternehmenskultur. (Online-Publikation auf www.schweitzer-institut.de/frwir.htm)
Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) (Hrsg.) (1999): Informationen zur politischen Bildung: Globalisierung. Heft Nr. 263. Bonn: BpB, 1999.
Domnitz, Christian (2000): Wissenschaft wird aufpoliert. Diskussionen um neue Leitbilder an der Humboldt-Uni und an der Freien Universität. Unaufgefordert 10 (2000). S. 9.
Ebers, Mark (1987): Organisationskultur und Führung. In: Kieser, Alfred/Reber,
Gerhard/Wunderer, Rolf (Hrsg.): Handwörterbuch der Führung. Stuttgart: Poeschel, 1987. S. 1619 - 1630.
Gerhardt, Volker (1993): Zur philosophischen Tradition der Humboldt-Universität. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 1993.
Gerhardt, Volker (2000a): Einführung. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2000. (Online-Publikation auf www.hu-berlin.de/leitbild)
Gerhardt, Volker (2000b): Leitlinien für ein Leitbild. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2000. (Online-Publikation auf www.hu-berlin.de/leitbild)
Gussmann, Bernd/Breit, Claus (1987): Ansatzpunkte für eine Theorie der Unternehmenskul- tur. In: Heinen, Edmund: Unternehmenskultur. München: Oldenbourg, 1987. S. 109 - 121.
Hillmann, Karl-Heinz (1989): Wertwandel. Zur Frage soziokultureller Voraussetzungen alternativer Lebensformen. 2. Aufl. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. S. 175 - 190.
Jacobsen, Niels (1996): Unternehmenskultur. Entwicklung und Gestaltung aus interaktionistischer Sicht. Frankfurt/Main: Lang, 1996.
Kaschube, Jürgen (1993): Betrachtung der Unternehmens- und Organisationskulturforschung aus (organisations-) psychologischer Sicht. In: Dierkes/Meinolf/Rosenstiel, Lutz von/Steger, Ulrich (Hrsg.): Unternehmenskultur in Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: Campus, 1993. S. 90 - 146.
Kaufmann, Stephan (2000): Japan in der Klemme. In: Berliner Zeitung vom 28. Dezember 2000. S. 33.
Kompa, Ain (1990): Gestaltung von Unternehmenskultur - eine neue Chance oder eine neue Gefahr? In: Bachinger, Richard (Hrsg.): Unternehmenskultur. Frankfurt/M.: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1990. S. 40 - 51.
Krappmann, Lothar (1972): Soziologische Dimensionen der Identität. 2. Aufl. Stuttgart: Klett, 1972.
Lasser, Roswitha (1987): Symbolische Führung. In: Kieser, Alfred/Reber, Gerhard/Wunderer, Rolf (Hrsg.): Handwörterbuch der Führung. Stuttgart: Poeschel, 1987. S. 1927 - 1938.
Meiler, Rudolf C. (1998): Strategischer Entwicklung der Organisationskultur durch betriebliche Kleingruppen. Erlangen-Nürnberg: Dissertation, 1998. S. 16 - 37.
Mlynek, Jürgen (2000): Positionspapier zur weiteren Entwicklung der Universitäten in Deutschland. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2000. (Online-Publikation auf www.hu-berlin.de/praesident/pub/positionspapier.html)
Neuberger, Oswald/Kompa, Ain (1987): Wir, die Firma: der Kult um die Unternehmenskultur. Weinheim, Basel: Beltz, 1987. S. 17 - 25.
Raab, Sousan (1989): Funktionen der Unternehmenskultur - Positive Einflüsse auf das Unternehmen. Göttingen: Dissertation, 1989. S. 10 - 66, 94 - 122.
Rosenstiel, Lutz von (1993): Unternehmenskultur - einige einführende Anmerkungen. In:
Dierkes/Meinolf/Rosenstiel, Lutz von/Steger, Ulrich (Hrsg.): Unternehmenskultur in Theorie und Praxis. Frankfurt/M.: Campus, 1993. S. 8 - 22.
Schein, Edgar H. (1995): Unternehmenskultur. Ein Handbuch für Führungskräfte. Frankfurt/M.: Campus Verlag, 1995.
Schley, Jens (2000a): Besser man geht zum Therapeuten. Die Berliner Universitäten suchen die Hilfe von Unternehmensberatungen. In: Unaufgefordert 10 (2000). S. 8.
Schley, Jens (2000b): Leitbilder sind keine Markenartikel. Interview mit Gesine Schwan und Volker Gerhardt über die Leitbilddiskussion an der Humboldt-Universität. In: Unaufgefordert 12 (2000). S. 9 - 11.
Scholz, Christian/Hofbauer, Wolfgang (1990): Organisationskultur: die 4 Erfolgsprinzipien. Wiesbaden: Gabler, 1990. S. 11 - 33, 87 - 107.
Schreyögg, Georg (1991): Unternehmenskultur. In: Steinmann, Horst/Schreyögg, Georg: Management: Grundlagen der Unternehmensführung. 2. Aufl. Wiesbaden: Gabler, 1991. S. 529 - 553.
Schreyögg, Georg (1995): Unternehmenskultur. In: Corsten, Hans/Reiß, Michael (Hrsg.): Handbuch Unternehmensführung. Wiesbaden: Gabler, 1995. S. 111 - 121.
Schröder, Richard (2000): Vorwort. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2000. (Online- Publikation auf www.hu-berlin.de/leitbild)
Staehle, Wolfgang H. (1990): Organisationskultur. In: ders.: Management: eine verhaltenswissenschaftliche Perspektive. 5. Aufl. München: Vahlen, 1990. S. 465 - 484.
Sydow, Jörg: Strategische Netzwerke (1993): Evolution und Organisation. Wiesbaden: Gabler, 1993.
Tomik, Stefan (2000): Humboldt-Universität auf Höhenflug. Nach 100 Tagen: Das neue Präsidium hat ein 12-Punkte-Programm. In: Berliner Zeitung vom 11. Dezember 2000. S. 15.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptelemente der Organisationskulturforschung?
Die Hauptelemente umfassen die Definitionen von Organisation, Kultur und Organisationskultur, die Betrachtung der Organisationskultur als Variable oder Metapher, die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Kulturen, die Auswirkungen von Organisationskulturen und den Wandel der Organisationskultur.
Warum wird dem Konzept der Organisationskultur in der Organisationssoziologie eine so große Bedeutung beigemessen?
Gründe sind der Wertwandel in westlichen Industriegesellschaften, die Verschärfung des nationalen und internationalen Wettbewerbs, der Erfolg japanischer Unternehmen und die Erkenntnis der Grenzen rationalen Managements.
Inwiefern stellt die Organisationskultur einen Paradigmenwechsel in der Organisationssoziologie dar?
Die Organisationskultur markiert einen Wandel von geschlossenen, zweckrationalen Systemen (Weber, Taylor) hin zu einem Verständnis von Organisationen als Miniaturgesellschaften, in denen Normen, Werte und Symbole eine zentrale Rolle spielen.
Welche Folgen hat die Hinwendung zur Organisationskultur für Wissenschaft und Praxis?
Für die Wissenschaft bedeutet dies eine Abkehr von quantitativen hin zu qualitativen Forschungsmethoden. Für die Praxis führt es zu einer stärkeren Beachtung von Kultur als Erfolgsfaktor, wobei eine Instrumentalisierung kritisch gesehen wird.
Welche Kritik wird am Konzept der Organisationskultur geäußert?
Kritisiert werden die mangelnde Abgrenzung zu anderen Begriffen (z.B. Unternehmensethik, Corporate Identity), die Uneinheitlichkeit der empirischen Methoden und die Schwierigkeit, einheitliche Orientierungsmuster zu identifizieren.
Was sind die Merkmale einer Organisation laut dem Text?
Eine Organisation zeichnet sich aus durch Offenheit gegenüber der Umwelt, Existenz über einen längeren Zeitraum, Verfolgung spezifischer Ziele, Existenz als soziales System und eine Struktur mit Arbeitsteilung und Verantwortungshierarchie.
Wie wird Kultur im Text definiert?
Kultur ist ein spezifisches Denkmuster einer Gruppe von Menschen, das gemeinsame Orientierungen und Werte vorgibt, selbstverständlich ist, ein dynamischer und variabler Prozess ist und das Ergebnis eines Lern- und Sozialisationsprozesses ist.
Was sind die Merkmale von Organisationskultur laut dem Text?
Sie ist ein implizites Phänomen, das die Selbstinterpretation einer Organisation prägt, "selbstverständlich" ist, sich auf gemeinsame Orientierungen und Werte bezieht, aus einem Lernprozess resultiert, Orientierung in einer komplexen Welt vermittelt und das Ergebnis eines Sozialisationsprozesses ist.
Was sind die drei Ebenen im Drei-Ebenen-Modell von Edgar H. Schein zur Organisationskultur?
Die drei Ebenen sind Basisannahmen, Werte und Normen sowie Symbole.
Was ist der Unterschied zwischen dem Variablen- und dem Metaphern-Ansatz in Bezug auf Organisationskultur?
Der Variablen-Ansatz betrachtet Organisationskultur als eine Variable, die von Managern beeinflusst und gesteuert werden kann, während der Metaphern-Ansatz Organisationskultur als ein komplexes System von Deutungen und Interpretationen betrachtet, das nicht einfach von Managern vorgegeben werden kann.
Was sind die drei Dimensionen, anhand derer starke Organisationskulturen von schwachen unterschieden werden können (Schreyögg)?
Die drei Dimensionen sind die Prägnanz, der Verbreitungsgrad und die Verankerungstiefe.
Welche Funktionen hat Organisationskultur?
Zu den originären Funktionen gehören die Integrationsfunktion, die Koordinationsfunktion, die Motivationsfunktion und die Identifikationsfunktion. Eine derivative Funktion ist die Effizienz- und Effektivitätssteigerung.
Welche negativen Auswirkungen können starke Organisationskulturen haben?
Negative Auswirkungen sind die Tendenz zur Abschließung, die Fixierung auf traditionelle Erfolgsmuster, eine kollektive Vermeidungshaltung und strategische Barrieren.
Welche klassischen Ansätze gibt es in Bezug auf die Realisierung eines geplanten Wandels von Organisationskulturen?
Die klassischen Ansätze sind der Ansatz der "Kulturingenieure" und der Ansatz der "Kulturalisten".
Welche Gründe für das Interesse an der Organisationskultur der Humboldt-Universität werden im Text genannt?
Die Gründe sind die Verschärfung des Wettbewerbs und das Erkennen der Grenzen rationaler und technokratischer Unternehmensführung.
Was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem früheren und dem jetzigen Verständnis von Universitäten?
Während Hochschulen früher als reines Kulturgut galten, wird in letzter Zeit aufgrund des verschärften Wettbewerbs zunehmend auf Rationalisierungs- und Privatisierungsmaßnahmen gesetzt, die unter dem Stichwort *New Public Management* laufen.
- Citation du texte
- Adina Herde (Auteur), 2000, Organisationskultur am Beispiel der Humboldt-Universität zu Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102791