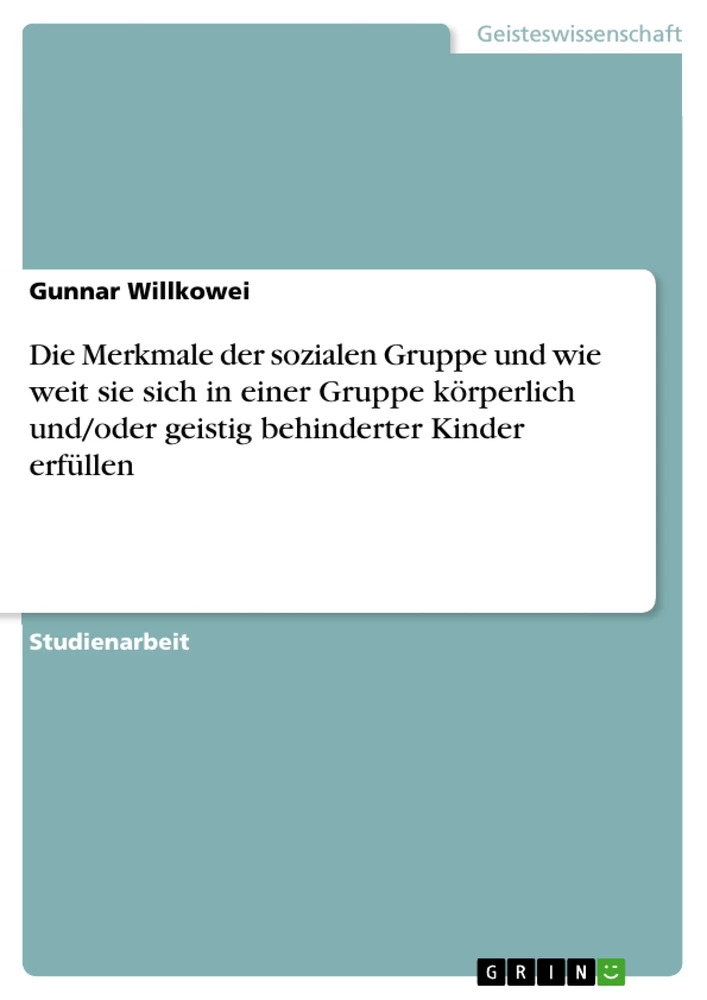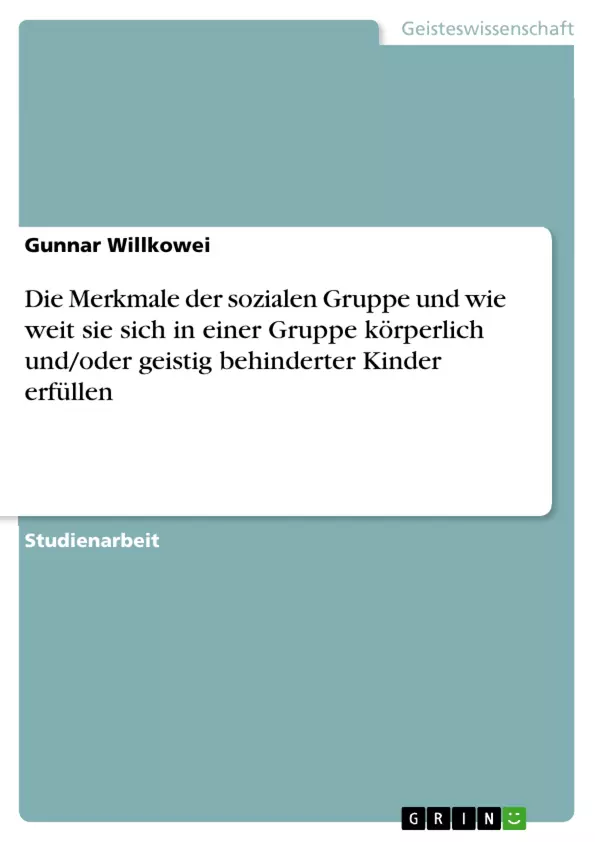Was macht eine Kindergartengruppe wirklich aus? Jenseits von bloßer Betreuung und Spielzeit verbirgt sich eine komplexe soziale Dynamik, die das Leben der Kinder auf tiefgreifende Weise prägt. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise in den Mikrokosmos einer solchen Gruppe, am Beispiel eines Sonderkindergartens für Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen. Es werden die subtilen Interaktionen, die Entwicklung von Beziehungen und die Entstehung von Gruppenverhalten analysiert. Anhand konkreter Beispiele aus dem Alltag der Kinder – Patrick, Raphaela, Sadek, Hilka und Jessika – wird die Theorie der sozialen Gruppe lebendig und greifbar. Dabei werden Fragen aufgeworfen wie: Inwiefern spiegeln sich die Merkmale einer sozialen Gruppe in einer Kindergartengruppe wider? Welche Rolle spielen Interaktion, Sympathie und Antipathie im Gruppenleben? Und wie können sozialpädagogische Maßnahmen das Gruppenverhalten positiv beeinflussen? Das Buch bietet nicht nur eine fundierte Analyse der Gruppenprozesse, sondern auch wertvolle Einblicke in die besonderen Herausforderungen und Chancen der Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für Erzieher, Sozialpädagogen, Eltern und alle, die sich für die Dynamik von Kindergruppen und die Förderung sozialer Kompetenzen interessieren. Erfahren Sie, wie aus einer Ansammlung von Individuen eine Gemeinschaft entsteht, in der jedes Kind seinen Platz findet und sich entfalten kann. Entdecken Sie die verborgenen Kräfte des Gruppengefüges und lernen Sie, diese gezielt einzusetzen, um die Entwicklung der Kinder optimal zu unterstützen. Dieses Buch ist ein Plädoyer für eine achtsame und wertschätzende Pädagogik, die die Einzigartigkeit jedes Kindes respektiert und gleichzeitig die Bedeutung der Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Es ist ein Wegweiser für alle, die Kinder auf ihrem Weg zu selbstbewussten und sozial kompetenten Persönlichkeiten begleiten wollen. Tauchen Sie ein in die vielschichtige Welt der Kindergartengruppe und lassen Sie sich von den Erkenntnissen und Erfahrungen inspirieren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Die Kindergartengruppe
3. Die Kennzeichen des Gruppenverhaltens
3.1. Das wesentliche Merkmal der sozialen Gruppe - Interaktion
3.2. Das Verhältnis zwischen der sozialen Gruppe und deren Umwelt
3.3. Bildungsbedingungen der sozialen Gruppe
3.4. Dasäußere System
3.5. Gegenseitige Abhängigkeit von Gefühlen, Aktivitäten und Interaktion
3.6. Das innere System
3.7. Die Entwicklung von Sympathie und Antipathie
3.8. Zusammengehörigkeitsgefühl durch gegenseitige Angleichung
3.9. Die Normenbildung in der sozialen Gruppe
3.10. DasRanggefüge in der sozialen Gruppe
3.11. Der Anführer der sozialen Gruppe
3.12. Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse
4. Anhang
4.1. Arbeitsgliederung
4.2. Literaturverzeichnis
1.Einführung
Was ist eine soziale Gruppe? Diese Frage scheint auf den ersten Blick ganz einfach: Menschen, die zusammen irgend etwas machen. Also zum Beispiel Leute, die zusammen Straßenbahn fahren oder im Stadion zusammen ein Fußballspiel anschauen. Nein, dem ist nicht so. Die Soziologie stellt für die Existenz einer sozialen Gruppe die Bedingung, dass eine Reihe von Personen in einer bestimmten Zeitspanne häufig miteinander Umgang hat. Ihre Personenanzahl ist so gering, dass jede Person mit allen anderen Personen in Verbindung treten kann. Dabei muss die Verbindung unmittelbar von Angesicht zu Angesicht stattfinden. Also sind die Fans im Stadion keine soziale Gruppe, weil ein Fan aus der Westkurve nicht mit einem Fan aus der anderen Ecke der Tribüne sprechen kann und nicht einmal nonverbal Kontakt zu ihm aufnehmen kann. Wie ist es mit den Straßenbahnfahrern? Mit dem Gegenüber könnte man schon Kontakt aufnehmen, doch nicht mit allen Fahrgästen. Außerdem ist die Zeitspanne der physischen Nähe nur so lange, wie die einzelnen Fahrgäste den selben Weg haben. Die Skatrunde jeden Samstag hingegen ist eine soziale Gruppe. Jeder tritt mit jedem in Verbindung, von Angesicht zu Angesicht. Die Zeitspanne der Geselligkeit ist nicht auf eine zufällige Zusammenkunft am selben Ort beschränkt, sondern findet jeden Samstagabend statt.
Für eine soziale Gruppe sind jedoch noch eine Vielzahl anderer Merkmale mehr kennzeichnend, als die bloße Aufnahme von Verbindungen zwischen einer Anzahl von Menschen. Welche Bedingungen aus der Umwelt bilden die Ausgangsbedingungen der Gruppe? Wie entfalten sich die Beziehungen in der Gruppe und durch welche Faktoren wird die Entfaltung beeinflusst. Welches Verhaltensmuster bildet sich in einer sozialen Gruppe? Diese Merkmale und Verhaltensweisen werde ich in meiner Hausarbeit zu beschreiben versuchen. Ich möchte es allerdings nicht dabei belassen, nur die soziologischen Erkenntnisse über die soziale Gruppe zu reproduzieren. Außerdem werde ich die Theorie über die soziale Gruppe, auf die Erfahrungen in meiner persönlichen Praxis übertragen.
Ich habe vor Beginn des Studiums Zivildienst in einem Sonderkindergarten für körperlich und/oder geistig behinderte Kinder, vornehmlich spastische Kinder, im Alter von 3-6 Jahren gemacht. Dabei war ich als Zivildienstleistender fest in die eingebunden. Zu meiner Gruppe gehörten fünf Kinder. Mit den Theorien über die soziale Gruppe im Hinterkopf stellt sich mir jetzt die Frage: Inwieweit lassen sich die
Kennzeichen und Verhaltensmerkmale der sozialen Gruppe in der Kindergartengruppe wiederfinden?
Wenn ich diese Frage ganz schnell und ohne Blick in die Tiefe der Gruppe beantworten soll, stelle ich fest, dass eigentlich die Theorie der sozialen Gruppe so nicht vorhanden ist, sondern nur in feinen Ansätzen und in nur ganz unwesentlichem Maße. Genau auf diese „Spuren“ der Gruppenmerkmale werde ich ebenfalls in meiner Hausarbeit eingehen. Die Feststellung, die Merkmale der sozialen Gruppe erfüllen sich nur in geringen Ansätzen, ist allerdings zu wenig. Deshalb will ich dazu noch Möglichkeiten aufzeigen, wie man sozialpädagogisch das Gruppenverhalten der Kinder fördern kann.
2. Die Kindergartengruppe
Von September 1997 bis September 1998 habe ich meinen Zivildienst in einem Sonderkindergarten abgeleistet. Der Kindergarten ist organisiert in einem kleinen Verein, der „Spastikerhilfe Leer“ heißt und vor ca. 25 Jahren gegründet wurde, weil in der ländlichen Region Ostfriesland im Nordwesten Niedersachsens keine Einrichtungen existierten, die behinderte Kinder förderten. Heute besteht die Einrichtung aus einer Sonderschule für Geistig- und Körperbehinderte, an der man den Hauptschulabschluss erwerben kann, und einem Sonderkindergarten, der aus drei Gruppen von je ca. sechs Kindern besteht. Die Kinder sind von leichten Körperbehinderungen bis zu mehrfachen Schwerstbehinderungen in den Gruppen so aufgeteilt, dass sie in ihren Fähigkeiten ungefähr gleich liegen, bzw. das Potential besteht, dass sie von den anderen Kindern in ihrer eigenen Entwicklung profitieren.
Ich habe während meiner Zivildienstzeit hauptsächlich zusammen mit einer Erzieherin und wechselnden Praktikanten in der Gruppe „Die Sterne“ gearbeitet. Die Gruppe bestand aus zwei Jungen und drei Mädchen. Sie heißen Patrick (4J), Raphaela (6J), Sadek (3J), Hilka(4J) und Jessika (6J).
Patrick hat seit seiner Geburt eine starke Spastik. In einem Bein ist die Sehne verkürzt. Er kann nicht laufen und ist entweder auf ein Hilfsmittel angewiesen, oder er muss sich immer irgendwo festhalten. Geistig ist er etwa auf dem Stand eines Eineinhalbjährigen. Er hat einen geringen Wortschatz und spricht undeutlich, kann
sich allerdings fast immer verständigen. Er macht ständig körperliche und geistige Fortschritte. Patrick ärgert sehr gerne die anderen Kinder und Erzieher(innen). Er nutzt seine relativ clevere Art aus, um andere hereinzulegen, sie zu Dummheiten anzustiften und sich dann zu freuen, wenn sie von den Gruppenleitern, also der Erzieherin (Silke) oder mir, zurecht gewiesen werden. Patrick ist sehr neugierig und hat selten Angst vor neuen Situationen.
Raphaela ist mit sechs Jahren relativ alt. Sie war schon im Kindergarten, als ich angefangen habe. Sie fasst zu anderen sehr schnell Vertrauen, nimmt jede neue Situation mit Interesse entgegen. Sie ist dabei allerdings nicht besonders ausdauernd. Deshalb ist es sehr schwer, ihr Dinge näher zu bringen, die beim Kennenlernen langweilig erscheinen. Raphaela bewegt sich sehr gerne und ist dabei fast unermüdlich.
Raphaela kann nicht sprechen. Sie sagt allenfalls Worte wie „Ja“, „Nein“, Puppe“,
„Pipi“. Dabei benutzt sie die Worte nicht immer sinngemäß. Raphaela versteht recht gut, was wir von ihr wollen, und sie kann sich auch mit den anderen Kindern einigermaßen verständigen.
Raphaela ist in den Kindergarten gekommen, ohne laufen zu können. Sie hat den ganzen Tag geschrieen und gegen das gemeinsame Essen mit Erbrechen protestiert. Jetzt ist sie sehr gut integriert, kann laufen und ist bei den anderen Kindern wie auch bei uns sehr beliebt.
Sadek war, als er neu in die Gruppe kam, nur sehr schwer zu integrieren. Er hat nur geweint und jede neue Situation mit sehr starkem Protest abzuwehren versucht. Sadek kann seine Bewegungen grobmotorisch nur ungenau kontrollieren. Er war nicht in der Lage zu laufen. Er reagiert allerdings sensibel auf Berührungen, indem er Gegenstände genau betrachtet und ihre Form und Beschaffenheit analysiert. Sadek kann nicht sprechen. Er macht willkürliche Laute, hat aber nach längerer Zeit herausgefunden, dass die Kinder und wir unterschiedlich darauf reagieren. Zum Teil ahmt er auch Laute nach, die man ihm gezielt vormacht. Er ist geistig etwa auf dem Stand eines acht Monate alten Jungen. Sadek macht motorisch einige Fortschritte. Er kann inzwischen einigermaßen mit einem Hilfsmittel laufen und fährt, zwar noch ohne richtig zu lenken, Dreirad.
Sadek hat vor neuen Situationen sehr viel Angst, vor allem, wenn er noch kein Vertrauen zu seiner Umwelt hat. Nachdem er zu uns eine Vertrauensbeziehung aufgebaut hat, begegnet er neuen Dingen mit weniger Skepsis. Wenn er die neue Situation einschätzen kann, findet er sehr schnell Gefallen daran.
Hilka ist von einem Regelkindergarten zur Spastikerhilfe gekommen. Sie ist starke Epileptikerin und sehr hoch mit Medikamenten eingestellt. In dem Regelkindergarten ist sie unter den anderen Kindern „untergegangen“. Diese Tendenz ist auch im Sonderkindergarten vorhanden. Sie ist gern mit sich allein beschäftigt, schläft viel, nimmt nur kurz an gemeinsamen Spielen teil und vermeidet den Kontakt zu den anderen Kindern. Sie empfindet die andern Kinder oft als störend. Hilka ist hinter ihrer matten und langsamen Fassade recht clever, sie kann sich mitteilen und nimmt an Tagen, an denen sie eine gute Form hat, viel auf. Aufgrund ihrer Medikamente baut sie körperlich immer mehr ab. Sie ist schlapp und will nach kurzen Spaziergängen wieder ihre Ruhe.
Jessika ist mehrfach schwerstbehindert. Sie sitzt in einem extra angefertigten Stuhl, muss gefüttert werden und kann nicht sprechen. Unwohlsein äußert sie mit schreien. Wohlsein wird erkennbar durch eine gewisse Ruhe, die sie ausstrahlt. Sie sitzt da, hält ihre Augen ganz ruhig, scheint zu beobachten und sieht entspannt aus. Jessika leidet unter sehr starken Kontrakturen. Aufgrund ihrer Spastik spannt sie ständig alle Sehnen und Muskeln an. Das hat sich, trotz großer therapeutischer Anstrengungen auf ihr Skelett ausgewirkt.
Zu Beginn meiner Arbeit im Kindergarten konnte man Jessika keine Situationsveränderung zumuten, bei Geräuschen erschrak sie sofort und begann zu schreien. Nach und nach akzeptierte Jessika immer mehr Lärm und auch neue Situationen. Sie kann auf Matratzen liegen, im Knautschsack und einer speziellen Schaukel sitzen.
Zu den anderen Kindern hat sie so gut wie keinen Kontakt. Haben die anderen Kinder Neugier an ihr gezeigt, wenn wir sie beispielsweise gewickelt oder massiert haben, haben wir die anderen Kinder für ihre Situation sensibilisiert. Wir haben den anderen Kinder erklärt, dass man sehr vorsichtig mit ihr umgehen muss und auf sie Rücksicht nehmen soll.
Jessika ist geistig nicht in der Lage zu erfassen, was um sie herum geschieht, wer die anderen Kinder sind und was sie machen. Sie hat nur zu uns, besonders zu mir, eine Vertauensbeziehung aufgebaut. Das Geschehen ist für sie nur grob zu überschauen.
3. Die Kennzeichen des Gruppenverhaltens
3.1. Das wesentliche Merkmal der sozialen Gruppe - Interaktion
Ob eine Ansammlung von Menschen als soziale Gruppe bezeichnet wird, orientiert sich an der Häufigkeit von Interaktion. Interaktion bedeutet, dass Menschen zusammen an etwas teilnehmen. Je öfter eine bestimmte Anzahl von Menschen in Verbindung tritt, sich austauscht, Umgang miteinander hat, also Interaktion betreibt, desto eher kann man bei diesen Interagierenden von einer sozialen Gruppe sprechen.
Wenn ich alle Kinder des Sonderkindergartens in der Häufigkeit gemeinsamer Interaktion beobachte, wird bald deutlich, dass bestimmte Kinder vermehrt Umgang miteinander haben. Es kristallisiert sich heraus, dass in dem Kindergarten die Kinder dreier Gruppen häufig untereinander Interaktion haben. Die Interaktion quer über die drei Gruppen ist jedoch recht selten. Also gliedert sich der Kindergarten in drei Gruppen, deren Mitglieder Interaktion haben.
3.2. Das Verhältnis zwischen der sozialen Gruppe und deren Umwelt
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Ziele, Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es wird eine sozialwissenschaftliche Forschung über Kindergartengruppen und Gruppenverhalten in der Kinderbetreuung vorgestellt.
Was wird in der Einführung (Kapitel 1) behandelt?
Die Einführung definiert, was eine soziale Gruppe ist und was sie von bloßen Ansammlungen von Menschen unterscheidet. Es wird auch die Absicht des Autors erklärt, die Theorie der sozialen Gruppe auf seine persönlichen Erfahrungen im Zivildienst anzuwenden, der in einem Sonderkindergarten geleistet wurde.
Wer waren die Kinder in der Kindergartengruppe (Kapitel 2)?
Im Kapitel 2 werden die Kinder der Gruppe "Die Sterne" vorgestellt: Patrick (4 Jahre alt, spastisch, geistig etwa auf dem Stand eines Eineinhalbjährigen), Raphaela (6 Jahre alt, kann nicht sprechen, aber gut integriert), Sadek (3 Jahre alt, kann seine Bewegungen grobmotorisch nur ungenau kontrollieren, geistig etwa auf dem Stand eines acht Monate alten Jungen), Hilka (Epileptikerin, vermeidet den Kontakt zu anderen Kindern) und Jessika (mehrfach schwerstbehindert, kann nicht sprechen).
Was sind die Kennzeichen des Gruppenverhaltens (Kapitel 3)?
In Kapitel 3 werden die Kennzeichen des Gruppenverhaltens aus soziologischer Sicht vorgestellt, mit besonderem Hinblick auf Interaktion, das Verhältnis zwischen der sozialen Gruppe und ihrer Umwelt, sowie die Einflüsse von Aktivitäten, Gefühlen und gegenseitigen Beziehungen. Es wird auch auf das soziale System eingegangen.
Was bedeutet "Interaktion" im Kontext einer sozialen Gruppe?
Interaktion bedeutet, dass Menschen gemeinsam an etwas teilnehmen. Je häufiger eine bestimmte Anzahl von Menschen in Verbindung tritt, sich austauscht und Umgang miteinander hat, desto eher kann man von einer sozialen Gruppe sprechen.
Was versteht man unter dem Verhältnis zwischen der sozialen Gruppe und ihrer Umwelt?
Das Verhältnis zwischen der Gruppe und ihrer Umwelt ist nicht klar definiert. Die Aktivitäten, Interaktionen und Gefühle der Gruppenmitglieder konstituieren zusammen mit den gegenseitigen Beziehungen dieser Elemente das, was als soziales System bezeichnet wird. Alles, was nicht Teil des sozialen Systems ist, gehört zur Umwelt.
Was ist der Anhang?
Der Anhang enthält die Arbeitsgliederung und das Literaturverzeichnis.
- Citation du texte
- Gunnar Willkowei (Auteur), 1999, Die Merkmale der sozialen Gruppe und wie weit sie sich in einer Gruppe körperlich und/oder geistig behinderter Kinder erfüllen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102853