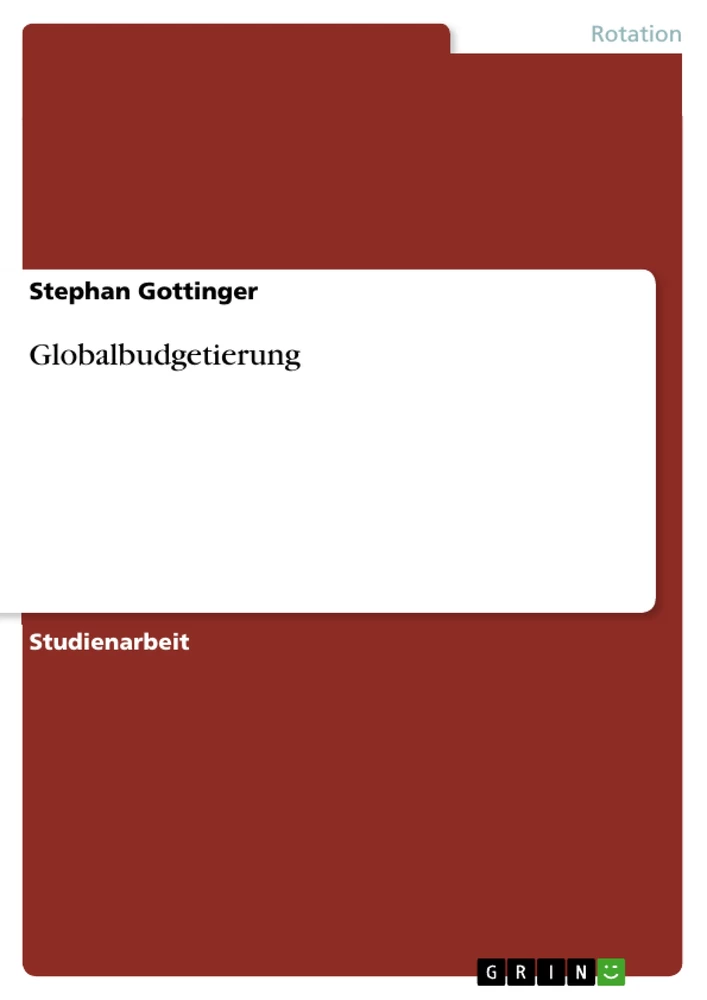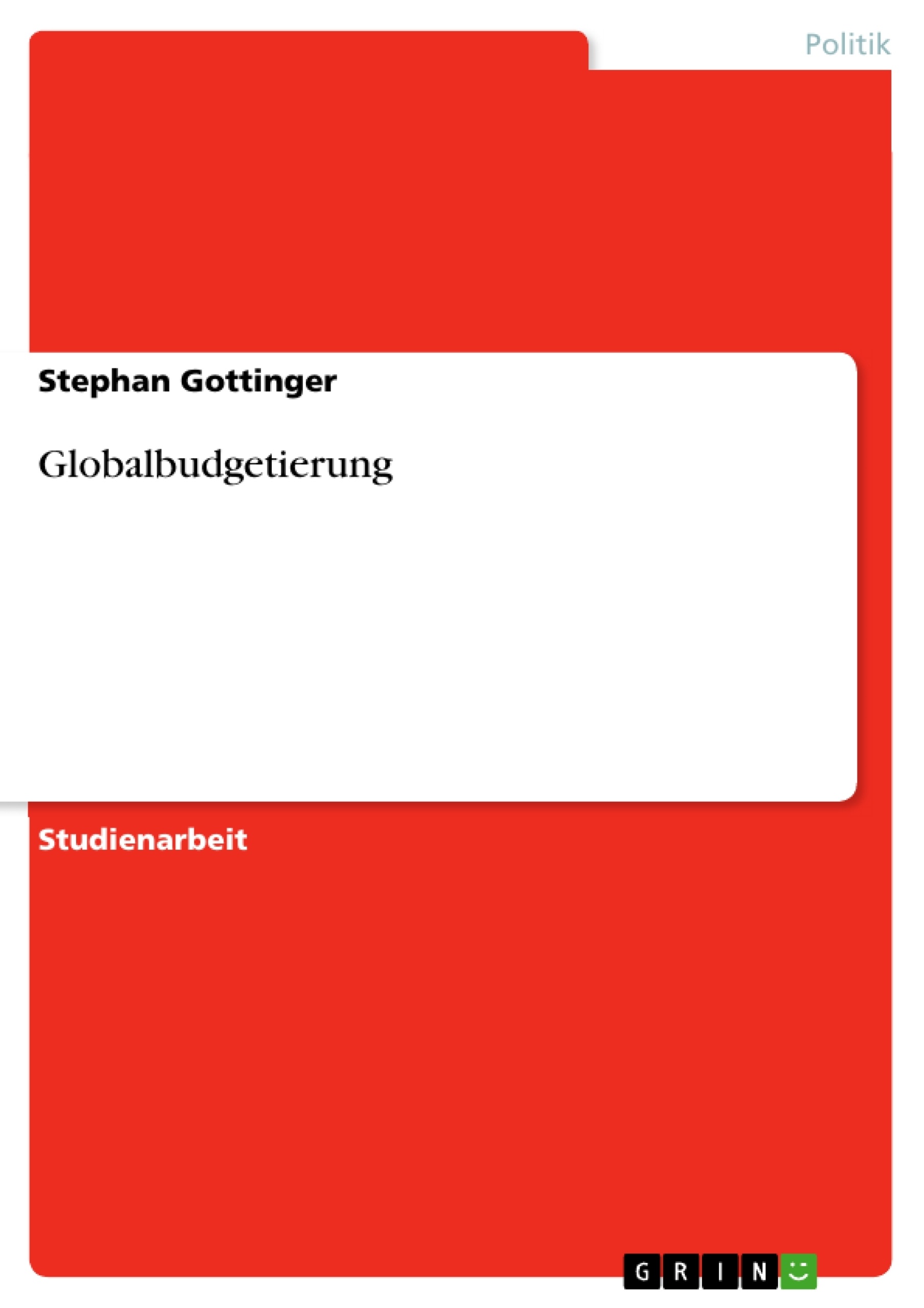Stellen Sie sich vor, Sie könnten die komplexen Mechanismen des österreichischen Haushaltswesens mühelos durchschauen und die Prinzipien der Globalbudgetierung in der öffentlichen Verwaltung verstehen. Dieses Buch öffnet Ihnen die Tür zu einer Welt, in der Budgetgrundsätze wie Vorherigkeit, Jährlichkeit und Vollständigkeit nicht länger bloße Schlagworte sind, sondern lebendige Instrumente zur Gestaltung einer effizienten und transparenten Verwaltung. Tauchen Sie ein in die Feinheiten des Budgetkreislaufs, von der Voranschlagserstellung bis zur Rechnungsprüfung, und entdecken Sie die vielfältigen Ansätze für Reformen, die darauf abzielen, die ökonomische Zielsetzung in der Haushaltsplanung zu stärken. Erfahren Sie, wie das Neue Steuerungsmodell (NSM) und die Globalbudgetierung die Verantwortlichkeit vergrößern, den Entscheidungsspielraum erweitern und die Produktorientierung im Finanzmanagement fördern. Anhand von Fallbeispielen, wie der Einführung von NSM in Hamburg, werden die theoretischen Konzepte mit der Realität verknüpft, sodass Sie die Herausforderungen und Chancen der Verwaltungsmodernisierung hautnah miterleben können. Untersuchen Sie die Rolle der Finanzbehörde, der Polizeibehörde und der Behörde für Wissenschaft und Forschung bei der Umsetzung von Globalbudgets und lernen Sie, wie Verwaltung im Wettbewerb bestehen kann. Dieses Buch ist Ihr unverzichtbarer Leitfaden, um die Instrumente der wirkungsorientierten Verwaltungsführung zu beherrschen, die Preisberechnung für öffentliche Leistungen zu optimieren und die budgetäre Behandlung kommerzieller Produkte zu verstehen. Es bietet Ihnen das Rüstzeug, um die komplexen Zusammenhänge zwischen Budgetierung, Leistungssteuerung und politischer Verantwortung zu durchdringen und aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen öffentlichen Verwaltung mitzuwirken. Lassen Sie sich von praxisnahen Beispielen und fundierten Analysen inspirieren und entdecken Sie das Potenzial der Globalbudgetierung für eine effizientere und bürgernähere Verwaltung in Österreich und darüber hinaus. Entdecken Sie, wie Reservebildungen gehandhabt werden können und welche Grundregeln für die Produktfinanzierung über Ausgleichszahlungen gelten. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Public Management, Verwaltungsreformen und die Zukunft des öffentlichen Sektors interessieren.
Inhalt
1. Haushaltswesen in Österreich
1.1. Budgetgrundsätze
1.1.1. Vorherigkeit,Jährlichkeit & Fälligkeit
1.1.2. Vollständigkeit
1.1.3. Spezialität
1.1.4. Haushaltsausgleich
1.1.5. Publizität
1.1.6. Wirtschaftlichkeit & Sparsamkeit
1.2. Haushaltsgliederung
1.3. Budgetkreislauf
1.4. Ansätze für Reformen
2. NSM und Globalbudgetierung
2.1. Neues Steuerungsmodell
2.2. Globalbudgetierung
2.2.1. Varianten der Globalbudgetierung
2.2.2. Umfang der Globalbudgetierung
2.2.3. Ebenen der Globalbudgetierung
2.2.4. Reservebildung
2.3. Obligatorische und Kommerzielle Produkte im Budget
2.3.1. Preisberechnung
2.3.2. Berechnung der Konraktsumme
2.3.3. Kommerzielle Produkte
3. Fallbeispiele
3.1. NSM und Globalbudgetierung in Hamburg
3.1.1. Die Rolle der Finanzbehörde
3.1.2. Die Rolle der Polizeibehörde
3.1.3. Die Rolle der Behörde für Wissenschaft und Forschung
3.2. Verwaltung im Wettbewerb
Quellenverzeichnis
1. Das Haushaltswesen in Österreich
Als Einführung in den Themenbereich der Globalbudgetierung soll zu Beginn ein kurzer Überblick über das öffentliche Haushaltswesen in Österreich gegeben werden. Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, da dadurch das Verständnis für Zusammenhänge im Bereich Globalbudgetierung besser verdeutlicht werden können.
Die grundsätzliche Form und Gliederung von Voranschlägen und Rech- nungsabschlüssen ist in der Verordnung vom 15. Juli 1974 im BGBl.Nr.493/1974 geregelt. Durch eine Revision im Jahre 1997 - fest- gehalten im BGBl.Nr.369/1999 - wurden bis dahin gemachte Erfahrungen berücksichtigt.
Oberstes Ziel des Haushaltswesens ist der Nachweis des Deckungserfol- ges und Deckungsverlaufes. Unter Deckungserfolg versteht man das Ausmaß der endgültigen Deckung der Ausgaben im ordentlichen Haus- halt, unter Deckungsverlauf den Prozeß der endgültigen Deckung aller Ausgaben. Dies deutet auch auf eine Bevorrangung von finanzwirtschaftli- chen vor betriebswirtschaftlichen Zielen. Weiteres besonderes Kennzei- chen des öffentlichen Haushaltswesens ist die strenge Einhaltung der Haushaltsgrundsätze oder auch sogenannten Budgetprinzipien. In diesem Zusammenhang muß auch dezitiert darauf hingewiesen werden, daß die- se nicht nur zur formal ordnungsgemäßen Verwaltungsführung dienen, sondern diese auch effizienter gestalten sollen. Zum besseren Verständ- nis sind diese nachfolgend in detailierter Form dargestellt.
1.1. Budgetgrundsätze
Im Folgenden sollen einzelne wichtige Aspekte, welche bei der Erstellung eines Budgets eine tragende Rolle spielen, kurz erläutert werden, um den den Vorgang der Haushaltsplanung besser verstehen zu können. (aus: Klug, 2000)
1.1.1. Vorherigkeit, Jährlichkeit & Fälligkeit
Diese 3 Begriffe nehmen Bezug auf zeitliche Zusammenhänge die für das Budget ausschlaggebend sind. Zum Ersten ist der Voranschlag für das betreffende Finanzjahr im vorhinein zu beschließen. Des weiteren sind alle Einnahmen und Ausgaben in dem Jahr zu veranschlagen in dem diese fällig werden. Als fällig können in diesem Zusammenhang alle Verpflich- tungen und Forderungen, welche aus Lieferungen und Leistungen entste- hen, bezeichnet werden, sofern sie auch bis Jahresende des betreffenden Jahres erbrachten wurden.
1.1.2. Vollständigkeit
Dieser Begriff besagt im Grunde genommen nur, daß alle für das kommende Haushaltsjahr fälligen Einnahmen und Ausgaben brutto in den betreffenden Voranschlag aufzunehmen sind.
In diesem Zusammenhang sind auch weitere Kriterien für einen Budgetvoranschlag von Bedeutung:
- Wahrheit
- Klarheit & Übersichtlichkeit
- Bruttoverrechnung
- Genauigkeit
- Einzelveranschlagung
- Einheitlichkeit
Des weiteren sind in diesem Zusammenhang die Begriffe der Verstär- kungsmittel und der Verfügungsmittel anzuführen. Erstere dienen zur Be- deckung unabwendbarer Mehrausgaben des ordentlichen Haushalts, zweitere der Deckung von Ausgaben, denen eine besondere Zweckbe- stimmung fehlt.
1.1.3. Spezialität
Der Begriff der Spezialität gibt Hinweis über die Budgetbindung der Verwaltung. Dabei ist zwischen drei Begriffen zu unterscheiden:
- qualitative Spezialität
- quantitative Spezialität
- zeitliche Spezialität
Die qualitative und quantitative Spezialität werden auch oftmals unter dem Oberbegriff der sachlichen Spezialität zusammengefaßt. Erstere besagt, daß Budgetmittel nur für den vorhergesehenen Zweck, zweitere nur in der angegebenen Höhe verwendet werden dürfen. Die zeitliche Spezialität schränkt die Mittelverwendung auf die jeweilige Periode ein.
Um aber die wirtschaftliche Beweglichkeit aufrechtzuerhalten und auch unter dem Finanzjahr noch Veränderungen durchführen zu können, sind einige Ausnahmeregelungen getroffen worden:
- Die Deckungsfähigkeit besagt, daß Mehrausgaben bei einer Kosten- stelle durch Einsparungen bei einer anderen Kostenstelle bei gleichzei- tiger Einhaltungen der Gesamthöhe des Budgets ausgeglichen werden können. Diese Gegendeckung kann sowohl ein- als auch gegenseitig erfolgen, sofern auch ein verwaltungsmäßiger und sachlich- ökonomischer Zusammenhang besteht.
- Fallen im laufenden Budgetjahr außer- oder überplanmäßige Ausga- ben an, so können diese durch Ausnahme der Deckungsfähigkeit aus- geglichen werden. Bei der Kreditübertragung werden Beträge für ande- re als zweckmäßig vorgesehene Bestimmungen verwendet. Die Kre- ditüberschreitung verlangt die Deckung der Mehrausgaben durch Mehreinnahmen, Verstärkungsmittel, Rücklagen und Darlehen.
- Nicht verbrauchte Haushaltsreste können darüber hinaus durch Bil- dung von Rücklagen auf das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden, wenn bereits beschlossene Vorhaben noch nicht durchgeführt worden sind.
1.1.4. Haushaltsausgleich
Ziel ist, daß die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt sind. Dieses fi- nanzielle Gleichgewicht durch die ständige Überwachung des Haushalts. Der Grundsatz der Gesamtdeckung wird weiters durch die Tatsache, daß alle ordentlichen Einnahmen zur Ausgabendeckung heranzuziehen sind, eingehalten.
1.1.5. Publizität
Dieser Grundsatz besagt, daß alle den Haushalt betreffenden Entscheidungen in öffentlichen Sitzungen getroffen werden müssen. Darüber hinaus müssen alle das Budget betreffenden Regelungen zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegen.
1.1.6. Wirtschaftlichkeit & Sparsamkeit
Hierbei liegt das Augenmerk bei der Haushaltserstellung. In deren Verlauf sind die Voranschlagsbeträge möglichst genau zu eruieren und auch sparsam zu bemessen. Ein Einsatz von Kosten- und Investitionsrechnungsmodellen ist daher sehr hilfreich um Schwankungen bei der obligatorischen Abweichungsanalyse zu vermeiden.
1.2. Die Haushaltsgliederung
Das Budget eines Finanzjahres wird in den ordentlichen und in den außerordentlichen Haushalt unterteilt.
Der ordentliche Teil umfaßt die periodische wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben eines Budgetbereiches. Der außerordentliche Abschnitt beinhaltet alle Ausgaben und Einnahmen die durch einmalige Ereignisse entstehen. Dem ordentlichen und außerordentlichen Teil ist ein sogenann- ter Haushaltshinweis mit Ansatz vorausgestellt. In diesem sind die einzel- nen Ansätze in zehn Gruppen (0-9) unterteilt. Die sogenannte Post schlüsselt in Anlehnung an den Kontenrahmen einzelne Bereiche weiters in 10 Gruppen auf.
1.3. Der Budgetkreislauf
Die einzelnen Schritte die beim Durchlaufen eines Haushalts auftreten sollen im folgenden kurz erläutert werden.
Nach der Voranschlagserstellung und dessen Beschlußfassung durch politische Organe folgt die Ausführung des Voranschlags durch die zuständigen Verwaltungsbehörden. Nach diesem Vollzug kommt es mit der Rechnungslegung zum Rechnungsabschluß am Ende des Finanzjahres. Die Kontrolle und Überprüfung ob alle Vorgaben auch eingehalten wurden erfolgt durch den Rechnungshof.
1.4. Ansätze für Reformen
Stand früher die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Haushalts im Vordergrund, welche Herkunft und Verwendung öffentlicher Gelder, der Planablaufvergleich und Vollzugs- und Kontrollfunktion im Mittelpunkt sah.
Neuerdings rückt jedoch die ökonomische Zielsetzung bei der Haus- haltsplanung immer mehr in den Vordergrund. Dabei wird die Wirkung von wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf Wirtschaftswachstum, Infra- strukturbereitstellung oder Strukturpolitik ermittelt. Diese Reformbestre- bungen führen dazu, daß an Stelle des ordentlichen und außerordentli- chen Haushalts ein laufender Verwaltungshaushalt und ein Investitions- bzw. Vermögenshaushalt tritt. Dies hat ein Abgehen vom Grundsatz der Einzeldeckung hin zum Gesamtdeckungsgrundsatz zur Folge. Des weite- ren stellt sich die Frage der Sinnhaftigkeit der Jährlichkeit bei der Haus- haltsplanung. An deren Stelle kann eine mehrjährige mittelfristige Finanz- planung treten, welche aber mit dem Problem der Einnahmen- und Aus- gabenschätzung konfrontiert ist.
Hier kommt der Ansatz der Globalbudgetierung zum Tragen, welcher sicherlich ein adäquates Instrument zur besseren Haushaltsführung darstellt und in den folgenden Abschnitten detailiert erläutert werden soll.
(aus: Klug, 2000)
2. Neues Steuerungsmodell & Globalbudgetierung
Im Zuge der wirkungsorientierten Verwaltungsführung gibt es einige Instrumente, welche zur Verbesserung der bei der Arbeit in der öffentlichen Verwaltung beitragen können. Im Zuge dieses New Public Managment stehen Kunden- und Mitarbeiterorientierung, Qualitätsbewußtsein, Wettbewerb, Wirkungskontrolle, Dezentralisation und Änderung der Verwaltungskultur im Blickpunkt der Reformbestrebungen.
Das wesentlichste Element dieser wirkungsorientierten Verwaltungsfüh- rung ist die Outputsteuerung durch Globalbudgetierung nach Produk- tegruppen, welche die bisherige Detailbudgetierung nach Ausgabenposten ersetzen soll. Diese Globalbudgets verlangen nach zusätzlichen Angaben über Ziele und Leistungsstandards und -indikatoren, welche der Informa- tion des Parlaments im Budgetbeschluß dienen. Es stehen zwar weniger aber dafür qualitativere Aussagen und Information über das Budget zur Verfügung. Um diese auch dementsprechend verarbeiten und auswerten zu können, müßte die Organisationsstruktur des Parlaments mit soge- nannten Fachkommissionen, welche sich zusätzlich zur Finanzkomponen- te auch mit einer Leistungskomponente befassen, ergänzt werden.
(aus: Zimmerli 1997)
2.1. Neues Steuerungsmodell
Mit der Einführung eines Globalbudgets werden folgende Zwecke im Be- reich des Finanzmanagments einer wirkungsorientierten Verwaltungsfüh- rung verfolgt:
- Vergrößerung der Verantwortlichkeit
- Vergrößerung des Entscheidungsspielraumes
- Verkürzung der Entscheidungswege
- Produktorientierung im finanziellen Managment
In diesem Zusammenhang muß aber deutlich gemacht werden, daß die alleinige Einführung der Globalbugetierung ohne gleichzeitige Leistungssteuerung nicht sinnvoll ist. Daher gilt der Grundsatz: Kein Globalbudget ohne Leistungsvereinbarung.
2.2. Globalbudgetierung
Diese sogenannte Dezentralisierung der Ressourcenkompetenzen erfordert eine Abweichung von den bisher geltenden Prinzipien, was eine neue Betrachtungsweise vieler Ansätze beinhaltet.
Die qualitative Budgetbindung verschwindet, da durch Aufgabe der Spezifikation die detaillierte Aufgabengliederung fehlt. An deren Stelle wird im Produktbereich die Kontraktsumme mit einzelnen Produktgruppen ver- knüpft.
Des weiteren ist nur mehr die Kontraktsumme, an welche der Leistungs- erbringer jedoch strikt gebunden ist, mit der quantitativen Budgetbin- dung zu behandeln. Sollte die geplante Leistungssumme nicht eingehal- ten werden können, muß wie bisher ein Nachtragskredit eingehalten wer- den.
Die zeitliche Budgetbindung, welche das Übertragen von Kreditresten auf das Folgejahr verbietet, wird vollständig aufgehoben. Einzige Voraus- setzung für eine Übertragung ist die fertige Erstellung der vereinbarten Leistung. Damit wird vor allem dem Ausschöpfen von Budgetresten am Jahresende, dem sogenannten Dezemberfieber, und dem damit verbun- denen Vornehmen von unnotwendigen Investitionen, sinnvoll entgegen- gewirkt.
Des weiteren wird auch das Bruttoprinzip fallengelassen, da nur mehr die tatsächlichen Nettoaufwendungen für einzelnen Produktgruppen von Bedeutung sind. Dagegen bleiben das Prinzip der Rechnungslegung und die Grundsätze kaufmännischer Rechnungslegung voll wirksam.
Da beim Globalbudget eine mehrjährige Finanz- und Leistungsplanung als wesentlicher Schwerpunkt gelten, muß der Grundsatz der Jährlichkeit ebenfalls in Frage gestellt werden, da ja die jährliche Budgetsteuerung in den Hintergrund gedrängt wird.
Wie daher ersichtlich ist, ist die Idee der Globalbudgetierung kein vollkommener Neuansatz, sondern lediglich eine Anpassung bzw. Verbesserung bereits bestehender Regelung mit Rücksichtnahmen auf aktuelle volks- und politikwirtschaftliche Entwicklungen.
2.2.1. Varianten der Globalbudgetierung
Da die Neuerungen des bisher gültigen Haushaltssystems mit unter- schiedlicher Intensität durchgeführt werden können, gibt es auch unter- schiedliche Ausprägungen des Globalbudgets. Diese werden im folgenden erläutert. Dabei gibt vor allem die budgetäre Behandlung der einzelnen Detailpositionen Ausschlag darüber, welcher Form zugeordnet werden kann.
Bei der ersten Form spricht man vom sogenannten Globalkredit. Dabei werden die einzelnen Detailpositionen zu wichtigsten Aufwandsarten zu- sammengefaßt. Dies läßt nur sehr wenig Spielraum bei der Budgetgestal- tung zu, da der größte Posten (i.d.R. Personalaufwendungen) unverändert bleibt. Da die inputorientierte Steuerung nach wie vor weitergeführt wird, kann man zwar von einem kleinen Schritt in die richtige Richtung spre- chen, aber die echte Veränderungen werden nicht vorgenommen.
Eine erweiterte Form stellt die Zusammenfassung der Aufwand- und Ertragsseite der einzelnen Detailpositionen zu einem Posten dar. Diese Wahrung des Bruttoprinzips schränkt die Flexibilität nach wie vor ein, da die Gesamtsumme der Aufwendungen nach oben beschränkt ist. Einzig der Führungsgrad der Verwaltung ist größer, da zwischen einzelnen Posi- tionen verschoben werden kann. Auch fördert die Zusammenfassung von kleinen Detailpositionen zu einer gemeinsamen größeren Position das Erreichen der Effizienzsteigerung. Dies bringt zwar Flexibilität in die Verwaltung, weitere Anstrengungen werden aber nicht forciert, da zusätzliche Mittel sowieso nicht verfügbar werden.
Die effizienteste Form ist sicherlich die Nettobudgetierung. Dabei werden alle Detailpositionen der laufenden Tätigkeiten zu einer einzigen Position zusammengefaßt. Somit entsteht maximale Flexibilität bei der Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel, da unter Umständen Outsourcing zum Entstehen von Einsparungen beiträgt, welche dann unabhängig neu zugeteilt werden können. Dies schafft natürlich große Anreize für einzelne Verwaltungseinheiten, da diese im Großen und Ganzen autonom über Mittel verfügen können und die Einnahmen im Bedarfsfall auch durch ei- gene Aktivitäten erhöhen können.
2.2.2. Umfang der Globalbudgetierung
Eine konsequente Einführung der Globalbudgetierung hat aber auch zur Folge, daß Leistungsbezieher neu zu verrechnen sind und womöglich Leistungslieferanten aus dem Budget herausfallen, da sich inbesondere interne Lieferanten oftmals zu 100% aus der internen Verrechnung finanzieren.
2.2.3. Ebenen der Globalbudgetierung
Da sich wie bereits erwähnt Verwaltungseinheiten über interne Verrech- nung finanzieren können, wäre der Verzicht auf einige Teile von bisher geführten Budgets denkbar. Welche Ebenen dies betreffen könnte wird im folgenden erläutert.
Im Bereich der normativen Ebene ist ein Verzicht auf alle internen Funk- tionen auf alle Fälle möglich. In dieser Vereinbarungsebene zwischen Re- gierung und Parlament wird das zu beratende Budget von wesentlich ge- ringerem Umfang sein, da sogenannte Querfunktionen bereits in den Pro- duktkosten enthalten sind. Dies hat zur Folge das Detailfragen nicht mehr von Parlament und Regierung sondern vom Verwaltungsmanagment ge- klärt werden. Das Budget enthält somit nur die einzelnen Produktgruppen, deren angestrebten Wirkungen und die finanzielen Aufwendungen.
Der Schwerpunkt der Regierungsarbeit ist nunmehr im Bereich der Ebene der Leistungsaufträge. Das Ziel der Regierung muß es sein, das Dienstleistungsunternehmen Verwaltung auf dem richtigen Kurs zu halten. Instrument für diese Aufgabe sind Richtlinien für Querschnittsfunktionen, welche nicht nach außen in Erscheinung treten aber für die Leistungs- und Produkterstellung wesentliche Beiträge leisten.
Auf der Ebene der Kontrakte wird eine detailiertere Betrachtung vorgenommen. Hier werden die Querschnittsfunktionen mit den dazugehörigen Angaben über die Verrechnungspreise genauer betrachtet.
2.2.4. Reservebildung
Da ja bei der Globalbudgetierung die Grundsätze der Jährlichkeit und der zeitlichen Bindung aufgehoben sind, besteht nunmehr die Möglichkeit nicht benützte Kredite auf das Folgejahr zu übertragen. Dies wäre über die Bildung von Reserven auf eigens dafür vorgesehenen Konten in der Be- standsrechnung durchaus möglich. Gefahr besteht nur darin, daß einzelne Verwaltungseinheit über möglicherweise große Reserven verfügen wür- den, währenddessen das Gesamtbudget ein Defizit aufweisen könnte. Würde dann die Regierung die vorhanden Reserven zur Deckung des Ge- samtdefizites heranziehen, wäre der Grundgedanke der Globalbudgetie- rung wieder ad absurdum geführt.
2.3. Obligatorische und Kommerzielle Produkte im Budget
2.3.1. Preisberechnung
Schwerpunkt der Arbeit mit Leistungsvereinbarungen ist die Gestaltung der Preise, als Basis für Ausschreibungen und Kontraktabschlüsse. Da diese noch nicht genau ermittelbar sind, müßte mit Normkosten, welche aber aufgrund fehlender Vergleichsmöglichkeiten oftmals schwer eruierbar sind, kalkuliert werden. Daher müßte in der Einführungsphase mit Erfah- rungsdaten, welche Kosten- und Leistungsdaten verbinden, gearbeitet werden. Erst in der zweiten Einführungsphase sind sinnvolle Vergleiche unter den Verwaltungseinheiten möglich. Dann kann der Kostenansatz über Normkosten sinnvoll durchgeführt werden. Es ist aber zu erwarten, daß diese Entwicklung erst nach einigen Jahren vollständig eingeführt werden kann.
2.3.2. Berechnung der Kontraktsumme
Für die sinnvolle Budgetverwaltung ist aber nicht nur die Berechnung der Preise, sondern auch die Berechnung der Kontraktsumme von Bedeutung. Um flexibel auf unvorhergesehene Mengenabweichungen reagieren zu können, ist es sinnvoll mit einer variablen Kontraktsummenberechnung zu arbeiten. Diese könnte entweder rein variabel oder aber auch gemischt mit variabel mit einem Fixanteil zur Sicherung eines Bereitschaftspreises be- rechnen.
Treten allerdings enorme Mengenabweichungen auf, welche über das Globalbudget nicht mehr abgefangen werden könnte, müßte die Verwaltungseinheit auf jeden Fall über Nachtragskredite ausfinanzieren, obwohl diese Lösung als nicht modellkonform angesehen werden muß.
Die Produktfinanzierung über Ausgleichszahlungen sollte aber gewissen Grundregeln unterliegen. Wichtig wäre vor allem die Tatsache, daß diese Ausgleichszahlungen durch den Leistungserbringer selbst durch Erfüllung der Berechtigungskriterien beeinflußbar sind. Dazu müßten diese als Erträge in den Leistungskontrakt aufgenommen werden.
Ausgleichszahlungen, welche ihre Begründung durch Vereinbarungen zwischen Verwaltungseinheiten hätten, dürften allerdings nicht in die Kontraktsummen aufgenommen werden, da ein gewisses vor allem politisches Risiko vom Gemeinwesen selbst zu tragen sein sollte.
2.3.3. Kommerzielle Produkte
Da im Zuge der Einführung der wirkungsorientierten Verwaltungsführung die Verwaltungseinheiten auch in gewissem Umfang kommerziell tätig sein sollen, muß natürlich die budgetäre Behandlung der damit verbundenen Einnahmen und Ausgaben geregelt werden. Der Grund für diese kommerzielle Tätigkeit liegt in der Schaffung von einer gewissen finanziellen Unabhängigkeit gegenüber der Regierung.
Ein Problem besteht jedoch in der Konkurrenzsituation, in der sich die Verwaltungseinheit gegenüber privaten Anbietern derselben Dienstleis- tungen befindet. Der in diesem Zusammenhang entstehende Klärungsbe- darf bezüglich Wettbewerbsverzerrung stellt ein nicht zu unterschätzendes Problem dar. Vor allem die Möglichkeit der sogenannten Quersubventio- nierung der Angeboten Leistungen würde gegenüber privaten Anbietern unübertreffbare Vorteile bringen. Eine Lösung dieses Problems kann durch zwei Herangehensweisen herbeigeführt werden. Erste Möglichkeit wäre die Preisfestlegung mittels Vollkostenrechnung, was aber wiederum die freie Preisgestaltung beeinträchtigen würde, da viele privaten Anbieter oftmals nur eine Deckungsbeitragskalkulation vornehmen. Um hier gleich Voraussetzung wäre die weitaus praktikablere zweite Möglichkeit die Vor- schreibung von angemessenen Deckungsbeiträgen. Damit würden auch über Steuereinnahmen finanzierte Mittel in vollem Umfang entschädigt werden und in das Budget des Gemeinwesens zurückfließen.
Da nun aber unternehmerisches Denken und Handeln in Verwaltungsein- heiten einen Schwerpunkt bei der Einführung des Globalbudgets darstellt, muß hier eine wettbewerbskonforme Lösung gefunden werden, welche ihre besten Ansätze zweifelsohne in der Deckungsbeitragskalkulation fin- det. (aus: Schedler 1996)
3. Fallstudien
Um die im bisherigen Verlauf angeführten theoretischen Ausführung auch mit praktischen Beispielen zu verdeutlichen, sind im nachfolgenden Ab- schnitt 2 aktuelle Anwendungen aus dem Themenkreis NSM und Global- budgetierung dargestellt. Dabei wurde versucht, das breite Spektrum die- ses Sachgebietes durch Darstellung sehr unterschiedlicher Fallbeispiele zu veranschaulichen.
3.1. NSM und Globalbudgetierung in Hamburg
Im folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse eines Projektseminars zu Thema „NSM und Globalbudgetierung“, welches im Wintersemester 1997/98 am Institut für Finanzwissenschaften der Universität Hamburg durchgeführt wurde, dargestellt werden.
Um eine möglichst guten Einblick zu gewinnen wurden drei unterschiedli- che Bereiche des Öffentlichen Sektors zur genaueren Untersuchung aus- gewählt:
- die Finanzbehörde, weil sie selbst mit der Projektgruppe „Verwaltungs- innovation“ maßgeblich an der Einführung von NSM in Hamburg betei- ligt war.
- die Polizeibehörde, weil deren Aktivitäten die klassischen Staatsaufga- ben im hoheitlichen Kernbereich darstellen.
- Die Behörde für Wissenschaften und Forschung, weil gerade in diesem Bereich die Qualitätskriterien und Quantifizeirungen nur sehr schwer vorzunehmen sind.
In diesem Zusammenhang sollte auch die enorme Wichtigkeit des Perso- nalwesens bei der Einführung von NSM erwähnt werden. Hier ist die Ak- zeptanz und die aktive Unterstützung durch die Mitarbeiter der Verwaltung von entscheidender Bedeutung. Auch im Zusammenhang mit Qualitäts- managment spielen die Mitarbeiter letztendlich die entscheidende Rolle. Daher liegt die Aufgabe der Personalentwickler darin, das Qualitätsbewußtsein der Mitarbeiter zu wecken. Diese Förderung der Mitarbeitermotivation ist fast ausschließlich mit neuen Anreizstrukturen zu verwirklichen. Dabei muß auf die Abstimmung zwischen den Interessen der Auftraggeber und der des Personal geachtet werden.
3.1.1. Die Rolle der Finanzbehörde
In diesem Bereich war die versuchte Einführung von NSM von großer Bedeutung, da ja die Finanzbehörde das Beispiel für einen klassischen Verwaltungsbereich darstellt.
Als positives Ergebnis der Reformbestrebungen müssen an dieser Stelle eine gewisse Rationalisierungswirkung, eine erhöhte Mitarbeitermotivation und mehr Bürgernähe angeführt werden. Größtes Manko ist die Vernach- lässigung des Berichtswesens, was aber mit einer geplanten stellenmäßi- gen Vollauslastung eine Verbesserung erfahren wird. Die gewonnen Er- kenntnisse, welche in Zusammenhang mit der Einführung von NSM ge- macht werden konnten, lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Die Grundzüge des NSM sind klar umgesetzt worden.
- Die Gobalbudgetierung bleibt im wesentlichen auf die Betriebsmittel und Personalausgaben beschränkt.
- Die Produktdefinitionen und das Kontraktmanagment bedarf noch einer Verbesserung der getätigten Ansätze.
- Durch Einschränkung der zentralen Steuerung sind wie anderswo auch Konflikte zwischen zentralen Stellen und Fachbereichen zu erwarten.
- Die Personalentwicklung hat sich im Wesentlichen auf Fortbildungs- maßnahmen beschränkt, was aber einem Mangel an finanziellen Mittel zuzuschreiben ist.
Im Personalbereich muß noch am Bewußtsein der Mitarbeiter gearbeitet werden, da Tendenzen bestehen die Globalbudgetierung als reines Kon- solidierungsinstrument zur Entspannung der Haushaltslage zu sehen. Des weiteren sollte Motivation und Verständnis der Mitarbeiter für NSM aufrechterhalten und auch verstärkt werden.
3.1.2. Die Rolle der Polizeibehörde
Bei der Polizeibehörde wurde die neue Form der Budgetierung in zwei Revieren sowie im Ausbildungszentrum der Wasserschutzpolizei eingeführt. Im Bereich Sachmittel erhielten diese Stellen ein selbst zu verwaltendes Jahresbudget. Wichtigster Ansatzpunkt war die Ermittlung der Revierkosten. Dazu wurde durch die Einführung eines Produktkataloges die Berechnung der „Mannstunden“ vorgenommen.
Als Ergebnis muß eine effektivere und erfolgreichere Gestaltung der Arbeit des Personals genannt werden. Durch die Möglichkeit der Restmittelüber- tragung konnte das Phänomen des Dezemberfiebers beseitigt werden. Leider wurden jedoch diese Überschüsse zur Deckung des Gesamtbud- gets herangezogen, was auf viel Unverständnis in den betroffen Abteilun- gen stieß.
Die exakte interne Leistungsverrechnung scheiterte jedoch, da keine flä- chendeckende Kostenrechnung in allen Verwaltungseinheiten vorhanden ist, die Instrumente nicht auf die spezifischen Bedürfnisse in Hamburg ab- gestimmt sind und auch der Aufwand selbst in keinem Verhältnis zum Er- trag steht.
Das Personal befürchtete tendenziell eine Machtverlust, was aber auch an der Tatsache liegen mag, daß die notwendigen Qualifikationen zum Umgang mit den neuen Kompetenzen schlichtweg fehlen. Hier muß gesagt werden, daß eine Ausweitung der politischen Steuerungsfähigkeit der Verwaltung auch mit dem entsprechenden Steuerungswillen der politisch Verantwortlichen einhergehen muß.
3.1.3. Die Rolle der Behörde für Wissenschaft und Forschung
Die Reformen in diesem Bereich konzentrierten sich vor allem auf Hochschulangelegenheiten. Hier steht ganz klar die Globalisierung des Hochschulbudgets an erster Stelle der Reformliste.
Die neue Form der Budgetierung wurde auf zwei Arten verwirklicht. In Teilbereichen wurde vollständig globalisiert und teilweise wurde mit Pilot- projekten gearbeitet. Die Globalbudgetierung wurde dabei auch vor allem im Sach- und im Personalhaushalt angewandt. Größere Investitionen bil- deten eine Ausnahme, da sich hier die Politik noch vorbehält Prioritäten zu setzen.
Für eine umfangreiche Bilanz fehlen klarerweise noch die Erfahrungen, doch muß auch hier ein mehr an Flexibilität und vor allem eine Abkehr vom Dezemberfieber als Erfolge herausgestrichen werden
3.2. Verwaltung in Wettbewerb
In diesem Fallbeispiel soll im Speziellen auf die Situation der Gemeinden im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform des Gemeinwesens eingegangen werden.
In der Bundesrepublik Deutschland wird seit Beginn der Neunziger Jahre ein Reformprozeß in der öffentlichen Verwaltung angestrebt. Ziel dieses Prozesses ist die Loslösung vom Grundmodell der Bürokratie. Dieses soll langfristig durch neue Formen der Verwaltungssteuerung ersetzt werden. Die Erreichung dieses Zieles wird durch Einführung neuer handlungslei- tender Grundprinzipien versucht. Dabei kommt es inbesonders zur An- wendung von verschiedensten Managmentinstrumenten um die Leistungs- fähigkeit der öffentlichen Verwaltung wiederherzustellen. Dabei werden die Instrumente auf drei verschiedenen Ebenen eingesetzt.
Das Rollen- und Funktionsverständnis der Verwaltung und des Staates und die Veränderung in diesen Bereichen vollziehen sich auf der ersten Ebene. Man spricht hier auch von einem Wandel vom produzierenden zum gewährleistenden Staat, welcher sich nur mehr für die Gewährleis- tung von Aufgaben verantwortlich zeichnet. Nutznießer dieser Entwicklung ist der tertiäre Sektor, welcher nun als Anbieter öffentlicher Dienstleistun- gen wirtschaftliche Zuwächse verzeichnen kann. Idealform dieser Entwick- lung sind die bereits verbreiteten Public Private Partnerships.
Die externe Strukturreform bildet den Schwerpunkt der zweiten Ebene. Dabei stehen Einführung von Wettbewerbsbedingungen mittels Bench- marking und ein Wandel von der angebotsorientierten zur nachfrageorien- tierten Steuerung in Vordergrund. Über ein Gutscheinsystem soll auch die Finanzierung öffentlicher Dienstleister durch den Nutzer verstärkt werden.
Die dritte Ebene bildet schließlich die Binnenmodernisierung, welche Strukturänderungen bei dezentralen Dienstleistungs- und Verantwor- tungszentren mit zurechenbaren Kosten und Leistungen einschließlich dezentraler Ressourcenverantwortung im Mittelpunkt sieht. Im Bereich des Rechnungswesens sind hier vor allem die globale Budgetierung und das Konraktmanagment als die zentralen Reformbegriffe zu nennen. Im Be- reich des Personalwesens sollen verstärkt Anreiz- und Beurteilungssyste- me zum Einsatz kommen.
Oberziel dieser Reformbestrebungen ist die langfristige Wandlung von der dienstleistungsorientierten Verwaltung hin zur Bürgerkommune.
Problem treten dabei durch die isolierte Einführung einzelnen Managmen- tinstrumente auf. Vor allem im Bereich der Kosten- und Leistungsrech- nung fehlt teilweise jegliche Verknüpfung mit der Budgetierung. Die dabei angestrebte Transparenz wird nur mit Zurückhaltung realisiert, da Konflik- te im personalen Bereich vorprogrammiert sind. Das Instrument der Glo- balbudgetierung darf hierbei auch nicht als Reformelement, sondern muß auch unter dem Gesichtspunkt einer intelligenten Sparstrategie betrachtet werden. Tendenziell wird dabei die klassische Haushaltsbürokratie durch eine neue Produktbürokratie abgelöst. Da die Intensität und Reichweite der Reformen von Verwaltung und Politik gestaltet werden, sind Verzöge- rungen vorprogrammiert, da ja durch Konzepte der Globalbudgetierung vor allem das Budgetrecht der Legislative außer Kraft gesetzt wird.
Daher sollte der Wandel von der produzierenden Verwaltung zur Gewährleistungsverwaltungen konsequenter vorangetrieben werden. Dies ist sicherlich durch eine stärkere Wettbewerbsorientierung und durch Ausstattung des Bürgers mit Nachfragemacht zu realisieren.
(aus: Budäus,1999)
Quellenverzeichnis
- Budäus D., „Verwaltung im Wettbewerb“ in „der gemeinderat-spezial 2/99“ entnommen aus www.gemeinderat- online.de/archiv/artikel/n94.htm am 5.12.2000
- Engelhardt G., Hegman H.,Schweizer C., „Neues Steuerungsmodell und Globalbudgetierung in Hamburg - Ergebnisse eines Projektseminars“, Universität Hamburg, Nov. 1998
- Klug F., „Grundlagen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswe- sens“ in ÖHW 41.Jg. Heft 1-2, Wien April 2000
- Schedler K., „Ansätze einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung“, Verlag Haupt, Bern 1996
- Thom N. & Ritz A., „Public Managment“, Verlag Gabler, 2000
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Haushaltswesen in Österreich?
Das Haushaltswesen in Österreich dient dem Nachweis des Deckungserfolges und Deckungsverlaufes. Es orientiert sich an strengen Haushaltsgrundsätzen (Budgetprinzipien) wie Vorherigkeit, Jährlichkeit, Vollständigkeit, Spezialität, Haushaltsausgleich, Publizität sowie Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Es ist in ordentliche und außerordentliche Haushalte unterteilt.
Welche Budgetgrundsätze gibt es?
Wichtige Budgetgrundsätze sind:
- Vorherigkeit, Jährlichkeit & Fälligkeit: Der Voranschlag muss im Voraus für das betreffende Finanzjahr beschlossen werden, und alle Einnahmen und Ausgaben sind in dem Jahr zu veranschlagen, in dem sie fällig werden.
- Vollständigkeit: Alle für das kommende Haushaltsjahr fälligen Einnahmen und Ausgaben sind brutto in den Voranschlag aufzunehmen.
- Spezialität: Budgetmittel dürfen nur für den vorhergesehenen Zweck (qualitative Spezialität) und in der angegebenen Höhe (quantitative Spezialität) verwendet werden. Die zeitliche Spezialität schränkt die Mittelverwendung auf die jeweilige Periode ein.
- Haushaltsausgleich: Ziel ist, dass die Ausgaben durch die Einnahmen gedeckt sind.
- Publizität: Alle den Haushalt betreffenden Entscheidungen müssen in öffentlichen Sitzungen getroffen werden, und alle Regelungen müssen zur öffentlichen Einsichtnahme aufliegen.
- Wirtschaftlichkeit & Sparsamkeit: Bei der Haushaltserstellung sind die Voranschlagsbeträge möglichst genau zu eruieren und sparsam zu bemessen.
Was ist der Unterschied zwischen ordentlichem und außerordentlichem Haushalt?
Der ordentliche Haushalt umfasst die periodisch wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben, während der außerordentliche Haushalt alle Ausgaben und Einnahmen beinhaltet, die durch einmalige Ereignisse entstehen.
Was ist der Budgetkreislauf?
Der Budgetkreislauf umfasst die folgenden Schritte: Voranschlagserstellung und Beschlussfassung, Ausführung des Voranschlags durch die zuständigen Verwaltungsbehörden, Rechnungsabschluss am Ende des Finanzjahres und Kontrolle durch den Rechnungshof.
Was sind Ansätze für Reformen im Haushaltswesen?
Reformansätze zielen darauf ab, die ökonomische Zielsetzung stärker in den Vordergrund zu rücken. Statt ordentlichem und außerordentlichem Haushalt treten ein laufender Verwaltungshaushalt und ein Investitions- bzw. Vermögenshaushalt. Dies führt zu einer Abkehr vom Grundsatz der Einzeldeckung hin zum Gesamtdeckungsgrundsatz. Es wird auch die Sinnhaftigkeit der Jährlichkeit bei der Haushaltsplanung hinterfragt, wobei eine mehrjährige mittelfristige Finanzplanung in Betracht gezogen wird.
Was ist das Neue Steuerungsmodell (NSM)?
Das Neue Steuerungsmodell ist ein Ansatz zur wirkungsorientierten Verwaltungsführung, der Kunden- und Mitarbeiterorientierung, Qualitätsbewusstsein, Wettbewerb, Wirkungskontrolle, Dezentralisation und Änderung der Verwaltungskultur in den Mittelpunkt stellt. Es wird häufig in Verbindung mit Globalbudgetierung eingesetzt.
Was ist Globalbudgetierung?
Globalbudgetierung ist die Outputsteuerung durch Globalbudgets nach Produktegruppen, welche die bisherige Detailbudgetierung nach Ausgabenposten ersetzen soll. Sie erfordert zusätzliche Angaben über Ziele und Leistungsstandards und -indikatoren.
Welche Zwecke werden mit der Einführung eines Globalbudgets verfolgt?
Mit der Einführung eines Globalbudgets werden folgende Zwecke im Bereich des Finanzmanagments einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung verfolgt: Vergrößerung der Verantwortlichkeit, Vergrößerung des Entscheidungsspielraumes, Verkürzung der Entscheidungswege und Produktorientierung im finanziellen Management.
Welche Varianten der Globalbudgetierung gibt es?
Es gibt verschiedene Ausprägungen des Globalbudgets: Globalkredit (Zusammenfassung der Detailpositionen zu wichtigsten Aufwandsarten), Zusammenfassung der Aufwand- und Ertragsseite der einzelnen Detailpositionen zu einem Posten, und Nettobudgetierung (Zusammenfassung aller Detailpositionen der laufenden Tätigkeiten zu einer einzigen Position).
Was sind obligatorische und kommerzielle Produkte im Budget?
Obligatorische Produkte sind Leistungen, die die Verwaltung verpflichtend erbringt, während kommerzielle Produkte Dienstleistungen sind, die die Verwaltung auf dem Markt anbietet, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Die budgetäre Behandlung dieser Produkte muss geregelt werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.
Welche Fallbeispiele werden genannt?
Die Fallbeispiele umfassen:
- NSM und Globalbudgetierung in Hamburg (Finanzbehörde, Polizeibehörde, Behörde für Wissenschaft und Forschung)
- Verwaltung im Wettbewerb (Situation der Gemeinden im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform)
Was sind Public Private Partnerships?
Public Private Partnerships sind Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, um öffentliche Dienstleistungen bereitzustellen.
- Quote paper
- Stephan Gottinger (Author), 2001, Globalbudgetierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/102863