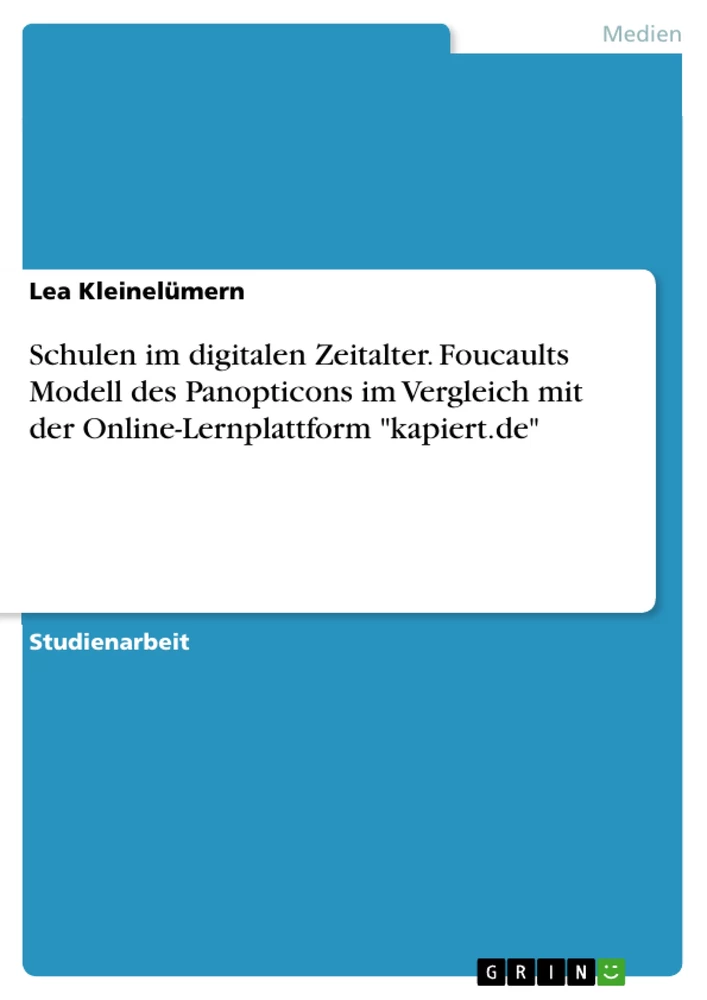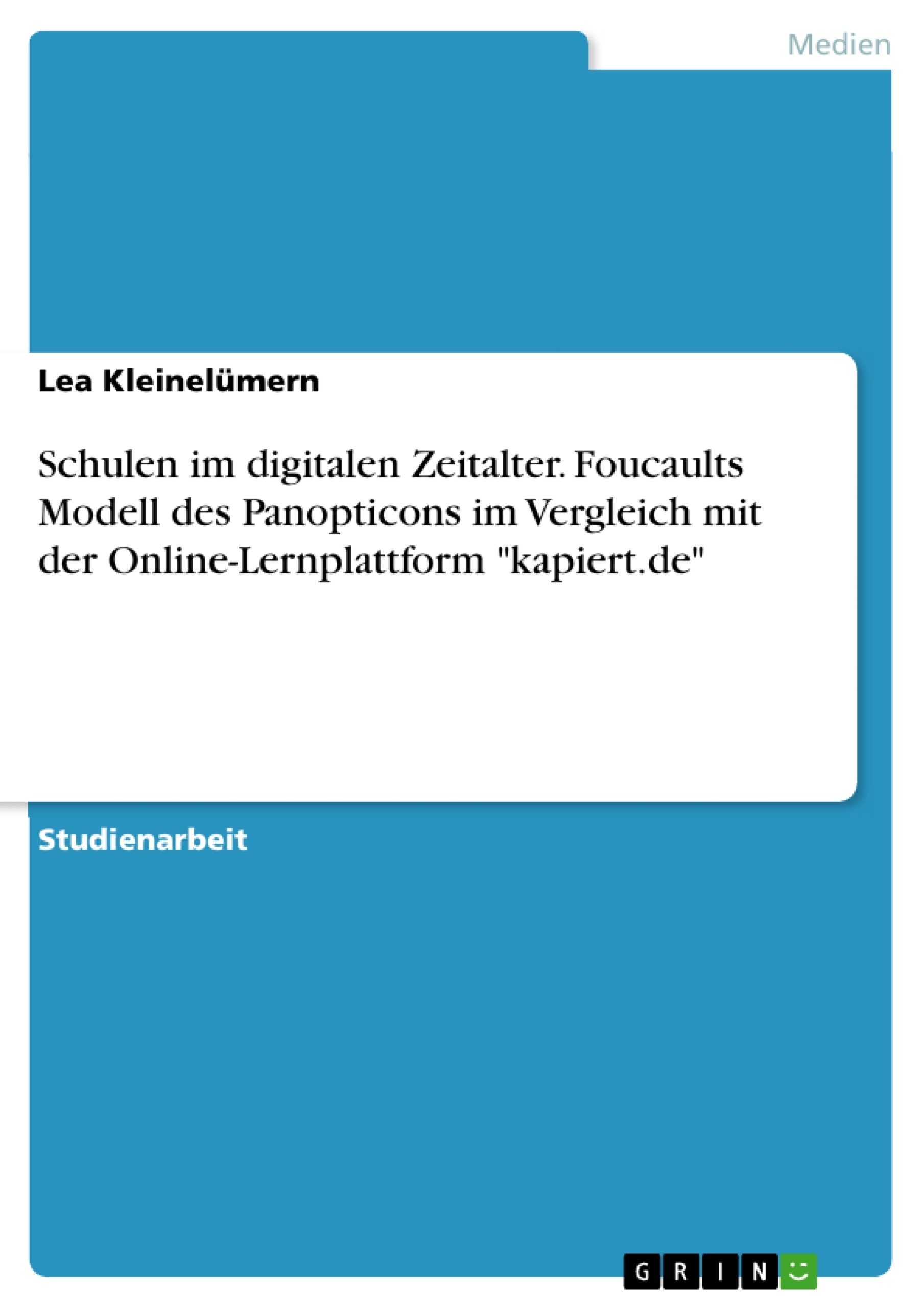Diese Arbeit beschäftigt sich anhand einer erfolgreichen Online-Lernplattform näher mit den Fragen nach Disziplinierung, Überwachung und Kontrolle in der Schule. Um diesem Thema auf den Grund gehen zu können, werden die Ausführungen von dem Philosophen Michel Foucault zu einem Modell eines Disziplinierungsverfahrens mit der Benutzeroberfläche der Lernplattform "kapiert.de" verglichen. Um das Datenmaterial der Plattform analysieren und mit den Thesen des Modells vergleichen zu können, wird eine geeignete Schritt-für-Schritt Methode aus dem "Neue Medien und Gesellschaft"-Bereich angewendet. Die Datenanalyse soll dazu beitragen, die folgende Forschungsfrage zu beantworten: Inwiefern lässt sich das Modell des Panopticons auf die Online-Lernplattform "kapiert.de" übertragen?
Zunächst wird die die Grundlagen des Modells des Panopticons nach Foucault und dessen Relevanz für den erziehungswissenschaftlichen Fachbereich der Schule thematisiert. Anknüpfend daran, wird der Forschungsstand zu bestehenden Studien zu der Thematik der Überwachung, Disziplinierung und Kontrolle bei Schülern vorgestellt. Dabei zielt die Arbeit darauf ab, die bestehende Forschungslücke aufzuzeigen, einen Überblick über die Thematik zu verschaffen und die Fragestellung sinngemäß in den bestehenden Kontext einordnen zu können. Daran anschließend wird das das Datenmaterial und die theoretischen Hintergründe, wie auch das forschungspraktische Vorgehen der gewählten Methode abgebildet. In der Datenanalyse wird mithilfe der Methode die Online-Plattform analysiert und die Ergebnisse auf das Modell des Panopticons nach Foucault bezogen.
Foucaults Ausführungen zu Disziplinierung, Macht und Kontrolle in Schulen stoßen auf große Aufmerksamkeit in der Erziehungswissenschaft. Der Philosoph fokussiert sich bei seiner Studie vor allem auf die Wirkung von Räumen und wie Menschen in diesen angeordnet sind, weshalb auch die Klasse als Disziplinierungsraum überdacht wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell des Panopticons
- Forschungsstand
- Methodisches Vorgehen
- Das Datenmaterial: Die Plattform „kapiert.de“
- Die Methode: Der „,App-Walkthrough“
- Die Datenanalyse
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, inwiefern das Modell des Panopticons auf die Online-Lernplattform „kapiert.de“ übertragbar ist. Hierbei wird untersucht, welche Möglichkeiten der Disziplinierung, Überwachung und Kontrolle durch digitale Lernplattformen entstehen.
- Disziplinierung, Überwachung und Kontrolle in Schulen
- Das Modell des Panopticons und dessen Anwendung in der Schule
- Analyse der Online-Lernplattform „kapiert.de“
- Vergleich der Plattform mit dem Modell des Panopticons
- Relevanz der Ergebnisse für den Praxiskontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Disziplinierung in Schulen im digitalen Zeitalter vor und erläutert die Relevanz von digitalen Lernplattformen in diesem Zusammenhang. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, das Modell des Panopticons auf die Online-Lernplattform „kapiert.de“ zu übertragen.
- Das Modell des Panopticons: Dieses Kapitel behandelt das Modell des Panopticons von Jeremy Bentham und dessen Relevanz für die Erforschung von Überwachung und Kontrolle in verschiedenen Institutionen, insbesondere in Schulen. Der Fokus liegt dabei auf der Schaffung eines permanenten Sichtbarkeitszustandes und der damit verbundenen Auswirkungen auf das Verhalten der Betroffenen.
- Forschungsstand: Der Forschungsstand beleuchtet die bestehende Literatur zum Thema Überwachung, Disziplinierung und Kontrolle in Schulen. Ziel dieses Kapitels ist es, einen Überblick über den Forschungsstand zu geben und die Forschungslücke zu identifizieren, die diese Arbeit versucht zu schließen.
- Methodisches Vorgehen: Dieses Kapitel erläutert die gewählte Methode, den „App-Walkthrough“, und die Analyse des Datenmaterials, der Online-Lernplattform „kapiert.de“. Die Qualifikation dieser Methode für die Fragestellung wird begründet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Disziplinierung, Überwachung und Kontrolle in Schulen im digitalen Zeitalter. Zentrale Themen sind das Modell des Panopticons von Jeremy Bentham, die Online-Lernplattform „kapiert.de“ sowie die Anwendung des „App-Walkthrough“ als Analysemethode.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Foucaults Modell des Panopticons?
Ein architektonisches Modell der Überwachung, bei dem ein Beobachter alle Insassen sehen kann, ohne selbst gesehen zu werden, was zur Selbstdisziplinierung führt.
Wie lässt sich das Panopticon auf kapiert.de übertragen?
Digitale Lernplattformen ermöglichen eine permanente Sichtbarkeit von Lernfortschritten und Aktivitäten, was eine Form der digitalen Überwachung darstellt.
Was ist ein „App-Walkthrough“?
Eine Forschungsmethode, bei der die Benutzeroberfläche und Funktionen einer Anwendung systematisch analysiert werden, um soziale Dynamiken zu verstehen.
Fördert kapiert.de die Selbstdisziplinierung von Schülern?
Die Arbeit untersucht, ob die ständige Kontrollmöglichkeit durch die Plattform Schüler dazu bringt, ihr Verhalten im Sinne der schulischen Erwartungen anzupassen.
Welche Rolle spielt der Raum in Foucaults Theorie?
Foucault betont, dass die Anordnung von Menschen in Räumen (wie Klassenzimmern) Machtstrukturen und Disziplinierung erst ermöglicht.
- Quote paper
- Lea Kleinelümern (Author), 2020, Schulen im digitalen Zeitalter. Foucaults Modell des Panopticons im Vergleich mit der Online-Lernplattform "kapiert.de", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030084