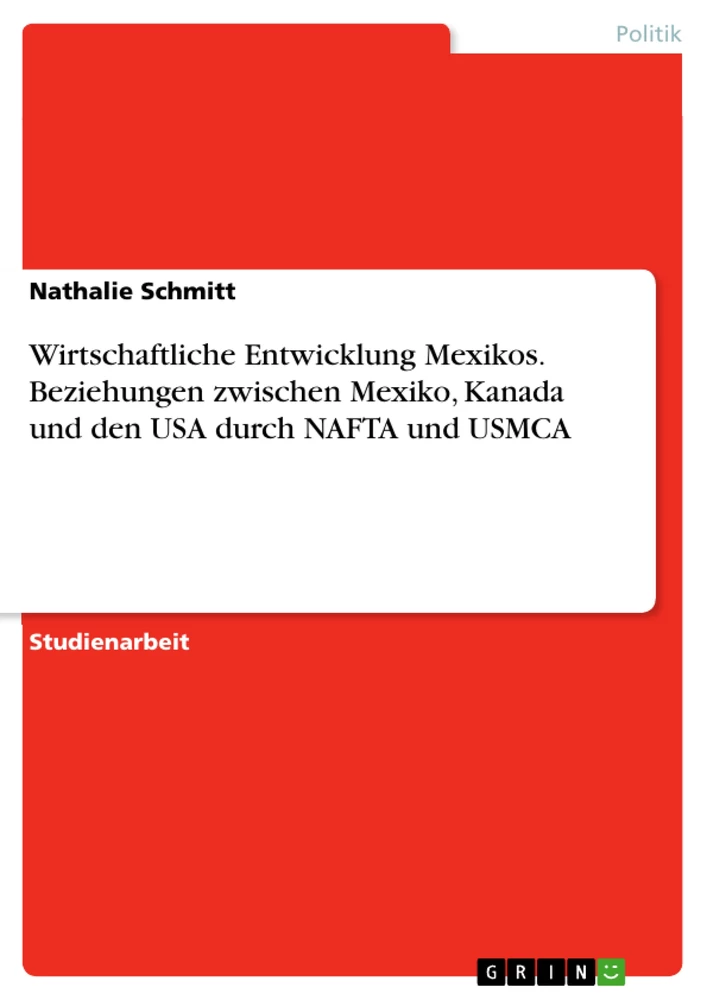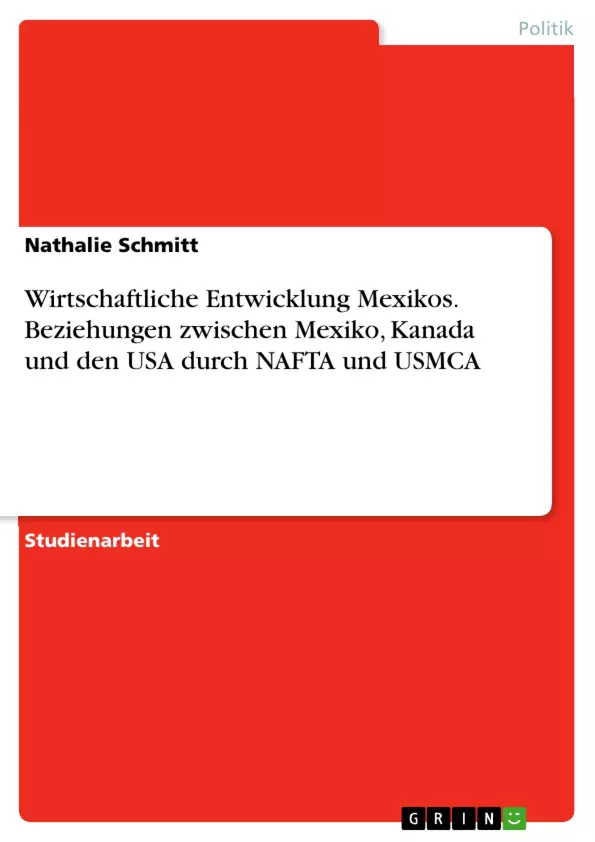Diese Arbeit untersucht, welche Entwicklung Mexiko bereits durch das Freihandelsabkommen NAFTA gelang und inwiefern diese Entwicklung durch das neue Freihandelsabkommen USMCA beeinflusst wird. Zu diesem Zwecke soll zunächst ein kurzer Überblick über die wichtigsten außenpolitischen und ökonomischen Entwicklungen Mexikos in der Zeit von 1910 bis 1994 gegeben werden, da diese Zeit besonders ausschlaggebend für ein mögliches Freihandelsabkommen war.
Anschließend soll das sodann beschlossene Abkommen NAFTA hinsichtlich seines Inhalts und seiner Entwicklungsfolgen für Mexiko Beachtung finden. Das Folgekapitel soll sich in gleicher Weise mit dem Folgeabkommen USMCA beschäftigen, bevor beide dann anhand zuvor festgelegter Kriterien miteinander verglichen werden sollen, um feststellen zu können, inwiefern die Neugestaltung des Abkommens sich auf die weitere Entwicklung Mexikos auswirkt.
Sie teilen sich nicht nur einen gemeinsamen Kontinent, sondern auch seit bereits über 25 Jahren eine gemeinsame Freihandelszone. Die Rede ist von den nordamerikanischen Ländern Mexiko, Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika. Fast genauso lange wie diese Freihandelszone existiert wurde sie auch durch das Freihandelsabkommen NAFTA (North American Free Trade Agreement) geregelt.
Jedoch sollte sich dies nun mit dem letzten politischen Führungswechsel der USA im Jahre 2017 ändern. Bereits während des Wahlkampfes betitelte der nun amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, das NAFTA als den "schlechtesten Deal aller Zeiten". Es war dort also schon abzusehen, dass sich das Freihandelsabkommen unter seiner Präsidentschaft einer Reform unterziehen werden muss.
Das Ergebnis dessen nennt sich USMCA (U.S.-Mexico-Canada Agreement) und stellt das Nachfolgeabkommen des NAFTA dar. Besonders Mexiko profitierte bislang besonders stark von dem Freihandelsabkommen. Auf dem Weg vom Schwellenland zur Industrienation konnte das Land durch NAFTA schon große Entwicklungsfortschritte verbuchen. Ob sich durch das neue Abkommen USMCA nun etwas an der entwicklungsfördernden Ausgestaltung des Freihandels ändert oder nicht, gilt es nun herauszufinden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die wichtigsten außenpolitischen und ökonomischen Entwicklungen Mexikos von 1910 bis 1994
- Das Freihandelsabkommen NAFTA
- Die Freihandelspolitik der NAFTA
- Die Auswirkungen der NAFTA auf die Entwicklung Mexikos
- Das Freihandelsabkommen USMCA
- Die Freihandelspolitik des USMCA
- Die Auswirkungen des USMCA auf die Entwicklung Mexikos
- Der Vergleich der Auswirkungen der NAFTA und des USMCA auf die Entwicklung Mexikos
- Die Vergleichskriterien
- Der Vergleich
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Freihandelsabkommen NAFTA und USMCA auf die Entwicklung Mexikos. Sie analysiert die wirtschaftlichen und außenpolitischen Entwicklungen Mexikos im 20. Jahrhundert, um den Kontext der beiden Abkommen zu verstehen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich beider Abkommen und ihrer jeweiligen Einflüsse auf die mexikanische Wirtschaft.
- Die ökonomischen und außenpolitischen Entwicklungen Mexikos von 1910 bis 1994
- Der Inhalt und die Politik des NAFTA
- Der Inhalt und die Politik des USMCA
- Der Vergleich der Auswirkungen von NAFTA und USMCA auf die mexikanische Wirtschaft
- Die langfristigen Folgen der Freihandelsabkommen für Mexiko
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Freihandelsabkommen NAFTA und USMCA ein und beschreibt deren Bedeutung für Mexiko. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Auswirkungen beider Abkommen auf die Entwicklung Mexikos und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Die wichtigsten außenpolitischen und ökonomischen Entwicklungen Mexikos von 1910 bis 1994: Dieses Kapitel beleuchtet die bedeutenden politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen Mexikos vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Inkrafttreten des NAFTA. Es beschreibt die Mexikanische Revolution, das "mexikanische Wunder" der Wirtschaftsentwicklung in den 1940er bis 1970er Jahren, die anschließende Schuldenkrise der 1980er Jahre und den darauf folgenden Wandel hin zu einer liberalisierten, exportorientierten Wirtschaft. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Wirtschaftspolitik und der Beziehungen Mexikos zu den USA, die den Weg für das NAFTA ebneten. Die Kapitel beschreibt den Wandel von einem nach innen gerichteten Wirtschaftsnationalismus hin zu einer globalisierten Wirtschaft, der entscheidend für das Verständnis des Beitritts zu NAFTA ist.
3. Das Freihandelsabkommen NAFTA: Dieses Kapitel analysiert das NAFTA-Abkommen. Der Abschnitt über die Freihandelspolitik beschreibt die zentralen Bestimmungen des Abkommens, wie z.B. die Regeln für die Ursprungskennzeichnung von Waren und die schrittweise Abschaffung von Zöllen. Der zweite Teil konzentriert sich auf die Auswirkungen des NAFTA auf die Entwicklung Mexikos. Es beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die sich aus dem Abkommen ergaben. Die Kapitel beschreibt detailliert die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Vereinbarung auf Mexiko, unter Berücksichtigung von sowohl positiven als auch negativen Aspekten der Implementierung.
Schlüsselwörter
Mexiko, NAFTA, USMCA, Freihandelsabkommen, Wirtschaftsentwicklung, Außenpolitik, Mexikanische Revolution, Liberalisierung, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Industrienation, Schwellenland, USA, Kanada.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Auswirkungen der Freihandelsabkommen NAFTA und USMCA auf die Entwicklung Mexikos
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen der Freihandelsabkommen NAFTA und USMCA auf die Entwicklung Mexikos. Sie analysiert die wirtschaftlichen und außenpolitischen Entwicklungen Mexikos im 20. Jahrhundert, um den Kontext der beiden Abkommen zu verstehen und vergleicht deren jeweilige Einflüsse auf die mexikanische Wirtschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ökonomischen und außenpolitischen Entwicklungen Mexikos von 1910 bis 1994, den Inhalt und die Politik des NAFTA und des USMCA, einen Vergleich der Auswirkungen beider Abkommen auf die mexikanische Wirtschaft sowie deren langfristige Folgen für Mexiko. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Vergleich der beiden Abkommen gewidmet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, gefolgt von einem Kapitel über die wichtigsten außenpolitischen und ökonomischen Entwicklungen Mexikos bis 1994. Danach werden das NAFTA und das USMCA jeweils in eigenen Kapiteln detailliert analysiert, wobei jeweils die Freihandelspolitik und deren Auswirkungen auf Mexiko beleuchtet werden. Ein separates Kapitel vergleicht die Auswirkungen beider Abkommen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse von NAFTA?
Das Kapitel zu NAFTA beschreibt die zentralen Bestimmungen des Abkommens (z.B. Regeln für die Ursprungskennzeichnung von Waren und schrittweise Abschaffung von Zöllen) und analysiert detailliert die politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf Mexiko, sowohl positive als auch negative Aspekte der Implementierung werden berücksichtigt.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse von USMCA?
Ähnlich wie bei NAFTA werden im Kapitel zum USMCA die zentralen Bestimmungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung Mexikos analysiert. Der Fokus liegt dabei auf den politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen des Abkommens.
Wie werden NAFTA und USMCA verglichen?
Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Vergleich der Auswirkungen von NAFTA und USMCA auf die mexikanische Wirtschaft. Es werden explizite Vergleichskriterien definiert und angewendet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mexiko, NAFTA, USMCA, Freihandelsabkommen, Wirtschaftsentwicklung, Außenpolitik, Mexikanische Revolution, Liberalisierung, Globalisierung, Wirtschaftswachstum, Industrienation, Schwellenland, USA, Kanada.
Welche Periode der mexikanischen Geschichte wird betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Periode von 1910 bis 1994 (und darüber hinaus durch die Auswirkungen von NAFTA und USMCA), um den Kontext der Freihandelsabkommen zu verstehen und die langfristigen Folgen zu analysieren. Besonders relevant ist dabei die Mexikanische Revolution und der Wandel hin zu einer exportorientierten Wirtschaft.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Citar trabajo
- Nathalie Schmitt (Autor), 2020, Wirtschaftliche Entwicklung Mexikos. Beziehungen zwischen Mexiko, Kanada und den USA durch NAFTA und USMCA, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030158