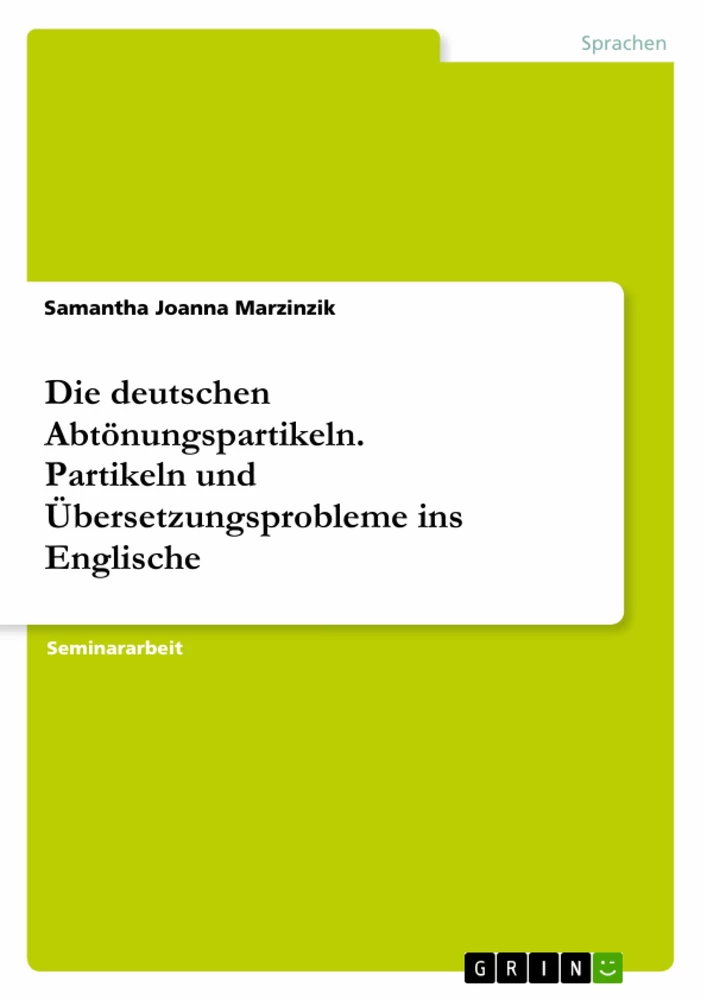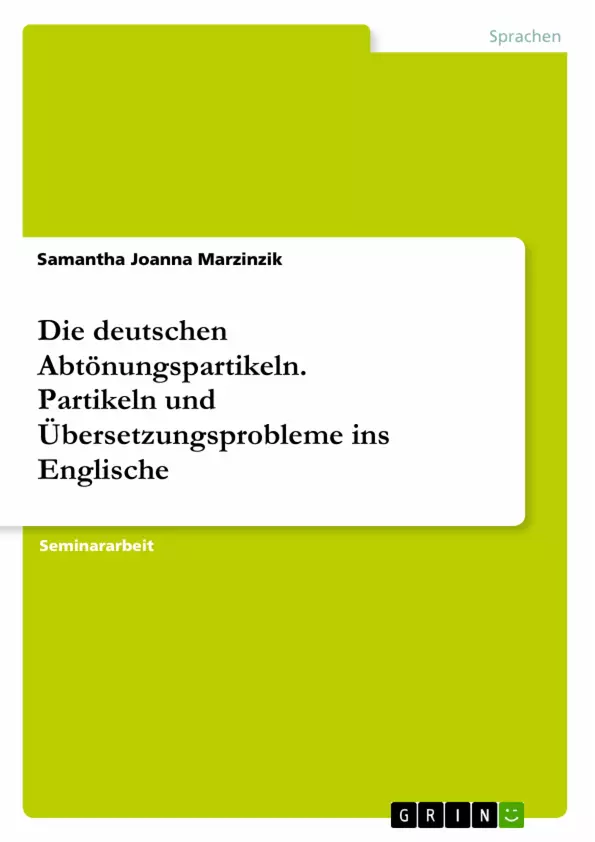In der Ausarbeitung werden die deutschen Partikeln aus der Sicht ihrer textgrammatischen und pragmatischen Funktionen betrachtet und zudem als Problem der Übersetzung ins Englische behandelt. Die primäre Fragestellung ist, auf welche Weise man angemessene Äquivalente für die deutschen Partikeln im Englischen ermitteln kann.
Es soll zunächst einen Überblick über das Thema der Partikeln geben. Nach der hier verwendeten Literatur „Understanding English-German Contrasts“ stellen die Partikeln im Deutschen eine Subklasse der Funktionswörter dar, wobei sie neben den Pronomen die zweitgrößte Unterklasse bilden. Die Klasse der Partikeln wird an sich in Grad- bzw. Fokuspartikeln und Abtönungs- bzw. Modalpartikeln unterteilt, sowie in HELBIG beschrieben in Steigerung-, Antwort- , Negation- und Infinitivpartikeln. In dieser Ausarbeitung werden allerdings ausschließlich die Abtönungs- und Gradpartikeln behandelt.
Um am Ende dieser Ausarbeitung eine Antwort auf die zentrale Fragestellung zu geben, wird in dem nachfolgenden Kapitel zunächst die Funktion der Abtönungspartikeln genauer betrachtet und analysiert, um diese danach in Zusammenhang mit der Bedeutung von „Abtönung“ in der Bezeichnung „Abtönungspartikel“ zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die deutschen Abtönungspartikeln
- Die Funktion von Abtönungspartikeln
- Die Bedeutung von „Abtönung“ in der Bezeichnung „Abtönungspartikel“
- Der synonym verwendete Begriff für „Abtönungspartikel“
- Die Wiedergabe deutscher Abtönungspartikeln im Englischen
- Die deutschen Gradpartikeln
- Die Funktion von Gradpartikeln
- Kritische Betrachtung der synonymen Verwendung von Grad- und Fokuspartikeln
- Quantifizierende bzw. skalierende Information oder Interpretation?
- Die Wiedergabe deutscher Gradpartikeln im Englischen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht deutsche Partikeln, insbesondere Abtönungs- und Gradpartikeln, hinsichtlich ihrer textgrammatischen und pragmatischen Funktionen und beleuchtet die Herausforderungen ihrer Übersetzung ins Englische. Das Hauptziel besteht darin, geeignete Äquivalente für diese Partikel im Englischen zu identifizieren.
- Funktion von Abtönungspartikeln im Deutschen
- Funktion von Gradpartikeln im Deutschen
- Übersetzungsäquivalente für Abtönungspartikeln im Englischen
- Übersetzungsäquivalente für Gradpartikeln im Englischen
- Unterschiede in der pragmatischen Funktion zwischen deutschen und englischen Partikeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung liefert einen Überblick über die Thematik der deutschen Partikeln, kategorisiert sie nach den Werken von König/Gast und Helbig und kündigt die Fokussierung auf Abtönungs- und Gradpartikeln an. Sie skizziert den Forschungsansatz, der die Funktionen der Partikeln analysiert und die Herausforderungen ihrer Übersetzung ins Englische untersucht. Die Einleitung betont die zentrale Forschungsfrage nach angemessenen englischen Äquivalenten für deutsche Partikel und strukturiert den weiteren Aufbau der Arbeit.
Die deutschen Abtönungspartikeln: Dieses Kapitel analysiert die Funktion von Abtönungspartikeln, indem es die Merkmale nach Helbig (1988: 32) erläutert und diese anhand von Beispielen aus König/Gast (2007: 245) illustriert. Es wird der Zusammenhang zwischen der Funktion und der Bezeichnung „Abtönung“ untersucht und der synonym verwendete Begriff „Modalpartikel“ kurz angesprochen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Schwierigkeit, für deutsche Abtönungspartikeln angemessene Äquivalente im Englischen zu finden, wie von König/Gast (2007: 245) beschrieben. Die Analyse vergleicht Sätze mit und ohne Abtönungspartikel, um deren Einfluss auf die Bedeutung und die Sprechereinstellung zu verdeutlichen.
Die deutschen Gradpartikeln: Dieses Kapitel befasst sich mit der Funktion von Gradpartikeln im Deutschen. Es beleuchtet die synonyme Verwendung des Begriffs „Fokuspartikel“ im Kontext der Funktionsweise der Gradpartikel und diskutiert die Frage nach quantifizierender oder skalierender Interpretation. Die Analyse betrachtet die Funktion der Gradpartikeln und deren Auswirkungen auf die Satzbedeutung. Abschließend wird der Aspekt der Übersetzung von Gradpartikeln vom Deutschen ins Englische behandelt.
Schlüsselwörter
Deutsche Partikeln, Abtönungspartikeln, Gradpartikeln, Modalpartikeln, Fokuspartikeln, Textgrammatik, Pragmatik, Übersetzung, Englisch, Äquivalente, König/Gast, Helbig.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse Deutscher Partikeln
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert deutsche Partikeln, insbesondere Abtönungs- und Gradpartikeln. Der Fokus liegt auf ihren textgrammatischen und pragmatischen Funktionen sowie den Herausforderungen ihrer Übersetzung ins Englische. Ziel ist die Identifizierung geeigneter englischer Äquivalente.
Welche Partikeltypen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf Abtönungspartikeln und Gradpartikeln. Der Begriff „Modalpartikel“ wird als Synonym für Abtönungspartikeln erwähnt, und die synonyme Verwendung von „Fokuspartikeln“ im Kontext von Gradpartikeln wird kritisch beleuchtet.
Welche Aspekte der Partikeln werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Funktion der Partikeln (sowohl Abtönungs- als auch Gradpartikeln) im Deutschen, ihre Auswirkungen auf die Satzbedeutung und die Sprechereinstellung. Ein wichtiger Aspekt ist die Untersuchung von Übersetzungsäquivalenten im Englischen und die Unterschiede in der pragmatischen Funktion zwischen deutschen und englischen Partikeln.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach angemessenen englischen Äquivalenten für deutsche Abtönungs- und Gradpartikeln. Zusätzlich werden Fragen nach der Funktion und Bedeutung von „Abtönung“ in der Bezeichnung „Abtönungspartikel“, der synonymen Verwendung von Begriffen wie „Modalpartikel“ und „Fokuspartikel“, sowie nach quantifizierender oder skalierender Interpretation von Gradpartikeln untersucht.
Welche Werke werden als Referenz verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von König/Gast (2007) und Helbig (1988), um die Kategorisierung und Beschreibung der Partikeln zu fundieren und Beispiele zu illustrieren.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zu Abtönungspartikeln, einem Kapitel zu Gradpartikeln und einem Fazit. Die Einleitung gibt einen Überblick und skizziert den Forschungsansatz. Die Kapitel analysieren die jeweiligen Partikeltypen, und das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Deutsche Partikeln, Abtönungspartikeln, Gradpartikeln, Modalpartikeln, Fokuspartikeln, Textgrammatik, Pragmatik, Übersetzung, Englisch, Äquivalente, König/Gast, Helbig.
- Arbeit zitieren
- Samantha Joanna Marzinzik (Autor:in), 2015, Die deutschen Abtönungspartikeln. Partikeln und Übersetzungsprobleme ins Englische, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030182