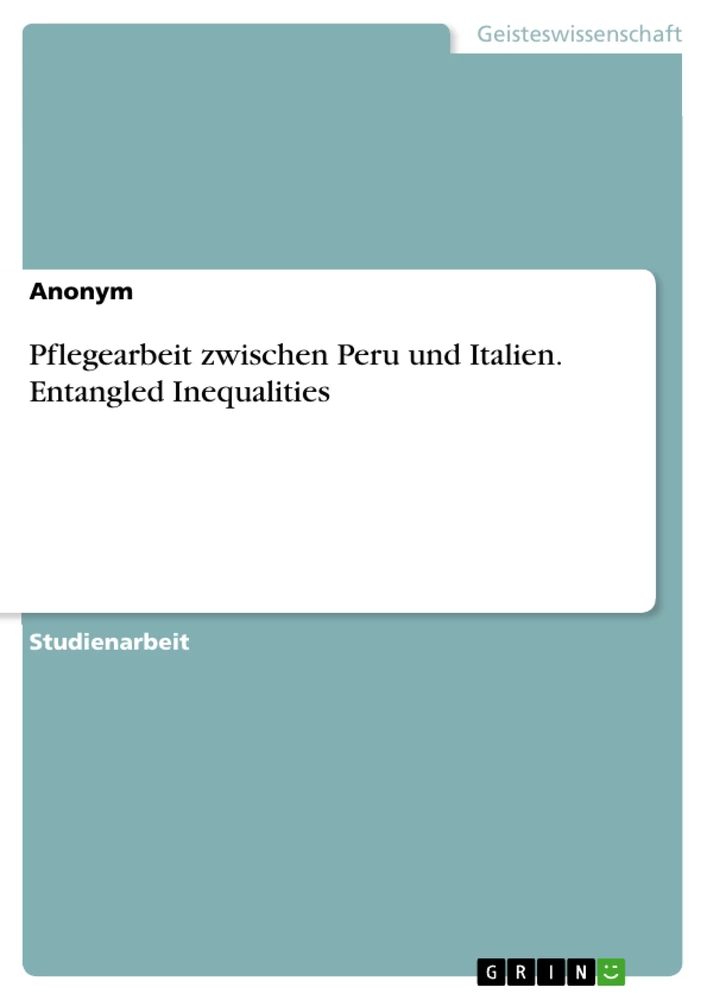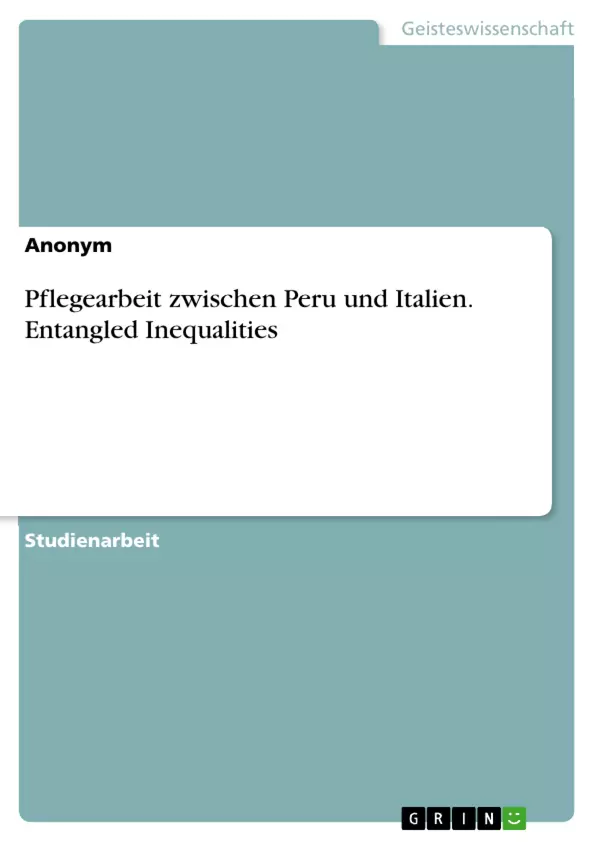Im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Titel „Entangled Inequalities in Transnational Care Chains – Practices Across the Borders of Peru and Italien“ untersucht Anna K. Skornia (2014) die interdependenten Ungleichheiten entlang der transnationalen Pflegekette zwischen Peru und Italien. Sie zeigt, wie sich Achsen der Ungleichheit – Class, Ethnicity, Gender, Place of Residence, Nationality und Migration Status – überschneiden und insbesondere, wie sie sich reproduzieren. Strukturelle Pfadabhängigkeit hinsichtlich der Kolonialgeschichte und des Entwicklungsgefälles zwischen Peru und Italien und verkrustete Traditionen bezüglich gesellschaftlicher Geschlechterrollenverteilung sind dabei wesentliche Reproduktionsfaktoren.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Ausarbeitung der Quintessenz der bereits genannten Monografie von Skornia. Nach der Darstellung der theoretischen Bausteine ihrer Analyse im Kapitel 2 wird auf ihre Forschungsmethodik eingegangen (Kapitel 3). Das Kapitel 4 bildet dann den Kern dieser Arbeit, indem versucht wird, eine in die Komplexität der interdependenten Ungleichheiten und deren Reproduktionsmechanismen einzubringen. Mit einem Fazit und Ausblick beschließt das Kapitel 5 die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie: Entangled Inequalities & Global Care Chain
- Methodik: Multi-Sited Ethnography
- Entangled Inequalities in der Pflegekette zwischen Peru und Italien
- Achsen der Ungleichheit – Intersektionalität
- Die Rolle des Staates
- Strategien der Akteure - Agency und Boundary Work
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Entangled Inequalities entlang der transnationalen Pflegekette zwischen Peru und Italien. Dabei wird die Monografie von Anna K. Skornia (2014) „Entangled Inequalities in Transnational Care Chains Practices Across the Borders of Peru and Italien“ herangezogen, die die interdependenten Ungleichheiten entlang dieser Kette untersucht.
- Intersektionalität der Ungleichheitsachsen (Klasse, Ethnizität, Geschlecht, Wohnort, Nationalität, Migrationsstatus)
- Reproduktion von Ungleichheiten durch strukturelle Pfadabhängigkeit und gesellschaftliche Geschlechterrollen
- Agency der beteiligten Akteure und deren Verhandlungsmacht
- Rolle des Staates im Kontext der transnationalen Pflegekette
- Zusammenhang zwischen Abhängigkeit und Ungleichheit im Bereich der Pflegearbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Thematik der Entangled Inequalities im Kontext der transnationalen Pflegekette vor und führt in das Konzept der interdependenten Ungleichheiten ein. Sie skizziert die Rolle der peruanischen Migrantinnen in Italien und die Besonderheiten der Pflegearbeit. Das Kapitel beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Theorie: Entangled Inequalities & Global Care Chain: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen der Analyse, die auf dem Konzept der Global Care Chain (GCC) und den Entangled Inequalities (EI) basieren. Es beschreibt die Anwendung der GCC und EI auf die transnationale Pflegekette und die Kritik am GCC-Konzept. Darüber hinaus werden die Definition und Anwendung des EI-Konzepts erläutert, sowie die spezifischen Merkmale der Pflegearbeit definiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themenbereiche Entangled Inequalities, Global Care Chain, Transnationale Pflegekette, Intersektionalität, Agency, staatliche Rolle und Abhängigkeit. Darüber hinaus werden die zentralen Konzepte der Pflegearbeit, der „long-distance mothering“ sowie die verschiedenen Formen der Ungleichheit und deren Reproduktion im Kontext der transnationalen Migration behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Entangled Inequalities“?
Es bezeichnet interdependenten Ungleichheiten, bei denen sich verschiedene Achsen wie Klasse, Ethnizität, Geschlecht und Migrationsstatus überschneiden und gegenseitig verstärken.
Warum ist die Pflegekette zwischen Peru und Italien ein Forschungsthema?
Die Arbeit untersucht, wie peruanische Migrantinnen in Italien Pflegearbeit leisten und dabei von kolonialer Geschichte, Entwicklungsgefällen und Geschlechterrollen geprägt werden.
Was ist die „Global Care Chain“ (GCC)?
Die Global Care Chain beschreibt transnationale Netzwerke, in denen Pflegearbeit von Frauen aus dem globalen Süden in den globalen Norden verlagert wird, was oft eigene Betreuungslücken in den Herkunftsländern schafft.
Welche Rolle spielt der Staat in der Pflegekette?
Der Staat beeinflusst durch Migrationsgesetze und Sozialpolitik die Rahmenbedingungen, unter denen Pflegearbeit stattfindet und Ungleichheiten reproduziert werden.
Was bedeutet „long-distance mothering“?
Es beschreibt die Praxis von Migrantinnen, die ihre eigenen Kinder im Herkunftsland lassen und die Mutterrolle über große Distanzen hinweg (z. B. durch Geldüberweisungen und Kommunikation) ausüben.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Pflegearbeit zwischen Peru und Italien. Entangled Inequalities, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1030444